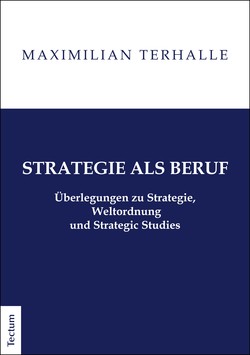Читать книгу Strategie als Beruf - Maximilian Terhalle - Страница 12
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Оглавление2
Konzeptionen – Strategie
und Strategielehre
Einleitung
Die Sprachlosigkeit deutscher Politiker1 und Intellektueller war bemerkenswert, als der US-amerikanische Präsident Donald Trump zeitweilig die NATO für obsolet erklärte, indem er die Fakultativform der Verpflichtungen aus Artikel 5 des Nordatlantikvertrags hervorhob. Als Henry Kissinger dann kurzzeitig Trumps pro-russische Ausrichtung unterstützte, um Chinas militärisches internationales Erstarken durch Entzug seines einzigen starken Verbündeten zu konterkarieren und China damit zu isolieren, hätte dies unausweichlich das Kollabieren der Russlandpolitik des Kabinetts Merkel III – da ohne militärische US-Deckung – zur Folge gehabt (Roloff und Tiede 2016; Pomfret 2016). Bis Mitte des Jahres 2017 schien sich die aus schierer Verzweiflung (da aus Unkenntnis von Trumps Weltsicht) geborene Hoffnung vieler Transatlantiker zu erfüllen, der Präsident nähere sich dem hergebrachten Verständnis von Artikel 5 wieder an. Aber bereits Trumps Rede im September vor den Vereinten Nationen wiederholte seine unmissverständliche Mahnung an Verbündete, sich nicht auf „weit entfernte Länder“, ergo die USA, zu verlassen (United Nations General Assembly 2017, S. 10). Ein durchgestochenes Geheimpapier der NATO vom Oktober, das das Bündnis für nicht verteidigungsfähig erklärte, zeigte dann wie im Brennglas die ganze Ohnmacht deutscher Sicherheitspolitik auf (FAZ 2017). Dass Sigmar Gabriel im Dezember 2017 von der Notwendigkeit einer „strategischeren Außenpolitik“ (Gabriel 2017) sprach, beleuchtete nur den überfälligen Charakter der kommenden Debatte. In dieser wird es um nicht weniger als den Wesenskern deutscher und europäischer Sicherheit gehen. Die Absenz freilich einer systematischen Debatte über Strategie überlässt diesen Kern in unguter Weise der Tagespolitik (wiewohl diese unbestreitbar den Takt des politischen Lebens in Berlin bestimmt).
Dieser Artikel versteht sich deshalb als erster Aufriss eines Forschungsthemas, das in Deutschland bis heute vernachlässigt und nicht systematisch bearbeitet worden ist. In diesem Sinne bietet der Aufsatz einen knappen Überblick über einige wesentlichen Aspekte zum Thema Strategie.2 Bei der Benennung des Forschungsgegenstands wird hier nicht die wörtliche Übersetzung von Strategic Studies adoptiert, sondern das Fach als Strategielehre bezeichnet.3
Die Ausführungen sind folgendermaßen gegliedert: Zunächst wird, im zweiten Abschnitt, dargelegt, warum und wie es überhaupt zu dem ausweislichen Mangel an Strategielehre in Deutschland gekommen ist. Sodann werden die Wurzeln der antagonistischen Natur der Strategielehre im dritten Abschnitt dargelegt, ohne deren nicht deterministische Konnotation zu übersehen. Im vierten Abschnitt wird gezeigt, wann die Anwendung von Strategien überhaupt notwendig wird und warum die Konfliktnähe der Strategielehre keineswegs und ausschließlich bedeutet, dass ihr Ansatz erst beim Ausbruch von Gewalt Geltung erhält, sondern Strategieplanung potentielle Konflikte zu antizipieren sucht und deshalb bereits zu Friedenszeiten beginnt. Im nächsten, fünften Abschnitt hebt der Aufsatz einige der klassischen Einsichten Clausewitz’ hervor und zeigt ihre heutige analytische Vitalität auf. Eingebettet in diese heute besonders international stark erforschten Ideen Clausewitz’ wendet sich der Artikel der in Deutschland ebenfalls weitgehend vernachlässigten angelsächsischen Literatur in einem sechsten Abschnitt zu. Dies ist nicht zuletzt notwendig, weil deren Autoren zu wesentlichen Ideengebern bei der systematischen Erfassung moderner Strategielehre geworden sind. Erst aus dieser Synthese klassischer und moderner Literatur zum Thema lässt sich Strategie definieren als langfristige Konfliktplanung und akute konfliktangetriebene Entscheidungsfindung in einem dies wird im siebten Abschnitt präsentiert. Im Anschluss, dem achten Abschnitt, macht die Analyse sechs Vorschläge, wie Deutschland konkret von der hier umrissenen Strategielehre profitieren könnte. Abschließend fasst der Artikel die Ergebnisse zusammen und fordert, dass ein neu zu schaffendes Internationales Strategiekolleg, das Sigmar Gabriels Forderung nach einer strategischeren Außenpolitik aufnimmt, am Wissenschaftszentrum Berlin angesiedelt werden sollte.
1. Land ohne Strategie(lehre)
Zunächst: Warum gibt es in Deutschland einen Mangel dessen, was hier als Strategielehre bezeichnet wird? Aus dem Zweiten Weltkrieg kommend, entschloss sich das nicht souveräne Westdeutschland, seine politische Verfasstheit, Außenpolitik und Sicherheit in Europa und mit Amerika zu verankern. Ostdeutschlands Kommunisten folgten ihrer Ideologie und unterwarfen sich der Sowjetunion. Den Glanz des Wirtschaftswunders konnte Bonn über die Jahre hernach nur erringen, weil seine Gesellschaft – und Exportmöglichkeiten – vom amerikanischen Militär geschützt waren. Die Bundeswehr spielte darin zwar die gewichtige Rolle des zentralen Truppenstellers, aber die Bundesregierungen blieben in den großen Fragen der nuklearen Auseinandersetzung der Supermächte ein, wenn auch meist sehr geschätzter, Befehlsempfänger (Heuser und Stoddart 2017, S. 455).4
Ein ehemaliger deutscher General brachte dies auf den Punkt, als er konzedierte, die Lehre in der Generalstabsausbildung „konzentrierte sich auf die Ebene der Taktik und der Truppenführung. Die Entwicklung der Strategie dagegen war Sache des Bündnisses“ (Heuser 2005, S. 27).5 Bei der NATO, anders als beim Warschauer Pakt, gab es unbestreitbar Möglichkeiten des Austauschs mit den USA; dass aber die Prioritäten der Planung und deren Festlegung durch die harte Hand Amerikas geschahen, daran ließ Washington nie geringsten Zweifel aufkommen. Die USA sahen nach dem Ende des Kalten Krieges infolgedessen keinen Grund, an dieser Handhabung der Allianz etwas zu ändern. Somit war es die Dominanz der USA im Bündnis, die das Entstehen deutschen strategischen Denkens systematisch unterlief und wesentlich zu dem konzeptionellen Vakuum beitrug, das bis heute prägende Wirkung hat. Unter vielen (nicht allen) deutschen Politikern, Generälen und Diplomaten hat dies eine Haltung befördert, die kaustisch so zusammengefasst worden ist: „No strategy, please, we are Germans“ (Mangasarian und Techau 2017, S. 170).
Im intellektuellen Milieu, das qua Denomination dem Gegenstand am nächsten steht, der Internationalen Politik, zeigen sich ähnlich unstrategische Grundzüge. Nach dem Zweiten Weltkrieg entfernte sich das von Max Horkheimer marxistisch ausgerichtete Fach schnell vom antitotalitären Konsens der jungen Bundesrepublik und richtete sich konsequenterweise betont antiamerikanisch aus. Deutschjüdische Emigranten wie Hans Morgenthau, die wesentlich zum Aufbau einer weltweiten realistischen Schule von den USA aus beitrugen, wurden hierzulande nicht rezipiert. Folgenschwer war dann der Einfluss von Jürgen Habermas, der sich als Philosoph in die Politik(wissenschaft) einmischte. Indem er sich mittels seiner Kommunikationstheorien von jeglichen machtorientierten Ansätzen abgrenzen wollte, goss er eine spezifisch deutsche Schlussfolgerung aus dem Zweiten Weltkrieg in seinen generalisierenden Ansatz. Im Kern wollte er Interessenkonflikte jedweder Natur innerhalb eines Staates (ausschließlich westlicher Demokratien, wie er unterschlug) und darüber hinaus international immer kommunikativ auflösen. Dass Konflikte inhärenter Bestandteil des Zusammenlebens sozialer Gruppen waren und Macht dabei jedwede soziale Beziehungen (mit-)bestimmte, auch nach dem Zweiten Weltkrieg, dem verschloss er sich. Genau dies zwang den Doyen der Oxforder Politikwissenschaft, Andrew Hurrell (2011, S. 150), kürzlich festzustellen: „Habermas’s work is inexplicable outside of the social, political and historical consciousness of Germany“.
Trotz des Endes des Kalten Krieges hat das Fach das machtfremde Muster Habermas’ tradiert. Entsprechend einer realistischen Schule hat die sich selbst so bezeichnende professionelle Politikwissenschaft seitdem fast exklusiv die mit Kommunikationstheorien eng verzahnten Kooperationstheorien zur Analyse von Global Governance-Aspekten genutzt. Gleich geblieben sind der axiomatisch strategie- und machtfremde Charakter der Fachdebatten (sowie der Lehre) und die oft als nebensächlich betrachtete Rolle des Nationalstaates in Zeiten der Globalisierung.6 Dass seit Habermas’ Zeiten die gleichsam extreme Spezialisierung des Faches (wie anderswo) unzählige Experten hervorgebracht hat, denen die Synthese größerer internationaler Zusammenhänge im Widerspruch zu ihren häufig engen, professionellen Sichtweisen steht, hat damit eine weitgehende, kosmopolitisch unterzeichnete Außerachtlassung von Fragen bewirkt, die die Grundlagen von Strategie und internationalen Ordnungen betreffen (Terhalle 2015, 2016). Nicht ganz zu Unrecht haben führende US-Vertreter des Fachs deshalb frühzeitig jenen „Flight from Reality“ (Shapiro 2007) beklagt, der hierzulande tiefe Spuren hinterlassen hat. Deutlichster Ausdruck dessen ist bis heute die Absenz von Lehrstühlen, die sich dem ganzheitlichen Studium von Strategie widmen.
Teile der politischen und intellektuellen Eliten stehen damit jenen Bevölkerungsgruppen und Medien nah, die besonders in Konfliktfällen weiterhin pazifistische Zurückhaltung aus dem Zweiten Weltkrieg ableiten. Aber die Niederlage, die Reinhart Koselleck (1988, S. 13–61) den Deutschen just noch ein Jahr vor dem Mauerfall als Reflektionsfolie für die „Historie der Besiegten“ anbot, ist längst in bester deutscher Manier gründlichst aufgearbeitet – und durch die Verankerung im westlichen Bündnis praktisch umgesetzt. Als Tugend missverstandene, teils verinnerlichte Selbstzweifel und auch instrumentalisierter Vergangenheitserhalt sind habituelle Restbestände einer gleichsam provinziellen Moralistik in einem weltweit respektierten Land, die innergesellschaftlich erodieren, weil sie den gärenden Paradigmenwechsel mit Ideenlosigkeit kaschieren, jedoch außenpolitisch ohne Resonanz bleiben.7 Dabei hatte Joachim Gauck noch in einer seiner letzten Reden 2017 auf „das Wichtigste“ hingewiesen, auf das Deutschland sich längst verlassen kann, „eine Haltung“ nämlich, die „durch Vertrauen zu uns selbst, das Vertrauen in die eigenen Kräfte“ geprägt ist (Mangasarian und Techau 2017, S. 163).8
Die Konsequenzen für das strategische Denken in Deutschland sind demgemäß nicht vorteilhaft gewesen: Obwohl die Chefplaner von der Strategiebildung der Weltpolitik praktisch weitestgehend entkoppelt waren und weil das intellektuelle Milieu jegliche Neugierde an Strategie eo ipso negiert hat (und damit auch vorhandene Wissensbestände im westlichen Ausland) haben sich die deutschen Planer genauso pragmatisch wie schlicht bar analytischen Rüstzeugs an ihre Arbeit gemacht. Unweigerlich hat das taktisch sozialisierte, Apparat-interne Nachdenken damit über Jahrzehnte eine antiintellektuelle Position entwickelt, die die Vielfalt und systematische Reflektionsfähigkeit externer Denktraditionen vernachlässigt hat.
Diese Tradition hat im sicherheitspolitischen Milieu die ungute Tendenz vieler politischer Praktiker (nicht aller) verstärkt, schlicht Lösungen für konkrete Probleme zu suchen. Und dies ohne zunächst die ihnen eigenen Herangehensweisen und Weltbilder, selbst angesichts weltpolitischer Umbrüche, auf den Prüfstand zu stellen. Die Unbestimmtheit ihres Pragmatismus ist dabei ja, entgegen eigener Überzeugung, immer von unausgesprochenen Annahmen geprägt, die in die Entscheidungsfindung einfließen.9 Deshalb ist mangelnde, ernsthafte Reflektion über die Parameter dieses stets funktionierenden Pragmatismus ein schwerwiegender Grund, warum Umbrüche der Gegenwart nicht angemessen zu fassen sein mögen. Darüber hinaus hat diese Tradition ein Denken dahingehend vertieft, dass viele Praktiker die Grenze der Kunst des Möglichen dort ziehen, wo das Heute aufhört, weil sie amtierenden Bundesregierungen in strategischen Fragen nicht vorgreifen wollen. Ihr Räsonieren endet mithin dort, wo das innenpolitisch Durchsetzbare angeblich endet und internationales Recht Grenzen setzt. Indem sie damit den Status quo während der Entscheidungsfindung als unabänderlich akzeptieren, übersehen sie gleichwohl das Konflikten innewohnende Potential zur Neuerung und, zuweilen, die Notwendigkeit, dem Status quo mit Chuzpe zu begegnen, um die Zukunft zu gestalten, anstatt auf sie (spät) zu reagieren. Zentral bleibt deshalb die Forderung des ehemaligen Bundespräsidenten Joachim Gauck (2014, S. 78), Deutschland „in schwierigen Zeiten […] vor allem geistige Ressourcen“ anzubieten, die das Land bei seiner Strategiebildung unterstützen. – Mit welchen Grundannahmen untermauert nun eine solche Lehre Strategie?
2. Antagonistische Natur
Die Strategielehre begreift das Politische des internationalen sozialen Lebens als antagonistisch. Die ineinandergreifenden Wurzeln dieses antagonistischen Ansatzes, der keine deterministische Konnotation besitzt, sind systemischer und anthropologischer Natur.10 Das systemische Grundbedürfnis der militärisch stärksten Mächte einer historischen Episode besteht in dem Maß an Sicherheit, das die jeweils spezifische Lebensart und die dafür notwendigen Voraussetzungen erhält (Gilpin 1981; Clark 2005). Die Sättigung dieses fundamentalen Bedürfnisses erfordert deshalb eine historisch seltene, von allen zentralen Akteuren perzipierte Zufriedenheit mit dem Status quo. Unschwer wird dadurch deutlich, dass dem Politischen aus der Sicht des Strategen Konflikte immanent sind, da einige den Status quo als benachteiligend empfinden, während andere ihre privilegierte Position herausgefordert sehen und darauf zielen, diese entweder defensiv zu erhalten oder vorhandene Vorteile weiter auszubauen. Zusammengefasst: Internationale Ordnungen sind für gewöhnlich einige Zeit lang stabil; just weil sie aber keine abstrakten Strukturen sind, sondern von, naturgemäß nie objektiven, Strategen im Sinne einer zu einem bestimmten Zeitpunkt stärksten Gruppe erdacht wurden (traditionell während/nach Kriegen) und in deren Machtverständnis adaptiv konserviert werden, bevorzugen Ordnungen immer einige und gereichen anderen, unterschiedlich stark, zum Nachteil (Buzan 2007, S. 237–46).
Die Interessenlage potentieller strategischer Antagonisten wird weiter kompliziert durch die historisch ungleichzeitige, variierende Zu- und Abnahme materieller Stärke einer zentralen Macht sowie Veränderungen ihrer ideologischen Ausrichtung. Russland und China demonstrieren diese Unzufriedenheit mit dem Status quo heute durch ihren Revisionismus. Der russische Präsident Wladimir Putin will jene geopolitische Tiefe zurückgewinnen, die er mit dem Ende des Kalten Kriegs verloren hat. Weil die Ziele seiner Strategie bisher unerreicht sind, war die Krim-Eroberung auch nicht der letzte Zug. China will seine historische Größe als Vormacht Ostasiens wieder erlangen. Seine maritime Salami-Taktik dient der langsamen Unterminierung des Vertrauens der benachbarten, kleineren Länder in die Sicherheitsgarantien der USA. Donald Trumps Revisionismus zielt darauf, dass die USA ihre von anderen angeblich missbrauchte Machtstellung durch den Rückzug von eben dieser Ordnung wiedergewinnt.
Das systemische Grundbedürfnis eines Teils der Großmächte kann damit politisch nie garantiert, sondern höchstens historisch zeitweise befriedigt sein. Für die anderen gilt, dass sie ihre Grundbedürfnisse durch die der ersten Gruppe als dauerhaft und inakzeptabel eingeschränkt sehen. Ungeachtet diplomatischer Regeln und rechtlicher Streitschlichtung macht diese Logik die Einsetzung einer effektiven Schlichtungsinstanz, die die Sicherheit von Staaten im (erkennbar werdenden) Konfliktfall regeln könnte, unmöglich. Systemische Unsicherheit über zukünftige gegnerische Intentionen in einer parteiisch bevorteilenden Ordnung ist damit der entscheidende Grund, warum das Erkennen der Intentionen von Konfliktgegnern inhärent schwierig ist – und Strategiebildung damit unerlässlich.
Die anthropologische Sicht der Strategielehre komplementiert ihr antagonistisches Fundament. In strategischen Ansätzen sind Spitzenpolitiker die wesentlichen Akteure bei der Ausgestaltung politischer Entwicklungen innerhalb von systemischen Ordnungen. Die menschliche Natur wird dabei einerseits als kooperationsfähig betrachtet, zumal dann, wenn historische Erfahrungsrahmen, gleichviel wie blutig in der Vergangenheit erkämpft, eine Zahl von Völkern politisch, kulturell und wirtschaftlich besonders eng und deshalb friedlich verbinden. Andererseits ist Kooperation über diese Verbindungen hinaus möglich, aber aus der genannten Logik heraus stets anfällig. Gerade weil benachteiligte Großmächte, in unterschiedlichem Maße, ihre Position, ihr Sicherheitsbedürfnis zu verbessern suchen und andere dies umgekehrt aus Furcht vor Machtverlust verschiedentlich konterkarieren und bzw. oder ihre bessere Sicherheitslage unabhängig davon weiter ausbauen wollen, sieht die Strategielehre die menschliche Natur als permanent anfällig für die Versuchungen der Macht an.
Thukydides’ klassisch realistisches Werk Der Peloponnesische Krieg hat der modernen Strategieforschung bereits im fünften Jahrhundert vor Christus die wesentlichen Motive menschlichen Handelns konzeptionell bereitgelegt. Forscher wie Richard Lebow, Bernard Brodie, Colin Gray, Lawrence Freedman, Graham Allison und Praktiker wie US-Verteidigungsminister James Mattis sehen deshalb in „Furcht“, „Ehre“ und „Interesse“ die zentralen Elemente menschlicher Natur, ob einzeln oder kombiniert wirkend (Lebow 2008, S. 45). Diese anthropologischen Ur-Antriebe machen „Fortschritte in der Gesittung“ in einer permanent von Unsicherheit über die Zukunft der Intentionen anderer gekennzeichneten Situation nie unmöglich, können sie aber stets begrenzen, anhalten oder revidieren (Meier 1983, S. 463). Gefühlte und bzw. oder tatsächliche Furcht treibt dabei an gegen den Verlust einer bestimmten Position, wie auch eine gefühlte und bzw. oder tatsächliche Zurücksetzung aufheben zu wollen.
Ehre, moderner vielleicht als Status ausgedrückt, ist das Ansehen in einer sozialen Hierarchie. Status kann, weil er in einer Ordnung respektive befördert oder benachteiligt wird, die Emotion Furcht in einen mächtigen, mitunter irrationalen Handlungsantrieb übersetzen und sie damit in ihrer Wirkung drastisch verschärfen. Da universal geteilt, ist Status ein rekurrierendes, konfliktinduzierendes Motiv, das die Natur von Konflikten besser erfasst als häufig genannte kulturelle Unterschiede zentraler Antagonisten. Interesse ist der egoistische Antrieb, im jeweiligen Konflikt exklusiv das Eigeninteresse zu befördern. Diese Essenz des Thukydides’schen Dreiklangs hat der deutschjüdische Emigrant Hans Morgenthau (1947, S. 158) 2400 Jahre später als den „animus dominandi“ bezeichnet, ob reflektiert im Streit um mehr Macht oder um den befürchteten Verlust von Macht. Kurz: Der antagonistisch ausgefochtene Wille zur Macht ist die zentrale Grundkonstante strategischen Denkens. Das ist im Kern, was Praktiker meinen, wenn sie von einem Vakuum sprechen, das in der internationalen Politik nie längerfristig bestehen bleibt.
3. Ohne Konflikt keine Strategie
Die aus solchem Antagonismus erwachsenden, potentiell gewaltsamen Konflikte des internationalen sozialen Lebens sind gleichzeitig der empirische Ausgangspunkt der Strategielehre (Freedman 2013). Strategien sind deshalb nicht notwendig, wenn Politik – mitunter schwierige – innergesellschaftliche Herausforderungen durch einen weitestgehend funktionierenden Apparat und Prozesse kanalisieren kann. Strategien sind auch nicht notwendig, wenn Außen-, europäische und internationale Politik mittels routinemäßiger und institutionalisierter Arbeits- und Spitzentreffen weiche (Umwelt) oder harte (Abrüstung) Themen bearbeiten. Strategien sind vielmehr dann gefordert, wenn sich politisches Konfliktpotential zunächst unmerklich entwickelt, dann deutlicher werdend anbahnt und sich – trotz Androhung von Gewalt nicht entschärft – entlädt; ungeachtet der Existenz völkerrechtlicher Normen und nicht kodierter Verhaltensregeln. In dieser Sphäre, in der „das nicht organisierte, nicht rationalisierte Leben zur Geltung kommt, [wird] Handeln […] nötig“ (Mannheim 1995, S. 100).
Hier kommt nun der Erkenntnis Clausewitz’, dass das Verfolgen politisch widerstreitender Ziele in jegliche Betrachtung über Krieg einfließt und Krieg deshalb nie als separates Phänomen betrachtet werden sollte, für das Nachdenken über Strategie weitreichende Bedeutung zu. An keiner Stelle sprach er von einer logischen Folge, die den Krieg zur Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln macht; nur mehr fand er hierin schlicht eine Beschreibung, die die nicht friedliche Auflösung politischer Antagonismen zuweilen, aber nicht zwingend, im Krieg sah. Für ihn war die Formulierung von Strategie bereits zu Friedenszeiten deshalb von höchster Bedeutung, weil die politische Genese von Konflikten es just ermöglichte, ihr jeweiliges Anwachsen klug auch mit nicht blutigen Mitteln zu adressieren. Gleichsam zeitlos schlug er deshalb Strategen vor, Konflikten zu begegnen, indem bestehende Allianzen von Gegnern durch geschicktes Säen von Zwietracht möglichst früh unterlaufen oder, im Kriegsfall, Feinde bei der konkreten Allianzbildung gestört werden (Clausewitz 1980, S. 218–219).
Strategien sind mithin in erster Linie für jene Konflikte zu entwerfen, die sich zwischen Großmächten anbahnen, unter der Schwelle zu militärischer Gewalt schwelen (und dort gebannt werden können) oder in tatsächliche Auseinandersetzungen übergehen. In allen drei Varianten muss sich der (potentielle) Konflikt nicht direkt und großflächig zwischen den Großmächten ergeben oder ereignen; (vehementer) Streit über das Verhalten von respektiven Verbündeten, über normativ abgeleitete Handlungen oder (zunächst) begrenzte Inkursionen genügen. Strategielehre trägt nun dazu bei, eine analytisch begründete Kontextualisierung von Einzelereignissen zu ermöglichen. Eine derartige Kontextualisierung kann zu dem Ergebnis führen, dass das Einzelereignis eben genau ein solches ist; sie kann aber auch den Zusammenhang einer größeren, revisionistischen Strategie einer oder mehrerer Großmächte herausstellen.
Strategen, die aufgrund dieser Konfliktnatur der Politik den Erhalt von Machtgrundlagen der westlichen internationalen Ordnung und damit den Erhalt ihrer Lebenswelt als Kern ihrer Arbeit betrachten, sehen sich deshalb in der Pflicht, stets kritisch gegenüber dem Austesten ihrer Willensstärke, versteckten wie expliziten Drohungen, schleichender Unterminierung oder überraschenden Angriffen durch andere zu sein. Lawrence Freedman (2016, S. 387) hat diese nie aufzugebende, klassisch realistische Sensibilität knapp als „the dark side of the strategic imagination“ genannt. Worst Case-Annahmen bilden darin den (militärisch) harten Untergrund einer steten, aber nicht deterministischen Haltung des Misstrauens gegenüber Voraussagen unausweichlichen Fortschritts und der Annahme der Selbstverständlichkeit politischer Freiheit. Gauck mahnte deshalb unlängst und unbewusst strategisch, solche Wachsamkeitspflicht schütze dagegen, dass „andere […] Hand an unsere Lebenswelt, an unsere Freiheit legen“ (zit. n. Mangasarian und Techau 2017, S. 163).11 In diesem expliziten Sinn hat er klar die Frage nach dem Kern des wofür eines deutschen Einstehens durch mehr Verantwortung beantwortet.
4. Klassiker Clausewitz
Ganz im Sinne seines militärischen, historischen Ursprungs bezeichnete Clausewitz Strategie als Duell konfligierender Willen. Während er die herausragende Wichtigkeit der – aufgrund der oben genannten Unsicherheit – extrem schwierigen Analyse gegnerischer und, im Falle kriegerischen Konflikts, feindlicher Intentionen betonte, kann von einem Duell allein heute allerdings keine Rede mehr sein. Nicht nur die öffentliche Meinung der involvierten Antagonisten, die Kohäsion ihrer Bündnisse und die jeweilige innenpolitische Konsensschaffung spielen wesentliche Rollen. Auch verfolgen Entscheidungsträger selbst in Krisen multiple Ziele, die das übergeordnete Ziel möglicherweise, wenn auch unbewusst, unterlaufen. Clausewitz machte allerdings früh deutlich, dass der kontinuierliche Erhalt wirtschaftlicher Stärke Aufgabe des Staates zu Friedenszeiten und dies wesentlich bei der Strategiebildung war. In Friedenszeiten war Strategie für ihn somit integraler Bestandteil staatlicher Planung, da Konflikte aufgrund der steten Unzufriedenheit einiger mit dem Status quo permanent gedacht werden mussten (Heuser 2010, S. 488–489).
Die heute von der Strategieforschung am meisten anerkannte Leistung Clausewitz’ besteht nun darin, nicht lineare und reziproke Wirkungsdynamiken von und in Konfliktsituationen erkannt zu haben.12 Er hinterfragte einfache Ziel-Wirkung-Annahmen, die sich auf seinerzeitige (und teils noch heute anzutreffende) rationalistische Kalkulationen der vorhandenen Mittel in Bezug zur Erreichung eines Ziels beriefen. Er begriff so die reziproke Dynamik von diplomatischen und militärischen Konfliktentwicklungen, von Zufällen und deren beider begrenzte Steuerungsmöglichkeit durch eine genaue politische Zielbestimmung. Friktionen werden vielmehr qua natura von dieser wunderlichen Trinität generiert und erschweren in erheblichem Maße die kognitive Greifbarkeit und analytische Beantwortung ihrer diffusen und komplexen Dynamik untereinander.
Clausewitz war sich somit unweigerlich des Problems strategischer Unvorhersehbarkeit in Konflikten bewusst, verneinte aber stringent – obschon heute von Chaos-Theoretikern übersehen –, dass dies zu einer Tabula rasa führen müsste. Im Gegenteil: Er insistierte, dass (Donald Rumsfelds) unkown unknowns immer nur ein Teil der Planung war. Selbst im sich anbahnenden oder realen Konfliktfall gab es militärische Mechanismen (Blockaden) und bzw. oder diplomatische Vorgehensweisen (Sanktionen, Allianzbildung), die ihre Ziele bewirken konnten. Überdies waren Gegner (und Feinde) gleichermaßen jenen Friktionen ausgesetzt, die der Trinität von Konfliktdynamiken entsprangen. Er sah Erschütterungen der Zielplanung mithin als gegeben an und inkorporierte Planungen für Eventualitäten in sein Denken. Trotz dieser inhärenten Ungewissheit, so wies er Anführer an, waren übergeordnete Ziele mit Beharrlichkeit nicht aus den Augen zu verlieren, indem Beschränkungen des Handelns jeweils durch adaptives Verhalten aufzulösen waren. Helmuth Karl Bernhard von Moltke sollte dies 80 Jahre später so fassen: „Die Strategie ist die Fortbildung des ursprünglich leitenden Gedankens entsprechend den stets sich ändernden Verhältnissen“ (zit. n. Herberg-Rothe 2017, S. 180). Überdies sollte sich jeder kluge Planer solches Herangehen mit einem möglichst akkuraten Überblick über die Intentionen und die Natur des Konfliktgegners erleichtern, ohne dabei der defensiv gefärbten Rhetorik des Gegenübers zu glauben (Freedman 2013, S. 86–92; Herberg-Rothe 2017, S. 149–183).13
5. Internationale Strategielehre heute
Die moderne Lehre von der Strategie baut auf den klassischen Einsichten Clausewitz’ auf. Sie beschäftigt sich mit der systematischen Analyse menschlicher Entscheidungsfindung in oft, aber nicht vollständig, unwägbaren internationalen Kontexten. Sie erkennt darüber hinaus die inhärente Schwierigkeit des Strategen, im Jetzt dieser Unsicherheit des Heute über das (teilweise noch) unklare Morgen Entscheidungen treffen zu müssen. Der Historiker Hermann Oncken (1935, S. 365–366) hat das ebenso gerne zitierte wie verkürzt verstandene Wort Bismarcks über Politik als die „Kunst des Möglichen“ richtig gefasst: Der Stratege müsse nicht nur „die Realitäten, die ihn umgeben“, mittels eines „sachlichen Wirklichkeitssinns“ verstehen, vielmehr müsse er „die noch schwerer erlernbare Fähigkeit, […] das noch nicht Wirkliche rechtzeitig zu erkennen“ durch einen „Instinkt für die unsichtbaren und unwägbaren Dinge“ erfassen. Nur so könne er „auf der Brücke zwischen dem Gegenwärtigen und dem Zukünftigen“ bestehen. Damit wird deutlich, dass der Stratege zwar die Realitäten der Gegenwart berücksichtigen müsse, aber darüber hinaus und trotz unausweichlicher Imponderabilien, immer in größeren Kontexten über diese hinausdenken und eine Vision davon haben, wie er die strategische Sicherheit eines Landes in die Zukunft hinein sichern will. Das Verdikt Helmut Schmidts gegen Visionen zerfällt somit im Strategischen. Der französische Präsident Emmanuel Macron hat dies kürzlich richtig betont (Kegel 2017).14
Die Forschung ist sich angesichts multikomplexer Kontexte dabei der Spannungen zwischen kurz- und langfristig angelegter Planung mit Blick auf die kognitiven Anforderungen an Strategen bewusst.15 Wesentliche Autoren wie Lawrence Freedman und Beatrice Heuser argumentieren heute, dass Strategen ihre Entscheidungen für die eine, aber gegen andere Optionen auf einer dualen Logik aufbauen. Entgegen der Annahmen von Rational Choice-Theorien, die die Fähigkeit zur kontextuellen Verarbeitung sämtlicher situationsbezogener Informationen mit der Geschwindigkeit eines Hochleistungsrechners voraussetzen, aber Reziprozitäten, Friktionen und individuelle Weltbilder vernachlässigen, zeigen sie mittels kognitionspsychologischer Erkenntnisse, dass zwei Logiksysteme in einem akuten Konfliktfall miteinander rivalisieren und sich im günstigen Fall, aber keineswegs zwingend, komplementieren.
Das erste System sind tief verinnerlichte Stereotypen und Weltbilder, die intuitiv und selektiv die Komplexität der jeweiligen Konfliktsituation kognitiv herunterbrechen und dadurch greifbar machen. Das zweite System kann als Korrektiv des ersten fungieren, indem es die Angemessenheit des Stereotyps für den neuen Kontext mittels langfristigen Sachverstands überprüft. Die Intervention des zweiten Systems mag dabei das rationale Element in der Strategieauswahl betonen, dominiert das erste System aber nicht verlässlich. Im günstigen Fall, dass es sich durchsetzt, kann es ein visionäres Narrativ aus der Gegenwart für die Zukunft generieren, das sich der Realitäten der Gegenwart im Sinne Onckens bewusst ist und die jeweilige Gefolgschaft überzeugt. Falls dies nicht gelingt, kann die intuitive Anwendung des hergebrachten Stereotyps trotzdem treffsicher sein oder aufgrund veränderter internationaler Kontexte zum potentiell desaströsen Analogiefehlschluss führen (Freedman 2013, S. 600–606, 612–615).16 Nie auszuschließende Zufälle, Friktionen, in einem Wort „system effects“, komplizieren die Erfolgswahrscheinlichkeit zudem (Jervis 1997).
Dies lässt den Schluss zu, dass es den mit hyperkomplexer Kontextualisierungsfähigkeit ausgestatteten Meisterstrategen nicht geben kann.17 Vielmehr weist sich der erfolgreiche Stratege durch die Kombination rationaler Intelligenz, intuitiver Perzeption und der Fähigkeit aus, Regierungsapparat, Bevölkerung und Verbündete von seiner realitätsnahen Vision zu überzeugen. Dies kann, wenn überhaupt, nicht einem Militär, sondern nur einem Spitzenpolitiker gelingen, der erhebliche Überzeugungsfähigkeiten mitbringt.18 Langfristig angelegte Wissensbestände und situative Kenntnis über das große Ganze, in dem die jeweilige Strategie entwickelt wird, können dabei durch klare Prioritätensetzung nutzbar gemacht werden und fundamentale Vorteile schaffen. In der Praxis aber, zuweilen als „Fahrt auf Sicht“ (FAZ 2015) bezeichnet, verliert solche mitunter politisch unerwünschte strategische Kontextualisierung, zu häufig, ihre vitale Rolle. Oder sie scheitert schlicht an der Entscheidung des Strategen, seine Energie auf kognitiv greifbare, unmittelbare Konfliktsituationen zu verwenden, anstatt sein Handeln durch jene größeren Kontexte zu konturieren, die durch die Annahmen der antagonistischen Natur von Politik nahegelegt werden. John Gray (2016, S. 115) hat dies so gefasst: „The great stream of time is a potent concept, but it lacks executive authority“.
6. Definition Strategie
Nur aus dem Vorgesagten wird nun deutlich, warum dieser Aufsatz eine Definition von Strategie erst an diesem letzten Punkt, durch den die prinzipielle Zweiteilung von Strategie deutlich wird, liefern kann und will. Denn: Es ist ein weitverbreiteter Irrtum der Wissenschaft, Strategie vornehmlich, wenn nicht ausschließlich, durch das Element der langfristigen Planung zu charakterisieren. Natürlich kann dies durch Clausewitz’ Insistieren auf die Wichtigkeit des Planungsprozesses bereits zu Friedenszeiten gerechtfertigt werden; und auch dadurch, dass Regierungsapparate über Jahre und Jahrzehnte ein Maß an Erfahrung und Wissen ansammeln, das im Entscheidungsfall eines Konflikts, falls entsprechend präpariert, organisatorisch eine zentrale Rolle bei der Sondierung von Optionen spielen kann. Diese Funktion hat grundsätzlich auch die Strategielehre, wenn sie in der Lage ist, in der Konfliktphase analytische Denkräume parat zu halten, die Entscheidungen beeinflussen können. Gleichwohl, und dies ist das wahrscheinlich größte Defizit der Wissenschaft, die qua natura langfristig angelegt ist, ist dieses auf Langfristigkeit zielende Element inhärent durch die Strategiebildung begrenzt, sofern sie vom Entscheider her gedacht wird. Dieses oben sogenannte System 1 gerade nicht als das dem System 2 faktisch überlegene System zu verstehen, das per Intuition (und zuweilen unter Zeitdruck) versucht, komplexe Sachverhalte zu verstehen und Entscheidungen fällen und dafür Verantwortung übernehmen muss, ist die Achillesferse jener Forschung, die Strategie nur durch die Linse Langfristigkeit betrachtet. Wenn es zum Schwur kommt und Komplexität wie im Brennglas kognitiv heruntergebrochen werden muss, dann zeigt sich die Einseitigkeit des noch immer vorwaltenden Verständnisses von Strategie als langfristige Konfliktplanung. Ohne Kenntnis des Weltbilds der wichtigsten Entscheider bleibt das Verständnis von und für Strategie in stärkstem Masse eingeschränkt. Solche Weltbilder spiegeln die Verarbeitung zentraler Lebenserfahrungen und wertebezogene Wesenszüge einer Person wider, die in kritischen Situationen das Entscheidungsverhalten dominieren. Der biographische Zweig der Strategie-Forschung (mindmaps) hat dies griffbereit aufgearbeitet.
Daraus ergibt sich folgende Definition von Strategie, die der Lehre von Strategie in Zukunft zugrundeliegen sollte: Strategie ist langfristige Konfliktplanung und akute konfliktangetriebene Entscheidungsfindung in einem. Langfristige Konfliktplanung kann Konflikt verhindern. Exekutive Entscheidungsfindung kann aber aufgrund ihrer stärker kurzfristigen Natur zu Friedenszeiten die Unmittelbarkeit langfristiger Planung bestreiten und zurückweisen. Im tatsächlichen Konfliktfall obliegt es Strategen, Situationen intuitiv, planerisch oder mittels einer Kombination beider Elemente entgegenzutreten. Nicht lineare Adaptionsfähigkeit entscheidet im Verlauf eines Konflikts darüber, ob die eigene Sicherheit vollständig erhalten werden kann. Strategien verstehen sich als existentiell ausgerichtet, weil sie sich gegen Herausforderungen an die eigene Existenz stellen.
7. Strategielehre und Deutschlands Strategiebildung
Nach Clausewitz ist die (noch zu etablierende) Strategielehre dazu geeignet, „manchen Faltenkniff in den Köpfen der Strategen und Staatsmänner auszubügeln“ (zit. n. Heuser 2005, S. 14). Für die Lehre von der Strategie ergeben sich aus dem Gesagten mindestens sechs Möglichkeiten, die Formierung deutscher Strategiebildung analytisch zu unterstützen.
Für die Nicht-Großmacht Deutschland bringt das antagonistische Prinzip erstens Klarheit bei der strategischen Prioritätensuche. Aus diesem Prinzip folgt, dass die Fundamente freiheitlichen Lebens konsequenterweise jene Inhalte sind, für deren Verteidigung Berlin ultimativ Macht einzusetzen bereit sein muss. Praktisch gewendet: Wenn die NATO, also auch Deutschland, nicht das Bündnis, also die Fundamente der politischen Freiheit und Lebenswelt schützen kann, dann muss Deutschland dies zur exklusiven Priorität des Bündnisses machen – und die Notwendigkeit nicht existentieller Einsätze wie Mali oder Afghanistan kritisch überdenken. Aus ihrer klassisch realistischen Grundierung heraus kann Strategielehre die für solche nicht vitalen Konflikte häufig angenommene Interessenharmonie zwischen der Interventionsmacht und den zu Befreienden hervorheben, die durch Reform verschiedener Politiksektoren und -strukturen umgesetzt werden soll. Dabei werden fundamentale Probleme der politischen Neukonstituierung ausgeblendet, ob nun die neuen Regierungen Patronage-Netzwerke etablieren, um ihre politische Klientel zu befriedigen, oder ob hohe Summen von Aufbaugeldern Korruption befördern, die sich negativ für die Interventionsmacht auswirken (Porter 2016, S. 248–249).
Die letztliche Prioritätensetzung wird zweitens wesentlich dadurch erleichtert, dass sich die Strategielehre, gerade weil sie den von Thukydides geprägten, langfristig angelegten Blick für formativ hält, an seiner Trias orientieren kann. Durch die sensible Beobachtung geringerer Konflikte gelingt so die größere Kontextualisierung eines Großmachtantagonismus in einer internationalen Ordnung durch die Kategorien Status quo- und revisionistische Mächte. Drittens kann die Strategielehre die Grundannahmen, die die Weltbilder und kognitive Intuition von deutschen und führenden nicht europäischen Entscheidungsträgern prägen, systematisch aufbereiten und damit potentiell fehlerhafte Analogieschlüsse im Vorfeld sich abzeichnender Konfliktkontexte frühzeitig aufzeigen. Dies schafft u.U. (Denk-)Raum für offiziell politisch nicht gewollte und zunächst undenkbare Entscheidungsoptionen. Strategie hat wesentlich mit Entscheidungsfindung zu tun; so betont Freedman (2013, S. xiv): „reasoning behind them […] worthy of careful examination“.
Die Lehre von der Strategie schärft viertens das Verständnis für die Nichtlinearität politischer Entwicklungen (Jervis 2017, S. 234–260). Damit macht sie einerseits deutlich, dass sich aus einer bestimmten Strategie nicht zwingend eine Dynamik entwickelt, die das gewünschte Ziel, sofern erreicht, selbständig untermauert. Der Automatismus, der dieser Domino-Theorie zugrunde liegt, ist meist strategisches Wunschdenken (z.B. Irakkrieg 2003). Andererseits kann solches Denken auch dazu führen, dass politisch nicht gewollte Strategievorschläge mit Domino-Effekten in Verbindung gebracht werden, deren logische Konsequenz keineswegs ausgemacht ist (etwa die nukleare Bewaffnung Deutschlands als Proliferationsgrund für andere). Fünftens kann sie zeigen, wie trügerisch der szientistische Verlass auf die richtige Analyse von big data in strategischen Angelegenheiten ist (Tetlock und Gardener 2015). Die geglaubte Vorhersehbarkeit scheitert sowohl an der Nichtlinearität politischer Entwicklungen als auch an der intuitiven, durch Weltbilder und Analogien geformten Komplexitätsreduktion seitens der Entscheidungsträger. Sie scheitert ebenso an der Generierung von Friktionen im Konfliktverlauf, die nur adaptiv im Sinne des übergeordneten Ziels adressiert, aber nicht im Vorfeld geplant werden können. Strategielehre kann, sechstens, analytisch die politischen Widersprüche zwischen Großmächten wie China und Russland herausarbeiten und sollte sich dann nicht scheuen, Strategen Optionen für die praktische Manipulation dieser Gegensätze anzubieten, um zur Schwächung solcher Allianzen beizutragen.
8. Zusammenfassung
Die vorgelegte Analyse zielte darauf, den eklatanten Mangel an Strategielehre in Deutschland nachzuvollziehen. Und darauf, diesem folgenreichen Desideratum erstmalig durch einen Überblick über zentrale Aspekte des Gegenstands zu begegnen. Es wurde deshalb zunächst gezeigt, warum dieser Mangel in Deutschland grundsätzlich besteht. Sodann wurde darauf verwiesen, dass systemische und anthropologische Elemente wesentlich das antagonistische Bild der Strategielehre von Politik formen. Dem schloss sich die Darlegung an, weshalb Strategielehre Konflikte als Ausgangspunkt ihrer Beobachtungen nimmt und warum gleichzeitig die politische Natur von Konflikten häufig bereits vor dem Ausbruch von Gewalt erkenn- und adressierbar ist. Die klassischen, bis heute gültigen Einsichten Clausewitz’ wurden danach herangezogen, um die prinzipielle Notwendigkeit des Verständnisses für nicht lineare, ungleichzeitige und reziproke Wirkungsdynamiken in der Entwicklung von Konflikten zu veranschaulichen. Die moderne, im Wesentlichen im angelsächsischen Raum geformte Strategieforschung baut auf den vorgenannten Fundamenten auf und hat sich seit geraumer Zeit der systematischen Analyse strategischer Entscheidungsfindung zugewendet. Dieser Abschnitt der Analyse zeigte die kognitionspsychologisch hergeleiteten Entscheidungshilfen, die zentral bei der jeweils zu treffenden Auswahl von Entscheidungsoptionen sind. Daraus erschloss sich die erste, die neueste Forschung und praktische Aspekte des Themas kombinierende Definition des Begriffs Strategie. Der Überblick zum Thema Strategielehre eröffnete abschließend sechs Perspektiven, wie der (außer-)universitär zu etablierende Forschungsgegenstand die Praxis bundesdeutscher Strategiebildung unterstützen kann.
Eine wichtige Frage, die offengeblieben ist, lautet nun: Wie kann diese Unterstützung staatlicher Strategiebildung durch das Fach Strategielehre praktisch umgesetzt werden? Joachim Gauck (2014) hat hierzu einen ersten Vorschlag mit seiner Forderung nach geistigen Ressourcen gemacht, in den er auch die Neuschaffung von „Institutionen [und] Foren“ einschloss. Neben der Herausbildung von Lehrstühlen für Strategie sollte deshalb heute ein – aus den oben beschriebenen Gründen heraus – zwingend unabhängiges Internationales Strategie-Kolleg gegründet werden. Dieses könnte seiner für die Strategieforschung und -bildung in Deutschland zentralen Rolle am von allen Parteien mitgetragenen, exzellent ausgestatteten Wissenschaftszentrum Berlin (WZB) nachgehen.
Literatur
Buzan, B. (2007). People, states & fear. Colchester: ECPR.
Casey, S., & Wright, J. (2008). Mental maps in the era of the two world wars. Basingstoke: Palgrave Macmillan.
Clark, I. (2005). Legitimacy in international society. Oxford: Oxford University Press.
Clausewitz, C. (1980). Vom Kriege. Bonn: Dümmler.
Coker, C. (2014). Can war be eliminated? Cambridge: Polity Press.
FAS exklusiv – Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung exklusiv. (2017, 21. Okt.). Schäuble. Finanzminister muss kein Fachmann sein. Frankfurter Allgemeine Zeitung. http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/f-a-s-exklusiv-schaeuble-finanzminister-muss-kein-fachmann-sein–15257271.html. Zugegriffen: 7. Dez. 2017.
FAZ – Frankfurter Allgemeine Zeitung. (2015). Merkel über Athen-Krise: „Man muss auf Sicht fahren“. http://www.faz.net/agenturmeldungen/dpa/merkel-ueber-athen-krise-man-muss-auf-sicht-fahren–13677480.html. Zugegriffen: 12. Dez. 2017.
FAZ. (2017, 20. Okt.). Geheimer Nato-Bericht. Allianz nicht verteidigungsfähig? http://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/geheimer-nato-bericht-allianz-nicht-verteidigungsfaehig–15255420.html. Zugegriffen: 7. Dez. 2017.
Freedman, L. (2017). The future of war: A history. New York: Penguin Books.
Freedman, L. (2016). Does Strategic Studies have a future? In J. Baylis, J. Wirtz, & C. Gray (Hrsg.), Strategy in the contemporary world (S. 374–390). Oxford: Oxford University Press.
Freedman, L. (2013). Strategy: A history. Oxford: Oxford University Press.
Gabriel, S. (2017, 5. Dez.). Warum Europa eine neue Außenpolitik braucht – Rede von Außenminister Gabriel beim Forum Außenpolitik. https://www.auswaertiges-amt.de/de/newsroom/berliner-forum-aussenpolitik/746464. Zugegriffen 6. Dez. 2017.
Gauck, J. (2014, 31. Jan.). Deutschlands Rolle in der Welt: Anmerkungen zu Verantwortung, Normen und Bündnissen. Rede bei der Münchner Sicherheitskonferenz. http://www.bundespraesident.de/SharedDocs/Reden/DE/Joachim-Gauck/Reden/2014/01/140131-Muenchner-Sicherheitskonferenz.html. Zugegriffen: 7. Dez. 2017.
Gilpin, R. (1981). War and peace. Princeton: Princeton University Press.
Gray, J. (1999). Modern strategy. Oxford: Oxford University Press.
Gray, J. (2016). The future of strategy. Cambridge: Polity.
Hafner-Burton, E., Haggard, S., Lake, D., Victor, D. (2017). The behavioral revolution and International Relations. International Organization, (71), 131.
Herberg-Rothe, A. (2017). Der Krieg: Geschichte und Gegenwart. Eine Einführung. Frankfurt am Main: Campus.
Heuser, B. (2005). Clausewitz lesen! München: Oldenbourg.
Heuser, B. (2010). The evolution of strategy. Cambridge: Cambridge University Press.
Hillgruber, A. (1965). Hitlers Strategie. Politik und Kriegführung 1940/41. Bad Neuenahr: Bernard & Graefe.
Howard, M. (2008). War and the liberal conscience. New York: Columbia University Press.
Hurrell, A. (2011). The theory and practice of global governance. International Studies Review, (13), 144–151.
Jervis, R. (1997). System effects. Princeton: Princeton University Press.
Jervis, R. (2017). How statesmen think. The psychology of International Relations. Princeton: Princeton University Press.
Kegel, S. (2017, 10. Okt.). Macron an der Frankfurter Uni: „Ich will keinen Arzt, ich will Visionen!“ Frankfurter Allgemeine Zeitung. http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/debatten/praesident-macron-spricht-an-der-frankfurter-universitaet–15240237.html#void. Zugegriffen: 7. Dez. 2017.
Keynes, J. M. (1936/2013). The general theory of employment, interest, and money. Cambridge: Cambridge University Press.
Khong, F. (1992). Analogies at war: Korea, Munich, Dien Bien Phu, and the Vietnam decisions of 1965. Princeton: Princeton University Press.
Klein, B. (1994). Strategic studies and world order. Cambridge: Cambridge University Press.
Klüfers, P., Masala, C., Tepel, T., & Tsetsos, K. (2017). Strategic foresight – Die Zukunft antizipieren. SIRIUS, (1), 53–67.
Koselleck, R. (1988). Erfahrungswandel und Methodenwechsel. Eine historisch-anthropologische Skizze. In C. Meier, & J. Rüsen. (Hrsg.), Historische Methode (S. 13–61). München: dtv.
Kratochwil, F. (2008). Constructivism: What it is (not) and how it matters. In D. della Porta, & M. Keating (Hrsg.), Approaches and methodologies in the social sciences: A pluralist perspective (S. 80–98). Cambridge: Cambridge University Press.
Laderman, C., & Simms, B. (2017). Donald Trump: The making of a world view. London: I.B. Tauris.
Lebow, R. (2003). The tragic vision of politics: Ethics, interests and orders. Cambridge: Cambridge University Press.
Mangasarian, L., & Techau, J. (2017). Führungsmacht Deutschland: Strategie ohne Angst und Anmaßung. München: dtv.
Mannheim, K. (1995). Ideologie und Utopie. Frankfurt am Main: Klostermann.
Meier, C. (1983). Die Entstehung des Politischen bei den Griechen. Frankfurt: Suhrkamp.
Morgenthau, H. (1947). Scientific man versus power politics. Chicago: Phoenix Books.
Morgenthau, H. (1993). Politics among nations: The struggle for power and peace. Boston: McGraw.
Münkler, H. (2003). Clausewitz’ Theorie des Krieges. Baden-Baden: Nomos.
Neitzel, S., & Hohrath, D. (2007). Kriegsgreuel: Die Entgrenzung der Gewalt in kriegerischen Konflikten vom Mittelalter bis ins 20. Jahrhundert. Paderborn: Schöningh.
Neitzel, S., & Welzer, H. (2012). Soldaten: Protokolle vom Kämpfen, Töten und Sterben. Frankfurt am Main: Fischer.
Neustadt, R., & May, E. (1986). Thinking in time. The uses of history for decision makers. New York: Free Press.
Oncken, H. (1935). Nation und Geschichte. Berlin: Grotesche Verlagsbuchhandlung.
Pomfret, J. (2016, 14. Dez.). 45 years ago, Kissinger envisioned a ‘pivot’ to Russia. Will Trump make it happen? The Washington Post https://www.washingtonpost.com/news/global-opinions/wp/2016/12/14/45-years-ago-kissinger-envisioned-a-pivot-to-russia-will-trump-make-it-happen/?utm_term=.af9fc3fa59c9. Zugegriffen: 7. Dez. 2017.
Porter, P. (2016). Taking uncertainty seriously: Classical realism and national security. European Journal of International Security, (1), 239–260.
Roloff, H., & Tiede, P. (2016, 26. Dez.). Kissinger soll neuen Kalten Krieg verhindern. Bild. http://www.bild.de/politik/ausland/donald-trump/kissinger-will-zwischen-russland-und-usa-vermitteln–49482764.bild.html#fromWall. Zugegriffen: 7. Dez. 2017.
Shapiro, I. (2007). The flight from reality in the human sciences. Princeton: Princeton University Press.
Terhalle, M. (2016). IB-Professionalität als Praxisferne? Ein Plädoyer für Wandel. Zeitschrift für Außen- und Sicherheitspolitik, 9(1), 121–138.
Terhalle, M. (2015). Warum das Governance-Axiom gescheitert ist – eine notwendige Kritik. Zeitschrift für Politik, 3 (62), 263–287.
Tetlock, P. (2005). Expert political judgment. How good is it? How can we know? Princeton: Princeton University Press.
Taliaferro, J., Ripsman, N., & Lobell, S. (2013). The challenge of grand strategy. The great powers and the broken balance between the world wars. Cambridge: Cambridge University Press.
Tetlock, P., & Gardner, D. (2015). Superforecasting: The art and science of prediction. New York: Random House.
Trubowitz, P. (2011). Politics and strategy. Partisan ambition and American statecraft. Princeton: Princeton University Press.
United Nations General Assembly. (2017). Statement by H. E. Mr. Donald Trump. https://gadebate.un.org/sites/default/files/gastatements/72/us_en.pdf. Zugegriffen: 7. Dez. 2017.
Vad, E. (2017). Angela Merkel und das Dilemma deutscher Sicherheitspolitik – Eingeklemmt zwischen Pazifismus und maroder Bundeswehr. In P. Plickert (Hrsg.), Merkel: Eine kritische Bilanz (S. 237–248). München: FinanzBuch Verlag.
1 Im vorliegenden Artikel wird, abweichend vom ZfAS-Standard, bei personenbezogenen Substantiven die männliche grammatikalische Form verwendet. Der Autor schließt damit Personen weiblichen wie männlichen Geschlechts gleichermaßen ein.
2 Zur Kritik am Fach Strategielehre, siehe John Baylis et al. (2017, S. 812, 319–336) und speziell mit Blick auf Fragen der internationalen Ordnung, siehe Bradley S. Klein (1994, S. 138). Strategielehre versteht sich nicht als Kriegs- bzw. Militärwissenschaft. Der rein militärische Fokus der letzteren widerspricht der von Carl von Clausewitz erarbeiteten Zentralität von Politik für Strategiebildung, wie sie sich seit dem Ersten Weltkrieg in der Wissenschaft durchgesetzt hat. Genauso wenig entspricht Strategielehre den angelsächsischen Security Studies. Diese tangieren zwar mit Blick auf das Problem des Sicherheitsdilemmas die Strategielehre, lassen aber aufgrund ihrer kontinuierlich breiter definierten Kaprizierung auf Subkontexte wie Wasser, Umwelt oder Cyber sowie auf eine kulturell globale und genderspezifizierte Reflektion von Theorien zu Sicherheit den Kern von Strategie außen vor.
3 Ontologische und epistemologische Fragen werden in einem späteren Aufsatz vertieft werden; hier mag der Hinweis genügen, dass die klassisch realistisch inspirierte neuere Forschung zum Thema Strategie der Ontologie von Friedrich Kratochwil folgt (2008, S. 80–98).
4 Die Autoren können allerdings zeigen, dass Deutschland seit Mitte der 1960er Jahre mindestens implizit, durch geschicktes Zunutzemachen politischer Gemeinsamkeiten mit den Briten, die Nuklearstrategie der NATO zu beeinflussen suchte (Heuser und Stoddart 2017, S. 471).
5 Es handelte sich hier um General Heinz von Gathen.
6 Vereinzelt finden sich im Fach Geschichte Stimmen, die den Komplex Krieg (Neitzel 2007, 2012) bearbeitet haben; auch Theoretiker der Politik (Münkler 2003; Herberg-Rothe 2017) haben dazu beigetragen. Ihr wertvoller Beitrag bezieht sich auf die Analyse des Kriegsgeschehens in seinen mannigfaltigen Formen, nicht aber auf Strategiebildung vor Konfliktausbruch und nicht auf die spezifische Untersuchung von Strategien als angewandte Konzepte in Konfliktfällen. Interessanterweise nutzte jedoch der politische Historiker Andreas Hillgruber (1965, S. 23) bereits vor über 50 Jahren das Konzept Grand Strategy für seine Arbeit über Hitlers Strategie – allerdings nicht systematisch. Im Vergleich dazu ist die englischsprachige Literatur zum Thema Strategie um viele Weiten fortgeschrittener und reichhaltiger. Siehe zum Beispiel Peter Trubowitz (2011), Jeffrey W. Taliaferro et al. (2012) oder die Vielzahl an Studien vor/nach 9/11, dem Irakkrieg und angesichts der chinesischen und russischen Herausforderungen.
7 Eine kritischere Sicht, geäußert von einem langjährigen, engen sicherheitspolitischen Mitarbeiter der Bundeskanzlerin, bestreitet, dass „[…] ohne erheblichen Druck äußerer Umstände […]“ in Zukunft eine „[…] Bereitschaft zu einer Revision der deutschen Sicherheitspolitik […]“ zu erwarten ist (Vad 2017, S. 248). Worin dieser erhebliche Druck explizit bestehen würde, sagt Erich Vad jedoch nicht. Denkbar sind gewiss mehrere Formen. Wichtig ist aber der Hinweis darauf, dass Druck von außen, ob nun in seiner extremen Form (Krieg) oder in weniger starker Form (außenpolitischer Anstoß), eine Variante sein können, wie Deutschland sein Verhältnis zu Machtfragen an internationale Realitäten (und an sein von außen neu bewertetes Gewicht) überdenkt. Anstöße können hierzu unter anderem von europäischen Nachbarn (Frankreich, Polen) kommen. Ob dies, wie Vad suggeriert, zwingend innergesellschaftliche Veränderungsprozesse ausschließt, ist nicht gesagt. Möglicherweise haben diese Prozesse unbemerkt längst eingesetzt. Denn: Nicht mehr auszuschließende strategische Krisen (Russland/NATO, Nordkorea, US-Rückzug) könnten das gesellschaftspolitische Bewusstsein für die Grundlagen unserer Freiheit und unseres Wohlstands erheblich verändern. Bundespolitiker, zuletzt Norbert Röttgen bei einer Veranstaltung am 20.11.2017 in Berlin, weisen auf den simplen Punkt hin, dass viele Bürger, im Vergleich zu noch vor fünf bis zehn Jahren, deutlich tiefersitzende Ängste äußern, wenn sie Fragen zur internationalen Politik beantwortet wissen wollen.
8 Für den weiteren Zusammenhang, siehe Michael Howards (2008) Ausführungen.
9 John Maynard Keynes (2013, S. 383–384) hat dies klassisch für den Einfluss von Wirtschaftstheorien formuliert: „Practical men, who believe themselves to be quite exempt from any intellectual influences, are usually the slaves of some defunct economist.“
10 Eine konzise Zusammenfassung des Widerspruchs zwischen Steven Pinker und Lawrence Freedman findet sich in Freedman (2017, S. 289) und bei Christopher Coker (2014).
11 Die USA hatten – in wohl kalkulierender und damit begrenzender Form – bereits seit den 1970er Jahren höhere Verteidigungsausgaben seitens Bonns gefordert. Gaucks Interpretation hat nun deutlich gemacht, was die strategische Essenz solcher Verteidigungspolitik sein sollte. Über die Frage, wie welche Prioritäten entsprechend zu wählen waren, sprach er allerdings nicht.
12 Dies allein sollte zu denken geben, wenn man sich vergegenwärtigt, dass kein deutscher Kanzler, inklusive Otto von Bismarcks, Clausewitz je in die Hand genommen hat.
13 Hillgruber (1965, S. 20) arbeitet diese Dynamiken gut heraus: „[Hitlers] Entscheidungen entsprachen nur zum Teil unmittelbar seinen großen politischen Intentionen; viele auch wesentliche Entscheidungen waren vielmehr mit Reaktionen auf Schritte der Gegenspieler verknüpft oder resultierten – meistens erzwungenermaßen – aus sachlichen Notwendigkeiten“.
14 Freedman (2017, S. xviii–xix) hat Onckens präzise Beobachtung zur Verbindung von Gegenwart und Zukunft folgendermassen bestätigt: „The reason that the future is difficult to predict is that it depends on choices that have yet to be made […] in circumstances that remain uncertain. We ask questions about the future to inform choices, not to succumb to fatalism. […] reminder that history is made by people who do not know what is going to happen next. Many developments that were awaited, either fearfully or eagerly, never happened. Those things that did happen were sometimes seen to be inevitable in retrospect but they were rarely identified as inevitable in prospect.“
15 Die jüngste Forschung zur Methodik der Strategischen Vorausschau vernachlässigt drei Dinge: Indem sie exklusiv auf „längerfristige Vorhersagen“ für die „nächsten zehn Jahre“ fokussiert, übersieht sie das inhärente Spannungsverhältnis zwischen langfristiger Strategieplanung und kurzfristiger Strategieumsetzung (Klüfers et al. 2017, S. 53). Indem sie Voraussagen durch einen „bestimmten Fokus auf einen Teilaspekt [der] Zukunft“ ausrichtet, übergeht sie die zentralen, klassisch realistischen Parameter, die bei Thukydides und Morgenthau in diesem Zusammenhang bereits genannt wurden (Klüfers et al. 2017, S. 54). Indem sie präventive, präemptive und reaktive Handlungsempfehlungen unterscheidet, sagt sie wenig darüber, wann genau und wie diese umgesetzt werden sollen (Klüfers et al. 2017, S. 63). Zuletzt: Indem strategische Vorschauen nur mehr „multiple, grundsätzliche unterschiedliche Szenarios“ aufzeigen, versäumen sie, ihren strategischen Mehrwert explizit zu machen (Klüfers et al. 2017, S. 66). Das wiederum hängt nicht unwesentlich mit dem Problem zusammen, dass sie das Attribut strategisch schlicht als langfristig definieren. – Klassische Gegenargumente zum Thema Vorhersehbarkeit finden sich bereits bei Hans Morgenthau (1947) und Philip E. Tetlock (2005).
16 Das System 1 von Donald Trump ist gegenwärtig am überzeugendsten aufgearbeitet von Charlie Laderman und Brendan Simms (2017). System 1 als historisch angewendetes Konzept ist gut aufgearbeitet bei Steven Casey und Jonathan Wright (2008). Zur angrenzenden Debatte in der Theorie der Internationalen Beziehungen (IB), siehe das International Organization-Sonderheft (Hafner-Burton et al. 2017). – Klassiker aus der historisch arbeitenden IB-Theorie, die zu den ersten bei der systematischen Anwendung psychologischer Theorien gehörten und ihre Erkenntnisse seitdem überarbeitet haben, sind Yuen Foong Khong (1992) und Robert Jervis (2017).
17 Zum Widerspruch zwischen Freedman und Grays (1999, S. 23–43) 17 Faktoren in diesem Zusammenhang, die der Stratege in Betracht ziehen soll, siehe Freedman (2013, S. 237–44).
18 Wolfgang Schäuble hat kürzlich noch einmal in diese Richtung argumentiert, als er betonte, ein Minister müsse nicht der „größte Fachmann“ sein, sondern schlicht „politisch führen können“ (FAS Exklusiv 2017).