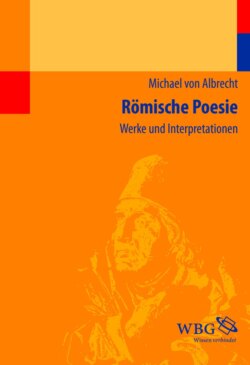Читать книгу Römische Poesie - Michael Albrecht - Страница 9
Der Aufbau der Einlage: Der Rückzug des Aias5
Оглавление1. Der Sinn der Wiederholung. Der erste Satz fasst überschriftartig den folgenden Abschnitt zusammen: Aias hielt nicht mehr stand. Der Wortlaut (vgl. 15, 727) knüpft ausdrücklich an das Rückzugsgefecht des Aias an, dessen letzte Phase nun folgen soll. Die episch-formelhafte Wiederaufnahme verdeutlicht den inneren Zusammenhang.
2. Sprachliche Darstellung des Geschosshagels. Den Rückzug begründet fürs Erste der Geschosshagel. Den Helden zermürbt das „schreckliche“ Klirren der Geschosse auf dem Helm. Das Adjektiv deutet an, dass Aias Angst hat (vgl. auch ἀϱγαλέον ἆσα ›schreckliches Keuchen‹). Die beklemmende Häufung der Imperfekta macht die quälende Realität zum Dauerzustand, unterstützt durch die Wiederkehr des Verbs ἔχω (›haben, halten‹) in den verschiedensten Fügungen: Der getroffene Helm klirrt ständig (ϰαναχὴν ἔχε), die linke Schulter wird müde, weil sie den Schild halten muss (ἔχων: nichts ist geeigneter, eine erstarrte Gebärde zu charakterisieren als das Partizip des Präsens), ja den Helden selbst hielt Atemnot in den Fängen (ἔχετο 109), und er „hatte“ keine Möglichkeit aufzuatmen (πάντοεν 110). Stilistische Nachlässigkeit? Sachgemäßes Sprechen! Das ‚Durative‘ der Situationsschilderung unterstreichen Adverbien (αἰεὶ 105, vgl. 107; 109). Das Gefühl der Allseitigkeit der Bedrängnis steigern auch Wörter wie πάντοεν (110), πάντη (111), πολύς (110), οὐδέ πῃ (110). Systematisch arbeitet der Dichter mit dem Wechsel des Standpunktes und schildert denselben Vorgang zunächst aus der Sicht der Troer (βάλλοντες Aktiv), dann aus der des Helms (βαλλομένη Passiv) und schließlich aus der des Aias (βάλλετο Passiv). Die Wiederholung des Verbs in verschiedener Perspektive spiegelt die Situation des Helden, der von allen Seiten unter Beschuss steht. Den Geschosshagel macht zusätzlich das stammverwandte Substantiv βέλεα fassbar (102; 108; vgl. 122). Im letzten Satz bewirkt die Wiederholung eines Wortes in verschiedenen Kasus („traductio“: ϰαϰόν ϰαϰῷ) eine visionäre Verdichtung (›Übel an Übel gereiht‹).
3. Der Wille des Zeus. Als zweite, gewichtigere Motivierung des Zurückweichens dient der Wille des Zeus. Den göttlichen Plan bringt zunächst nur der Dichter ins Spiel, am Ende aber erkennt Aias selbst, vor Furcht erstarrend (119), das Wirken der Götter: Zeus will den Sieg der Trojaner (121). Zur Einsicht führt ein als Götterzeichen verstandener Vorgang: Hektor schlägt dem Speer des Aias die Spitze ab. Der griechische Held ist einsichtig, verständig. Nicht passiv, sondern innerlich aktiv, bleibt Aias meist Subjekt der Handlung.6 Der wichtige geistige Vorgang wird durch Aorist hervorgehoben (119): Die Folge, das Zurückweichen, steht in Homers gewohntem Erzähltempus, dem Imperfekt (122), wie überhaupt die ganze Schilderung der Bedrängnis (nur am Ende erscheint ein Plusquamperfekt, das aber im Griechischen den gleichen Aspekt hat). Dagegen ist Hektors überraschender Schwertstreich (wie die folgenden dramatischen Ereignisse) im Aorist erzählt; so weist Homer den Erkenntnisvorgang nicht prinzipiell einer anderen Tempus-Ebene zu als das äußere Geschehen; vielmehr ist der Aspekt – Dauer bzw. Ingressivität – für den Tempusgebrauch entscheidend. 7
4. Der Mensch in Bedrängnis. Dass Aias Einblick in die Begrenztheit menschlicher Möglichkeiten gewinnt, ist die dritte und wichtigste Ursache seines Rückzugs. Die Erkenntnis, dass er nur ein Mensch ist, macht ihn von heroischen Verhaltenszwängen frei. So wird aus dem Helden in Bedrängnis der Mensch in Bedrängnis. Gerade dem stärksten und (in der späteren Tradition törichtesten) Helden traut Homer soviel Einsicht, ja Weisheit zu. Das Heroische in einem vordergründigen Sinne ist somit schon am Anfang unserer epischen Überlieferung durch das Menschliche überwunden.