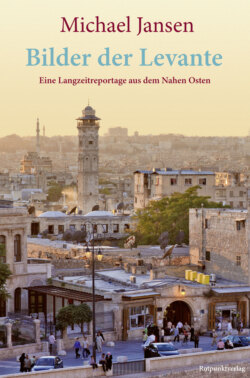Читать книгу Bilder der Levante - Michael Jansen - Страница 7
2Ausbruch
ОглавлениеBay City, Michigan, USA, vierziger Jahre
Grandma Fancher erlaubte nur ein paar leichte Möbelstücke auf ihrem Saruk; Schuhe waren verboten. Aber sie hatte nichts dagegen, wenn ich mit meinem Spielzeugauto über die blau geblümte Fahrbahn entlang des Teppichrands fuhr. Der Saruk ist viel herumgekommen. In Iran geknüpft, in Bay City erstanden, nach Denver und wieder zurück transportiert, dann nach Beirut, Damaskus und schließlich in das zweitausend Jahre alte Agios Dometios, die Mischung aus Vorort und Dorf, wo ich heute wohne.
Grandma Fancher bewohnte eine Zimmerflucht in dem schönen Haus mit Garten ihrer Schwester Minnie. Der Saruk bedeckte die Holzdielen im Salon meiner Großmutter, um ihr Bett im Nebenzimmer waren drei blaue chinesische Seidenteppiche gelegt. Auf ihrem Frisiertischchen ein silbernes Art-Déco-Set, Handspiegel, Kamm und Bürste, verziert mit einer Frau mit fließendem Haar. Grandma Fancher frühstückte im Bett, saß dort in ihrer wattierten Jacke, das Essen vor sich auf einem Tablett mit Füßchen, von der Köchin hereingebracht. In der rechten oberen Ecke des Tabletts stand immer eine kleine Teekanne mit Blumenmuster, dazu die passende Tasse und Untertasse. Über Nacht hatte ihr ein spinnenfeines Haarnetz eine zarte Linie quer über die Stirn gezeichnet. Nachdem sie gebadet, sich mit Talkumpuder eingerieben und angekleidet hatte, frisierte sie sich mit einem elektrischen Lockenstab das drahtige graue Haar, das sie kurz, aber nicht zu kurz trug.
Grandma Fancher, eine zierliche Frau mit dunklen, tief liegenden Augen, stets in elegante, dunkelblaue oder burgunderrote Kleider aus weicher Wolle gekleidet, eine Brosche am hohen V-Ausschnitt, sah ihrer großgewachsenen, knochigen, hellhäutigen älteren Schwester überhaupt nicht ähnlich.
Vor dem Mittagessen zog der Duft von Hefebrötchen und Brathähnchen durchs Haus. Bei Tisch musste ich stillsitzen und aufessen. Die Ehre meines Zweigs der Familie – der jüngeren, benachteiligten Seite – lag auf meinen Schultern. Der Zweig von Großtante Minnie war die wohlhabende, ältere Seite.
Ida, meine Großmutter, hatte die High School als Jahrgangsbeste abgeschlossen und wollte gern ans Vassar College, doch ihr Vater, der dafür wohlhabend genug gewesen wäre, sagte: »Mädchen gehen nicht aufs College, sie heiraten.« Ida rächte sich, indem sie ihrer Schwester Minnie den Verlobten stahl. Auf Idas Nachttischchen stand in einem Silberrahmen ein Foto vom großen, ernsten Arthur und ihr selbst, in Weiß, breitkrempige Hüte auf den Köpfen, während eines Urlaubs in Palm Beach.
Sie hatte immer nach Hawaii gewollt. Arthur versprach es ihr, starb aber in Denver, bevor sie die Reise hätten antreten können. Mit meinen Eltern kehrte sie nach Bay City zurück, um sich dort im Netz der Familie zu verfangen, breit ausgeworfen von der auch verwitweten Minnie.
Ich rechne es Grandma Fancher hoch an, die Grundlagen für meinen Triumph mit dem Heiligen Ludwig gelegt zu haben. In goldenen Brokat gekleidet, saß sie in der Wohnung meines Vaters im Ohrensessel und las mir aus den Märchen der Gebrüder Grimm und Hans Christian Andersen vor, bis ich sie auswendig kannte und sich die Worte klammheimlich in mein Unbewusstes eingeprägt hatten. Als ich dann gedruckten Worten in der Geschichte über den Heiligen Ludwig begegnete, sprangen sie mich praktisch aus den Seiten an.
Bay City, Michigan, USA, September 1951
Der blasse Lehrer, unsere erste männliche Lehrkraft in der Grundschule, war neu und kannte sich in der Schule noch nicht aus. Als er die Anwesenheitsliste durchging, »Billie Carlisle« rief und ein Mädchen aufstand, wirkte er kurz ratlos. Sagte aber nichts. Als dann bei »Michael Fancher« ein zweites Mädchen aufstand, schickte er uns beide zur Direktorin. Die gute Seele brachte uns zurück ins Klassenzimmer und erklärte, dass diese Männernamen tatsächlich unsere seien. Er hätte wissen können, dass Billie durchaus als Mädchenname verwendet wird, bei Michael hätte er zugegebenermaßen mit einem Jungen rechnen können. Nach diesem kleinen Intermezzo fragte er mich nie, warum man mich so genannt hatte.
Gefragt haben mich das viele Leute, aber eine zufriedenstellende Antwort habe auch ich nicht. Stimmungsabhängig sagte Ma manchmal: »Dein Vater mochte keine Mädchennamen«, oder sie selbst habe sich für den Vornamen von »Michael Strange« entschieden, dem Pseudonym und Lieblingsnamen von Blanche Oelrichs, einer gefeierten Schauspielerin und Dichterin (von der meine Mutter vorgab, sie zu kennen). Blanche oder Michael war die zweite Ehefrau des Schauspielers John Barrymore; er wiederum war der zweite ihrer drei Ehemänner. Ihre Biografie Who Tells Me True erschien 1940, in meinem Geburtsjahr. Das mag sich auf meine Namensgebung ausgewirkt haben.
Oder Ma sagte, sie liebe Michael Arlens Der grüne Hut, einen gewagten Roman, der sowohl in New York und London für die Bühne bearbeitet als auch mit Greta Garbo und John Gilbert verfilmt worden war. Wie Blanche fühle ich mich wohl mit »Michael« und finde, der Name passt zu mir, auch wenn er hin und wieder für Verwirrung sorgt. Ein paar Wochen, nachdem ich angefangen hatte, für die Irish Times zu schreiben, erzählte mir ein Diplomat, im irischen Außenministerium gehöre es zum Insiderwissen, dass Michael Jansen eine Frau sei.
Beirut, Libanon, April 1965
Während unserer anfänglichen Telefonate wegen eines Jobs hatte Godfrey mich »Miss F.« genannt. Bei unserer wichtigsten Begegnung musste er im Bett liegen. Bei einem Besuch von Freunden im Bergdorf Schemlan hatte er eine schwere Kiste Lebensmittel vom Auto ins Haus getragen und einen Bandscheibenvorfall gehabt. Er hatte mir gesagt, der Haustürschlüssel liege unter dem Fußabtreter. Ich solle einfach in die Wohnung und ins Schlafzimmer kommen, dort liege er seit sechs Monaten. Der Professor, der mich für die Stelle als Redaktionsassistentin vorgeschlagen hatte, warnte mich vor dem Bewerbungsgespräch: »Jansen ist ein riesiger bärtiger Sikh, der kleine Mädchen frisst.« Unsicher, ob das nun ein Scherz war oder nicht, postierte ich meinen kräftigen syrischen Freund an der Haustür.
Godfrey war natürlich kein großer, bärtiger Sikh, der kleine Mädchen fraß, ob morgens, mittags oder zum Nachmittagstee. Er war ein schmaler Mann mit klar indischen oder südasiatischen Gesichtszügen, einer Hornbrille, leicht gewelltem schwarzem Haar und einer etwas gebieterischen Art. »Gehen Sie mal in die Küche und machen uns zwei Whisky«, befahl er. Ich tat wie mir geheißen, kam wieder zurück, setzte mich in den Besucherstuhl und wir besprachen, wie man das Middle East Forum von einer sporadischen monatlichen Zeitschrift zu einem ernsthaften, viermal jährlich erscheinenden Journal machen könne.
Die Arbeit musste warten, bis sein Arzt entschied, ob Godfrey geheilt war oder noch eine riskante Operation benötigte. Ich wollte gern anfangen, weil ich das Geld brauchte, und so rief ich ihn ab und zu an, um mich nach seiner Genesung zu erkundigen. Schließlich ging er für irgendwelche Untersuchungen ins Krankenhaus. »Die haben mich auf einen Tisch geschnallt, mir Kontrastmittel in die Wirbelsäule injiziert, mich in einem dunklen Raum auf den Kopf gestellt und geröntgt. Ich war da ziemlich lange drin, bis Suhail irgendwann reinkam und gesagt hat: ›Die Bandscheibe ist verheilt, aber weil die Nerven noch gereizt sind, musst du Krankengymnastik machen.‹ Als ich fragte, welche Farbe das Kontrastmittel denn habe, zog er die Spritze raus und hielt sie hoch. ›Schau, farblos.‹ Der Tisch wurde wieder zurück gekippt, ich wurde befreit und durfte nach Hause.« Gegenüber der Sache mit dem Kontrastmittel hatte ich meine Zweifel, sagte aber nichts.
Godfrey war die ideale Person für die ehrenamtliche Herausgabe des Journals. Als indischer Presseattaché in Kairo, Beirut und Istanbul war er seit 1948 immer wieder durch den Nahen Osten gereist. Er verfügte über ein breites Netzwerk in der Region und ein tiefes Verständnis, wie sie wirtschaftlich und politisch funktionierte. Wenngleich er auf seinen Reisen Artikel in Auftrag geben wollte, schickte er bald mich nach Kairo auf die Suche nach Autoren.
Kairo, Ägypten, Sommer 1965
Von Godfrey mit einer Namensliste ausgerüstet, flog ich nach Ägypten und bezog eines der Chalets im Garten des Omar-Khayyam-Hotels. Als erstes traf ich den Herausgeber einer großen Tageszeitung, der mir gleich Muhammad Sid Ahmad zuteilte, einen blassen, eher schüchternen Mann mit Brille, der Termine für mich arrangieren sollte; Muhammad hatte gerade erst als Volontär bei der Zeitung angefangen. Besonders gern wollte Godfrey Kamal el-Din Rifaat als Autor gewinnen, einen ehemaligen General und damals in der Arabischen Sozialistischen Union für die Abteilung Information verantwortlich. Muhammad schlug vor, mich ägyptischen Intellektuellen und Journalisten vorzustellen und lud mich zum Abendessen ein.
Vorsichtig fuhr er durch den Kairoer Verkehr nach Gizeh, auf eine schmale unbefestigte Wüstenstraße und zu einem Restaurant mit einer großartigen Aussicht auf die Pyramiden. »Heute gehe ich zum ersten Mal seit meiner Ausgangssperre aus«, sagte er und erzählte, dass er ein paar Monate zuvor aus dem Gefängnis entlassen worden sei. Er war als Jugendlicher Kommunist gewesen, bekehrt durch Mitschüler und Lehrer an seinem Gymnasium, und hatte sich einer kommunistischen Geheimzelle angeschlossen, doch sein Vater hatte ihn ins Ausland geschickt, in der Erwartung, dass Muhammad die Vergnügungen von Paris den Verschwörungen von Kairo vorzöge.
Doch stattdessen, so erzählte mir Muhammad beim Abendessen, im Hintergrund hallte und flackerte die Lichtershow, sei er in sein Heimatland zurückgekehrt und habe eine Weile im Untergrund gelebt, in einer Zelle unter der Führung einer Französin namens Odette Hazan, bis die Mitglieder seines Zweigs der geteilten Partei verhaftet worden seien. »Nach der Zeit im Untergrund unter Odettes Befehl war das Gefängnis eine Erleichterung.« Seine erste Haftzeit war vorbei, kurz nachdem das Komitee der Freien Offiziere 1952 den König gestürzt und 1954 Nasser an die Macht gebracht hatte. 1959 sei er in der Wüste zusammen mit einer Reihe von Kommunisten und anderen Dissidenten erneut verhaftet worden und 1964 entlassen. »Das Gefängnis war eine Universität. Dort gab es Intellektuelle, die zu allen möglichen Themen lehrten. Das war gut für uns.« Während dieser Zeit hätten Muhammad und seine Kameraden die Sicht der Partei auf die Revolution überdacht und allmählich Ägyptens neue Ordnung akzeptiert – bis deren allmählicher Verfall, wie er mir 2002 schrieb, darin kulminiert habe, dass Nassers Nachfolger Anwar Sadat 1978 Jerusalem besuchte.
Muhammad gehörte zur ottomanischen Oberschicht, die einst Ägypten beherrschte. Sein Vater, ein Pascha unter dem König, Gouverneur von Port Said und Suez sowie Parlamentsabgeordneter, habe die politische Berufung seines Sohnes nicht verstanden. Später schrieb Muhammad, sein Vater habe aus Angst um das Leben seines Sohns dafür gesorgt, dass dessen erster Gefängnisaufenthalt verlängert worden sei. Muhammads Vater starb 1955, verbittert durch den Verlust ausgedehnter Ländereien durch die Reformen der Regierung Nasser.
Muhammads Mutter, Schwester des ehemaligen Premierministers Sidki Pasha, war eine Grande Dame. Ich traf sie zum Tee in der Wohnung der Familie in der Ibn-Zanki-Straße in Zamalek. Das Wohnzimmer war voller eleganter französischer Möbel, über die André Philip, ehemaliger Minister und stellvertretender Parteivorsitzender der französischen Sozialisten, zu Muhammad gesagt hatte, sie gehörten in ein Museum. Muhammads Bücherregale voller kommunistischer Klassiker in ihren üblichen schlichten Einbänden zeigten, dass das Gefängnis seiner jugendlichen Leidenschaft nichts anhaben konnte.
Muhammad sagte, dass wir für das Treffen mit Rifaat nach Alexandria fahren sollten, wo der ehemalige General mit seiner Familie Urlaub mache. Etwa auf der Hälfte der Strecke übernahm ich das Steuer und ließ Muhammad erst wieder fahren, als wir die Küstenstadt erreichten. Ein paar Tage zuvor war seine Mutter für den Sommer dorthin in die Ferienwohnung der Familie umgesiedelt. Sie hatte für ein fantastisches Mittagessen gesorgt, kalten frischen Lachs mit Mayonnaise. Ich wohnte im Hotel Palästina, einer schönen Villa in einem palmbeschatteten Garten am Strand.
Rifaat empfing uns in seinem Strandhaus und willigte ein, einen zweiteiligen Artikel über die »Entwicklung sozialistischer Beziehungen« zu schreiben, durch die Ägypten in der wirtschaftlichen Entwicklung die »Startphase« erreichen solle. Letztlich lieferte er einen Artikel ab – über die Idee der ägyptischen Bemühungen –, jedoch nicht den zweiten, der die Praxis behandeln sollte.
Muhammad und ich fuhren übers Land, besuchten ein viel größeres und aufwendigeres Zentrum als jenes, das ich bei meiner ersten Kairoreise 1961 gesehen hatte. Wie auch bei späteren Besuchen in Kairo nahm mich Muhammad mit ins »Night and Day«, ein bei Intellektuellen beliebtes 24-Stunden-Café im Semiramis-Hotel. Dort traf ich Lakhdar Brahimi, damals algerischer Botschafter in Ägypten. Er versprach, einen Artikel über den algerischen Unabhängigkeitskampf zu schreiben.
Brahimi hatte zuvor die algerische Nationale Befreiungsfront in Tunis und andernorts repräsentiert. Neben seinem Botschafterposten war er Untergeneralsekretär der Arabischen Liga für kulturelle Angelegenheiten. Später wurde er Botschafter in London und arbeitete für die UNO-Friedenssicherung. Schließlich wurde er algerischer Außenminister und beendete seine Karriere mit dem Versuch, zwischen den syrischen Kriegsparteien Friedensgespräche zu etablieren. Im Laufe der Jahre wurden wir enge Freunde.
Ich lernte das Feshawi kennen, das berühmteste Tee- und Kaffeehaus in Chan el-Chalili, dem Suk in der Kairoer Altstadt. Das Feshawi, 1773 eröffnet, war ein Lieblingsort von Journalisten, Schriftstellern und Akademikern, die in ihren Wasserpfeifen Haschisch rauchten und bei Tee über Politik diskutierten.
Godfreys Freund Khaled Muhieddine holte mich in seinem schwarzen Fiat im Omar-Khayyam-Hotel ab; auf der Seite des Autos prangten zwei Sterne, ein Zeichen, dass er dem revolutionären Komitee der Freien Offiziere angehörte. Um sicherzugehen, dass wir nicht abgehört wurden, unterhielten wir uns bei einem Spaziergang auf dem Gelände des Gezira Clubs. Als ich später vor dem Hotel aus dem Auto stieg, salutierte der Portier.
Beirut, Libanon, 1965/66
Wenngleich Godfreys Rolle als Chefredakteur eigentlich eine ehrenamtliche sein sollte, kam er regelmäßig ins Büro des Middle East Forum, zwei Zimmerchen, nachträglich auf das Dach der Alumni-Vereinigung der American University of Beirut (AUB) gebaut, gleich neben dem Universitätsspital. Die Räume, im Sommer glühend heiß und im Winter eiskalt, teilten wir uns mit einer fröhlichen, kräftigen jungen Sekretärin namens Alice, die in ihrem Job ein ziemlich hoffnungsloser Fall war. Godfrey nannte mich in variierend gebieterischem Tonfall weiterhin »Miss F.«, am Telefon wie auch persönlich. Ich fand das etwas einschüchternd, bis ich merkte, dass er einfach so war; Er wollte gar nicht brüsk oder herrisch sein.
Als es Sommer wurde, tauchte Godfrey in einem kurzärmligen Safarihemd und goldfarben bestickten Schnabelschuhen aus Rajasthan auf. Alice kicherte. Als er zu einer Party auf meiner großen Terrasse kam, sprang mein Pudel Nana an ihm hoch und hinterließ auf seinem weißen Achkan staubige Pfotenabdrücke. Es schien ihm nichts auszumachen. Nana, anfangs eifersüchtig, mochte ihn irgendwann und blieb über Weihnachten bei ihm, als ich wieder nach Kairo fuhr, abermals auf Autorensuche.
Bis etwa um Ostern herum dachte keiner von uns beiden an die Möglichkeit einer Beziehung; danach konnten wir uns nicht mehr vorstellen, voneinander getrennt zu sein.
Araya, Libanon, Frühjahr 1966
Im Haus von Prue und Ian Seymour kam ihre Tochter Liza, zwei Jahre alt, hellblond, die Treppe heruntergesaust und schlang ihre Arme um Godfreys Knie. Mit ihrem »Goffey, Goffey!« schuf sie den liebevollen Spitznamen »Gof«. Godfrey mochte ihn lieber als seinen Geburtsnamen; in seinen Augen hatten seine Eltern bei allen fünf Kindern ein Faible für unpassende Namen gehabt: Albert, Eunice, Elaine und Daphne, genannt D, hießen seine vier Geschwister. Zwei waren hellhäutig – Eunice und Elaine –, drei der Kinder dunkel, wenngleich sie nur zu einem Viertel indischstämmig waren. Ihr Vater stammte aus einer der jahrhundertealten europäischen Familien des indischen Subkontinents, die als »ansässige Europäer« galten, während ihre Mutter anglo-indischer Herkunft war, der Gemeinschaft entstammte, der in Indien letztlich die gesamte Familie zugerechnet wurde. Elaine wanderte nach Großbritannien aus, wo sie als zurückgekehrte Engländerin durchging.
Tabarja und Antelias, Libanon, 13. April 1975
Ich weiß nicht mehr, warum John und Peggy Carswell ihr Ostermahl in diesem Jahr laut orthodoxem Kalender eine Woche zu früh veranstalteten. Wir kamen in Tabarja unter einem schiefergrauen Himmel zusammen. Das alte libanesische Haus mit seinen hohen Decken war recht karg, außer dem alten, ausgestopften Babyelefanten im Salon. Es gab Lammbraten mit Reis, der blau, rosa und gelb gefärbt war, nach einem mittelalterlichen Rezept, das John in einem uralten Buch im British Museum gefunden hatte. »Ich habe das Schaf aus Aleppo geholt. Beim Gottesdienst habe ich mich in die erste Reihe gesetzt«, witzelte John und sein borstiger Schnurrbart zuckte über seinem feinen Lächeln. Zum Abschluss des Mahls gab es reichlich Gorgonzola, Birnen und Rotwein. Ein feiner Regen setzte ein.
Als es dämmerte, fuhren wir auf der Küstenstraße in Richtung Süden nach Beirut. Hinter Antelias mussten wir immer wieder anhalten. Kontrollpunkte. Soldaten. Raue bewaffnete Männer in Zivil. Godfrey schaltete das Autoradio ein und wir hörten gerade noch das Ende einer Nachrichtenmeldung. »Dreißig Palästinenser und mindestens vier Christen wurden getötet, in Ain-el-Remmaneh sind Unruhen ausgebrochen …« Der Moderator zählte die betroffenen Viertel auf, als handele es sich um den Wetterbericht.
Das Massaker von Ain-el-Remmaneh war der Höhepunkt monatelanger Spannungen und gewaltsamer Zwischenfälle, die mit Streiks einhergingen. Im Dezember 1974 hatte das Fischereiunternehmen des ehemaligen Präsidenten Camille Chamoun versucht, vor der Küste von Sidon ein Monopol zu errichten, was zu Fischerprotesten im Süden von Beirut geführt hatte, die sich bis in den Norden ausbreiteten. Am 26. Februar 1975 organisierte der charismatische Abgeordnete Marouf Saad in Sidon Massenproteste. Als Saad in der ersten Reihe der Demonstration mitmarschierte, wurde er angeschossen – es hieß, von einem Armeescharfschützen – und starb eine knappe Woche später. Seine Beisetzung am 7. März brachte das sunnitisch geprägte Sidon und Saads Verbündete in den nahegelegenen palästinensischen Flüchtlingslagern gegen die maronitisch dominierte Oberschicht auf.
Am Tag, als Maryas Schule geschlossen wurde, schickte Godfrey seinen ersten Bürgerkriegsbericht an den Economist.
Beirut, Libanon, Februar 1976
»Lass uns bei Brahim vorbeischauen, wenn wir in der Stadt sind«, sagte Godfrey, als wir auf der Schnellstraße nach Beirut fuhren. Wir stellten das Auto vor dem Farid-el-Atrache-Nachtclub in Raouché ab und gingen in die Lobby des schäbigen Wohnblocks. Bevor wir die Treppe zu Brahims Wohnung hätten hinaufgehen können, hielt uns der Concierge an. »Ustad* Brahim ist im Universitätsspital.« Seit wann? »Seit drei Tagen.«
Auf dem Fußboden vor seinem Krankenzimmer stand ein großer Blumenstrauß. Im Bett saß ein Mann mit verbranntem, verquollenem Gesicht, die Hände verbunden, den Körper mit einem leichten Tuch bedeckt. Er krächzte eine Begrüßung. »Das wussten wir nicht«, sagte Godfrey. Marya wich entsetzt zurück, ich sagte nichts. Er war nicht wiederzuerkennen.
Jemand, ich weiß nicht mehr, wer, erzählte uns, Brahim sei in die Zeitungsredaktion der irakischen Baath-Partei gegangen, eben in jener Nacht, als die Syrer zuschlugen. Als der Chefredakteur an seinem Schreibtisch umgebracht wurde, war Brahim schon in den Keller gegangen, um sich die arbeitenden Druckerpressen anzusehen. Er liebte den Geruch der Druckertinte, das Zischen und Klappern der Pressen. »Die Syrer haben über eine Rampe Benzinfässer in den Keller gerollt. Jeder, der fliehen wollte, wurde erschossen. Brahim hat sich auf dem Boden zusammengekauert, unter dem Rauch, bis er sich wieder hinaustraute. Die Blumen sind vom syrischen Informationsminister.«
Wir fuhren mindestens jeden zweiten Tag nach Beirut. Brahim erholte sich allmählich, sein entzündetes Gesicht nahm wieder seine normale Größe und Form an; den verbrannten Körper wuschen wir ihm mit kaltem Wasser. Christianne, seine Frau, kam aus Kairo, ebenso Jacqueline, seine zweite Ehefrau. Seine Lebensgeister kehrten zurück, aber das Krankenhausessen konnte er nicht ausstehen. Ich kochte Rahmspinat und machte Götterspeise aus frischgepresstem Orangensaft, weiche Speisen, die nach etwas schmeckten. Brahim wurde stärker und machte wieder Witze. Er redete mit Godfrey über den Krieg. Gerade, als er zu genesen schien, fanden wir ihn eines Tages auf der Intensivstation, an Maschinen angeschlossen; er atmete röchelnd. Godfrey setzte sich zu ihm und hielt seine Hand, bis er starb. Der Arzt sagte, wenn er kein Raucher gewesen wäre, hätte er vielleicht überlebt.
Brahim war einer von Godfreys ältesten und engsten Freunden. Sie hatten sich in Kairo kennengelernt, während Godfreys erster Entsendung als Presseattaché in der ersten ägyptischen Vertretung des unabhängigen Indiens. Wie Muhammad Sid Ahmad – und so viele andere junge Ägypter damals – war auch Brahim Kommunist gewesen. Er war ein erstaunlicher Mann, hatte in der Koranschule Arabisch lesen und schreiben gelernt, sich aus den Hintergassen Alexandrias emporgekämpft und im Hafen gearbeitet. Dort hatte er sich selbst nach und nach mit einem Wörterbuch Englisch beigebracht. Als er in einer Razzia gegen Linke der vorrevolutionären ägyptischen Polizei festgenommen werden sollte, setzte Godfrey, damals indischer Presseattaché in Kairo, ihn in ein Flugzeug nach Indien, mit der Aussicht auf einen Job beim arabischsprachigen Programm von All India Radio. Als den Ägyptern klar wurde, dass Brahim an Bord war, befahl der Fluglotse dem Kapitän, zurückzukehren. Der weigerte sich, da er den ägyptischen Luftraum bereits verlassen hatte. In Indien lernte Brahim Christianne kennen, und sie heirateten. Unter Nassers republikanischem Regime saß er sieben Jahre im Gefängnis, arbeitete dann für verschiedene Medien und verließ Ägypten schließlich, um als Korrespondent für eine jugoslawische Zeitung zu arbeiten.
Godfrey floh trauernd aus Beirut nach Jerusalem. Ich schnitt Zweige vom Mandelbaum in unserem Garten in Schemlan und legte sie, auf einer Moscheetreppe in Südbeirut, auf Brahims Sarg. Dann brachte Christianne ihn zur Beisetzung nach Hause nach Kairo, in die Stadt, die er einst verlassen hatte.
Beirut, Libanon, März 1976
Wir fuhren nach Beirut, damit Marya für ein paar Tage ins Collège Louise Wegmann gehen konnte; den Campus in Bchamoun bei Schemlan hatte das Collège geschlossen. Wir zogen in eine enge Wohnung beim alten Leuchtturm am Ende der Hamrastraße. Die Wohnung gehörte den Eltern unserer Nachbarin Penny und lag nah bei der Schule. Im Smith’s-Supermarkt kauften wir Lebensmittel und Kerzen, bezogen die Betten mit mitgebrachter Wäsche und stellten uns auf Stromausfälle ein, die es in Schemlan nicht gab. Nachts hörten wir, wie Plünderer die Metallgitter der Geschäfte aufrissen, eines nach dem anderen, und die Straße heraufkamen, bis sie unter unserer Wohnung waren. Marya schlief weiter, aber Godfrey und ich lagen wach und machten uns Sorgen, sie könnte aufwachen und Angst bekommen.
Eines Abends saßen wir auf dem Balkon und sahen auf dem Fernsehgerät der Nachbarsfamilie die Nachrichten, als ein Offizier das Fernsehstudio betrat, sich auf einen Stuhl an Nicole Maillards Tisch setzte und seine Pistole auf den Tisch legte. Nicole war sprachlos. Sie war eine enge Freundin, arbeitete damals als Fernsehmoderatorin und sprach die Frühnachrichten im Radio.
Der Mann stellte sich als Abdel Aziz al-Ahdab vor, Kommandant der Militärgarnison von Beirut, und ernannte sich selbst zum zeitweiligen Militärgouverneur Libanons. Er forderte den Rücktritt von Präsident Suleiman Frangieh und Premierminister Raschid Karami. Ahdab sagte, er wolle verhindern, dass die Armee in konfessionelle Fraktionen zerfalle, und Libanon von seinem einjährigen Bürgerkrieg befreien – in der Zeit bombardierten Milizen Beirut, entführten Zivilisten, plünderten, teilten die Stadt in einen christlichen Osten und einen multikonfessionellen Westen auf und schossen auf jeden, der von einem Sektor in den anderen wollte. Die Regierung sei gelähmt und könne nichts tun, um dem Chaos Einhalt zu gebieten, die Bevölkerung zu schützen oder die Armee aufrechtzuerhalten.
Ringsum saß die Nachbarschaft erstarrt vor ihren Bildschirmen, die in der Dunkelheit schwach leuchteten, dann jubelte einer nach dem anderen und in ganz Beirut ertönten Freudenschüsse; Kirchenglocken läuteten zur Unterstützung. Nur wenige schliefen gut in jener Nacht. Viele hofften, der Konflikt werde nun enden und Politiker und Milizen würden Ahdab ernst nehmen.
Am nächsten Morgen spazierten wir nach Raouché zum Haus unserer Freunde, den Radis. Ma Radi kochte wie immer, ihre Töchter Selma und Nuha durchsuchten das libanesische Radio nach Neuigkeiten über den Putsch, über Ahdab, den plötzlichen Helden. Kriegsmüde Libanesen aus allen Gemeinden riefen bei Radiosendern an, um Ahdab ihre Unterstützung zuzusichern und seinen Schritt gutzuheißen, den Krieg zu beenden. Anrufe kamen aus den sunnitischen Städten Sidon und Tripoli, aus christlichen und drusischen Bergdörfern, und von beiden Seiten der Beiruter Trennlinie. Anrufer nannten ihre Namen und riskierten damit Vergeltung durch lokale Milizen.
Die libanesische Regierung und Syrien, das Frangieh unterstützte, ignorierten Ahdab. Kurz nach dem fehlgeschlagenen Coup trat Frangieh mit 65 Jahren zurück. Für einen Augenblick setzte der Krieg aus.
Schemlan, Libanon, Frühjahr 1976
In einer durch den Krieg aus den Fugen geratenen Welt war mir das zyprische Radio ein Rettungsort. Ich saß in der kühlen, von einem Feigenbaum überschatteten Bibliothek unseres Hauses und hörte Mikis Theodorakis’ Revolutionslieder und Manos Hadjidakis’ poetische Melodien. Auf einem gelben Notizblock schrieb ich an einem Buch über den Putsch der griechischen Junta und die darauffolgende türkische Invasion und Besetzung Nordzyperns. Ich schrieb über unser geplündertes Haus in der Nähe des Marktes in der Küstenstadt Kyrenia. Ich schrieb, während Granaten aus der 75-mm-Haubitze in Ainab über unsere Köpfe hinwegdröhnten, um jenseits der breiten Schnellstraße nach Damaskus im maronitischen Gebirge ein abgelegenes Dorf zu treffen. In unserem Garten saß Neville Thomas bei Erdbeeren mit Sahne. Er war ein ehemaliger Offizier der britischen Armee, der mit seiner Frau Rosemary in einem Haus über Schemlan wohnte. Neville warnte uns, dass wir gut in Deckung gehen sollten, wenn eine Granate ein heulendes Geräusch mache, weil sie dann kreiselte und jederzeit einschlagen könne. Wir hatten nur zwei Dächer, das Dach des Hauses selbst und die Decke zwischen Wohnzimmer und Bibliothek. Während ich schrieb, las Godfrey auf seinem üblichen Platz, dem Diwan im Wohnzimmer, und Marya erhielt von George oder Elie, die ihre Kalaschnikows an der Hintertür abgelegt hatten, Französisch- und Matheunterricht. George und Elie waren die Söhne unseres Nachbarn Nimr Eid. Sie unterrichteten Marya privat weiter, nachdem ihre Schule geschlossen worden war.
Elie, fröhlich und rundgesichtig, hatte im Dezember in der »Schlacht der Hotels« gekämpft und die Gefechte unversehrt überstanden. George, groß und dünn, half seinem Vater in dem Geschäft unterhalb der Anhöhe mit der Kirche. Selim, der Schlachter, der immer eine kleine Schafherde auf der Wiese gegenüber von seinem Laden weiden ließ, versorgte während dieser kargen Monate das Dorf mit Lebensmitteln. Wenn wir nach Beirut fuhren, kauften wir in der Bäckerei in Aramoun stets einige Brote für Freunde im Dorf, die nicht in die Stadt hinunterfahren wollten, weil sie sich vor konfessionellen Kontrollpunkten, Entführungen und Mord fürchteten.
Wir legten einen Grundlebensmittelvorrat an, falls wir im Dorf eingeschlossen werden sollten, Linsen, Bohnen, Mehl, Corned-Beef-Büchsen, Milchpulver, Kaffee und Tee, und Holzkohle zum Kochen, falls es kein Flaschengas mehr geben sollte.
Schemlan und Beirut, Libanon, Juni 1976
Marya wollte nicht bei unseren Nachbarn Penny und Eric im Dorf bleiben. Die beiden wohnten in Nimr Eids altem Haus um die Ecke. So fuhren wir im Mercedes von Pennys Eltern, eine Leihgabe, nachdem wir unseren panzerartigen Volvo in Damaskus gelassen hatten, zu dritt nach Beirut. Auf dem Weg ins Tal hielten wir an der Zapfsäule in Bchamoun, um Öl für den Generator bei Reuters zu kaufen, von wo Godfrey seine Artikel an den Economist schickte. Auf der Küstenstraße und in Ras Beirut lief der Verkehr nur zäh. Wir fuhren am Zaun des Sanayeh-Parks entlang und hielten vor dem Büro der Nachrichtenagentur. Im selben Moment, als wir drei in die schützende Eingangshalle traten, schlug draußen eine Mörsergranate ein und erschütterte das Gebäude bis in die Grundmauern. Ein bleicher Journalist hatte sich in der Halle in Sicherheit gebracht und sagte: »Heute Vormittag ist es besonders schlimm.« Godfrey ging die Treppe hinauf, um seinen Artikel und das Öl abzuliefern, unsere bescheidene Spende für die Telexbenutzung. Als er wiederkam, spähten wir vorsichtig aus der Eingangshalle um die Ecke und sahen, dass das Auto voller Erdbrocken und zerfetzter Blätter war. Die Mörsergranate war direkt neben dem schmiedeeisernen Zaun im Park eingeschlagen, hatte ringsum alles mit Erde und Schutt verdreckt, aber keinen ernsthaften Schaden verursacht.
Erschrocken über unser knappes Entkommen, fuhren wir durch die leeren Straßen schnell zu Nicoles Apartmentblock in der Verdunstraße. Wir liefen zu ihrer Wohnung hinauf. Sie bereitete in aller Ruhe das Mittagessen zu. »Wie wär’s mit einem Drink?«, fragte sie, nachdem wir ihr von der Granate erzählt hatten. »Mohammad hat gerade angerufen, er kommt auch gleich vorbei.«
Weil ich etwas im Auto vergessen hatte, lief ich noch einmal rasch die Treppe zum Parkplatz hinunter. Dort stand Mohammad Machnouk gegen sein Auto gelehnt. Was war passiert? »Ich bin aus dem Büro und habe abgeschlossen, dann ist mir eingefallen, dass ich ein paar Unterlagen mitnehmen wollte. Aber als ich den Schlüssel ins Schloss steckte, ist eine Granate im Zimmer eingeschlagen und die Tür ist rausgeflogen. Wäre ich drinnen gewesen, wäre ich jetzt tot.« Als wir in Nicoles Wohnung zurückkamen, schenkte sie ihm einen großen Brandy ein.
Jeder hatte eine Geschichte. Nicole hatte am anderen Ende des Moderatorentisches gesessen, als Ahdab seinen populären, aber sinnlosen Putsch durchgeführt hatte. Wir selbst waren auf dem Weg nach Schemlan zwischen der Küste und Bchamoun in einen Luftangriff libanesischer Hawker Hunters auf Rebellen geraten. Die Männer, mit Gewehren bewaffnete, uniformierte Drusen, hatten uns zugewinkt.
Unser Nachbar Eric stand eines Tages vor unserer Hintertür, mit zitternden Händen und trübem Blick, und verlangte einen großen Whisky. »Ich bin auf der Küstenstraße gefahren, als zwei bewaffnete Männer mich angehalten haben und meinen Ausweis sehen wollten. Sie sind ins Auto eingestiegen. Der Dünne vorne und der Dicke hinten. Sie wollten Zigaretten und Geld. Ich habe ihnen meine Schachtel gegeben und die paar Pfund, die ich dabeihatte. ›Ist das alles?‹, hat der Dicke gefragt, und mit seiner Kalaschnikow ein Stück Stoff hochgeschoben, das von der Decke hing. ›Ja.‹ Da haben sie gelacht und mir gesagt, ich solle anhalten, haben mir mein Geld zurückgegeben und die Zigaretten und mir viel Glück gewünscht, dann sind sie wieder ausgestiegen. Ich dachte, mein letztes Stündchen habe geschlagen. Erzählt Penny nichts davon.« Eric hatte Revolutionen in Lateinamerika überlebt und uns die Kunst des Fertigens und Werfens von Molotowcocktails erklärt. »Wenn du sie zum Schleudern bringst, dann haben sie mehr Kraft.«
Mörsergranaten kündigten sich durch das Klimpern von Granatsplittern auf unserem roten Ziegeldach an. Balu bellte draußen wie wild, bis wir sie ins Haus ließen. Vom Range Rover des British Middle East Centre for Arab Studies, allgemein als »die Spionschule« bekannt, hieß es, man habe ihn im Garten vergraben, so lange das Institut wegen der eskalierenden Gefechte geschlossen blieb. Raymond, ein Kommilitone aus meinem Wirtschaftskurs an der AUB, ging nicht mehr zu seiner Arbeit in der Hauptstadt, weil er Angst vor Entführung und einem Tod durch Bomben oder Kugeln hatte. Er wurde in seinem Garten getötet, als er seine Minze goss. Seine sterblichen Überreste wurden in Schuhkartons auf dem Dorffriedhof beigesetzt. Während unserer Zeit im Dorf war er unser erstes und einziges Todesopfer. Später gab es noch mehr Tote, der Schmied, die Krankenschwester, ihr Ehemann und ein älterer Herr, der bei den beiden logiert hatte. Eine ganze Familie, die an der Straße unterhalb Schemlans wohnte, wurde massakriert.
Schemlan, Libanon, und Damaskus, Syrien, Juni 1976
Godfrey und ich falteten den Sarugh zusammen und legten ihn in den Kofferraum des Volvos, an der Radioantenne eine selbstgemachte indische Flagge. Als nächstes kamen Grandma Fanchers blaue Seidenteppiche, ein brauner türkischer Läufer, von Griechen gewebt, bevor sie 1922 von der Türkei vertrieben wurden, und ein rot-schwarzer Belutsch-Gebetsteppich. Das Silber wurde in einen Koffer gepackt und wichtige Dokumente in einen anderen. Godfrey schnallte Marya in ihrem Kindersitz fest. Das Auto quälte sich die grobe Schotterstraße beim Haus hinauf, dann fuhren wir durch Haarnadelkurven zur Hauptstraße, wo wir uns mit Neville und Rosemary mit ihrem alten burgunderroten Peugeot trafen.
Wir folgten ihnen auf der fast verlassenen Schnellstraße nach Damaskus, fuhren einen Umweg um syrische Truppen in Bhamdoun und Sofar, dann über den Gipfel und hinunter ins grüne Bekaa-Tal. Beim Grenzposten von Masnaa machten wir Pause, während saudische Panzer in den Libanon fuhren, eingesetzt von der Arabischen Liga, um die hauptsächlich syrische Interventionsmacht auszudünnen.
Die Durchfahrt nach Syrien verlief ereignislos und die Straße blieb bis Damaskus frei. Neville und Rosemary kümmerten sich dort um ihre Angelegenheiten, während wir Herrn Hayani von der Arbeit in der indischen Botschaft abholten und zu ihm nach Hause fuhren, um die Teppiche und das Silber abzuladen. Die Männer trugen den Sarugh die Treppe hinauf und legten ihn auf Herrn Hayanis Kleiderschrank, die restlichen Teppiche obenauf. Die Koffer mit dem Silber und den Dokumenten wurden unter seinem Bett verstaut.
Wir stellten den Volvo in der Werkstatt unter der britischen Botschaft ab. Einer der Fahrer hatte versprochen, darauf aufzupassen, bis wir uns entscheiden sollten, Libanon zu verlassen. Es war sicherer, das Auto in Damaskus unterzustellen, als es in Schemlan zu lassen; dort hatte es unsere lokale Miliz, damit Außenstehende es nicht klauten, für nächtliche Patrouillen benutzt. Auf Herrn Hayanis Bauernhof aßen wir ein Picknick aus Brot, Käse, Hummus und gebratenen Auberginen; wir waren ganz durchdrungen von der Friedlichkeit der östlichen Ghuta. Dann kehrten wir mit Neville und Rosemary zurück nach Schemlan und zum dumpfen Krachen des Haubitzenfeuers auf dem Hügel über Ainab.
Einige Monate, nachdem wir Schemlan verlassen hatten, wurden die beiden auf der Schwelle ihres Hauses über dem Dorf erschossen.
Schemlan, Libanon, und Limassol, Zypern, 9./10. Juli 1976
Wir packten Schallplatten, Kleidung, Porzellan, Wäsche und Bücher in elf Blechkisten, die Godfrey in seiner Zeit als Indiens undiplomatischster Diplomat für Umzüge benutzt hatte. Viele unserer Freunde hatten ihr Zuhause mit nichts als dem, was sie am Leib trugen, verlassen und alles verloren; so hatten wir entschieden, selbst schwer bepackt auszureisen. In eine Kiste legten wir Sachen, die wir für Prue nach Zypern mitnehmen sollten. Sie war mit ihrer Familie schon ein paar Monate zuvor ausgereist. Als wir in ihre Wohnung beim Sanayeh-Park gingen, um Kleidung und andere Dinge zu holen, die sie uns aufgeschrieben hatte, stießen wir im Wohnzimmer auf den aufgedunsenen Körper Orlandos, ihrer orangeroten Katze. Prue hatte ihr Hausmädchen bezahlt, die Katze zu füttern und das staubige Haus zu putzen. D packte Kleidung und Schuhe in eine für sie reservierte Kiste, zusätzlich zu ein paar Koffern, die uns am Abend vor unserer Abreise aus ihrer Beiruter Wohnung gebracht wurden.
Ich fuhr mein Auto Hadschi rückwärts aus der Garage, den Abhang zur Hauptstraße hinauf und steile Kurven hinunter, hinein in den verwilderten Garten des schönen zweigeschossigen Hauses der Familie Ramez am unteren Ende des Dorfs. Herr Ramez hatte mir angeboten, auf den MG aufzupassen, bis wir zurückkämen – wir hofften, ohne selbst wirklich daran zu glauben, dass wir in drei Monaten wieder da seien, pünktlich zu Beginn von Maryas Schuljahr.
Am Nachmittag wurden George und Leila vom Dorfpriester getraut. Wir feierten mit Wein und Sandwiches im Haus einer ausgelassenen Sunnitin aus der Baydoun-Familie. Sie holte ihre Kalaschnikow hervor und feuerte in die Luft, bis Nimr sie überzeugen konnte, damit aufzuhören. Schießfreudige Bürgerwehren im Tal könnten zurückfeuern, warnte er.
Früh am nächsten Morgen kam Abu Hamzeh im Auto seines Arbeitgebers Mohammad Machnouk, begleitet von einem gemieteten Pickup-Truck mit einem hohen Verdeck aus Segeltuch – die moderne Version eines Planwagens. Wir schoben die Kisten auf die Ladefläche, daneben das antike runde Kupfertablett, das Godfrey seit jeher als Esstischplatte diente. Ich schloss die Fensterläden der Küche, verriegelte die Tür, drehte den Schlüssel im Schloss der schweren hölzernen Haustür und machte einen Schritt zurück, um noch einmal das Haus zu betrachten. Gemeißelte weiße Steinblöcke, ein rotes Ziegeldach, blaue Holzläden, Olivenbäume auf der oberen und der unteren Terrasse, Kletterrosen entlang des weißen Kiespfads. Balu wedelte mit ihrem fedrigen Schwanz und T. S. beklagte sich über seine Gefangenschaft in einer Reisetasche – wir hatten Löcher hineingeschnitten, damit er atmen konnte. Der Schlüssel lag schwer in meiner Hand. Wenn man gezwungen ist, einen Ort zu verlassen, bewahrt man Schlüssel gut auf. Schlüssel belegen Besitz, dass man in ein Haus, an einen Ort gehört. In einer der Kisten lag der Schlüssel zu unserem Haus in Kyrenia, ein großer Schlüssel mit einem Schild, auf dem handgeschrieben »Brookings« stand, der Name des vorherigen Besitzers. Wir mussten nun schon unser zweites Haus hinter uns lassen.
George und Leila kletterten in die Fahrerkabine des Pickups, Godfrey saß neben Abu Hamzeh vorne im Auto, Balu zu seinen Füßen, Marya, D und ich auf der Rückbank. Die Tasche mit T. S. auf meinem Schoß. Abu Hamzeh gab uns ein Zeichen, kurz über seinen Fahrersitz nach vorne zu schauen und hob ein Hosenbein an: darunter, in seiner Socke, eine kleine Pistole, dann das andere Hosenbein, darunter ein Dolch. Er war bereit, uns zu verteidigen – Mohammads uralte, etwas mafiöse Maschinenpistole noch gar nicht miteingerechnet.
Zum Abschied versammelten sich die Nachbarn aus dem Dorf oben an der Einfahrt. Khalil Hitti, ehemals Bibliothekar beim British Council in Beirut, ein schmächtiger Mann mit einer langen spitzen Nase und schütterem weißem Haar, hatte Tränen in den Augen. Wir waren nicht die ersten, die gingen, doch der Aufbruch des Hindus galt als der Anfang vom Ende für Schemlan – zumindest, wie wir es gekannt hatten.
Kurz nachdem wir in das Haus gezogen waren, der erste Neubau im Dorf seit hundert Jahren, hatte Godfrey Khalil gefragt, wie lange es dauern werde, bis wir akzeptiert seien. Entworfen hatte das Haus ein Freund aus Beirut, doch die Bauaufsicht hatte jemand aus dem Dorf, die Maurerund Schmiedearbeiten stammten von anderen Schemlanis und die Schreinerarbeiten von Khalils Cousin. Khalil zog eine Augenbraue hoch und antwortete: »Nun ja, sehen Sie, Herr Jansen, Schemlan wurde von den Hittis im 11. Jahrhundert gegründet. Das Land gehörte den Drusen. Im 15. Jahrhundert kamen dann die Tabibs. Wir Hittis sprechen noch immer nicht mit den Tabibs.« Eine Fehde habe die Spaltung offiziell gemacht, als ein Barbier aus der Familie Tabib bei einem Streit über eine lang vergessene Frage mit einer Schere auf Khalils Vater eingestochen habe.
Unser Abschied sagte mehr über unsere Zugehörigkeit aus, als uns klar war. Über dreißig Jahre später holten George und Leila mich im Mayflower-Hotel in Beirut ab und wir fuhren zu einem Restaurant im Städtchen Brummana, im hauptsächlich maronitisch-christlichen Gouvernement Libanonberg. Ein anderes Paar von der Hitti-Seite des Dorfs, die Farajallahs, stieß dazu. Beim Abendessen erzählte ich Maud Farajallah, was Khalil damals zu Godfrey gesagt hatte. Sie antwortete, ganz ernst: »Nein, nein, ihr Jansens wart immer respektierter als die Tabibs.«
Die Reise in den Süden, nach Tyros, führte uns auf die Küstenstraße, mit Unterbrechungen an zahlreichen Kontrollpunkten der syrischen Armee. Der Verkehr war spärlich, während unser Konvoi entlang der Bananenhaine zu beiden Seiten der Straße fuhr, durch Sidon kurvte und weiter nach Tyros, vorbei an einem unserer Lieblingsrestaurants, »Hassan und Hussein«, wo der Fisch immer frisch und gut zubereitet war. Am Hafen von Tyros erfuhren wir, dass noch am selben Abend ein Frachtschiff nach Zypern auslaufen werde, und gingen sofort ins Büro der Reederei, um die Überfahrt zu buchen, bezahlt mit einem Bündel Reiseschecks von einer vorherigen Zypernreise. Seit mehreren Monaten schon hatten wir Godfreys Gehalt von unserem Konto in Nikosia abheben müssen, Überweisungen an Banken in Libanon waren wegen des Bürgerkriegs ausgesetzt worden. In der Bar am Fuß des Kais gab es statt des libanesischen Almaza und Aziza gelbe Dosen Keo-Bier aus Zypern.
Weil die Kabinen schon alle ausgebucht waren, suchten wir uns einen Platz an Deck auf einem Lukendeckel, und bauten uns aus unseren Kisten eine Art Burg. In der Mitte rollten wir einen Kelim aus und legten das Kupfertablett auf eine Kiste, ein niedriges Tischchen. Ein wenig Zuhause auf der Reise aus dem Kriegsgebiet. Das Abendessen bestand aus einer Flasche Champagner und furchtbaren Sandwiches, Feta mit Corned Beef, die D am Morgen geschmiert hatte, als niemand hingesehen hatte. David Hirst, ein Guardian-Journalist und Mitpassagier, gesellte sich zu uns, um auf George und Leila anzustoßen.
Die seekranke Balu stand gemeinsam mit einem eleganten Irish Setter an der Reling, dann legte sie sich zwischen Godfrey und Marya in unser kleines Fort. Ich öffnete den Reißverschluss der Reisetasche ein wenig und schob meine Hand durch die kleine Öffnung, um T. S. zu beruhigen und ihn davon abzuhalten, maunzend an den Innenseiten der Tasche zu kratzen. Unser Siamkater hasste es, eingesperrt zu sein. Doch so lange er wusste, dass ich in der Nähe war, fühlte er sich sicher. Wir schliefen kaum und warteten auf die Morgendämmerung, die sich schließlich zwischen kühlfeuchten Schichten von Nebel und Wolken vor Limassol auftat. Das Schiff ging außerhalb des Hafens vor Anker, und wir warteten auf die Leichter, die uns mit unseren Kisten in den Hafen brachten. Dort griff sich ein Beamter in perfekt gebügelter weißer Uniform sofort Balus Leine. »Den Hund können Sie nicht mit an Land bringen«, erklärte er. »Aber Sie haben Glück, es ist gerade ein Mann vom Veterinäramt da. Der nimmt ihn mit in den Quarantänezwinger nach Nikosia.« T. S. in der Reisetasche verschwiegen wir, und zum Glück blieb er still. Der Beamte schrieb uns die Telefonnummer der Quarantänestation auf und führte Balu weg, die mit schlaffen Ohren und hängendem Schwanz davontrottete.
Am Einwanderungsschalter verbürgten wir uns für George und Leila: Zypern war überlaufen von mittellosen libanesischen Flüchtlingen. Als ich erwähnte, dass wir schon einmal geflohen waren, aus Kyrenia, winkte ein weiterer Beamter ganz in schickem Weiß unsere Kisten durch, ohne auch nur eine zu öffnen. »Willkommen in Zypern«, sagte er.
*Meister, Professor (Anm. der Übersetzerin)