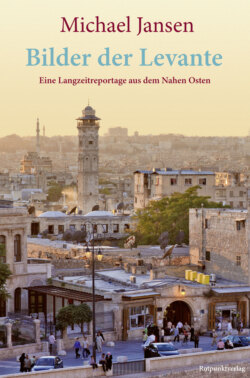Читать книгу Bilder der Levante - Michael Jansen - Страница 8
3Freiheit
ОглавлениеSouth Hadley, Massachusetts, USA, September 1958
Meine Flucht aus Bay City fand per Eisenbahn statt, in Begleitung von Ma, mit dem Reiseziel Mount Holyoke College. Aus einer Kleinstadt in Michigan mit 60’000 Einwohnern ging es in ein Städtchen in Massachusetts, wo nur ein Viertel so viel Menschen lebten. Ma begleitete mich bis in mein Zimmer im Erdgeschoss der Porter Hall, ein altersfleckiges Backsteingebäude mit großen Fenstern, schweren Türen und welligen Linoleumböden. Ich hatte 120 Dollar in der Tasche, mein erstes Journalistengehalt. Ich kaufte mir dafür ein rotes Fahrrad und die Freiheit, mit dem Rad den Campus und das Umland zu durchstreifen, an steilen Hügeln schwer in die Pedale zu treten und wieder hinabzuschießen.
Drei Artikel hatte ich für die Bay City Times geschrieben, über die »irakische Revolution«: Die Monarchie war gestürzt und der junge König Faisal II., sein verhasster Onkel Abd al-Ilah und Nuri al-Said waren ermordet worden. Bis zum Sommer 1957 hatte ich nichts über irakische Politik gewusst. Dann traf ich an der University of Michigan, wo ich ein zweiwöchiges Journalismusseminar für Highschool-Schüler besuchte, eine Gruppe irakischer Studenten.
Schüchtern, 41 Kilogramm leicht, das Haar raspelkurz und um die Zähne eine Spange – so wurde ich gemeinsam mit einer weiteren journalistischen Hoffnungsträgerin namens Kay zu einem Empfang für ausländische Studenten geschickt. Ich sollte interessante Leute für Interviews finden. Kay verschwand sofort. Ich stand wie festgefroren am Rande des Treffens, bis ein großer Mann mit dunklem Haar auftauchte. »Kann ich dir helfen?« Sami, ein gutaussehender, charmanter Iraki mit leichter Fistelstimme, wollte mich seinen Freunden vorstellen. Am nächsten Tag trafen wir uns in der Studentenvertretung. Dort interviewte ich Herrn Fayyad, einen kleinen fülligen Iraker mittleren Alters; Sami unterbrach das stockende Gespräch immer wieder mit gemeinen Witzen über ihn. Ich weiß nicht mehr, was ich aufschrieb oder wie es bei den Seminarleitern ankam. Bevor ich wieder nach Bay City zurückkehrte, traf ich mich noch ein paar Mal mit Sami und seinen Freunden. Mir hatte sich ein kleines Fenster auf Länder geöffnet, die ich bis dahin nicht auf der Landkarte gefunden hätte.
Im Laufe des folgenden Jahres öffnete sich das Fenster noch ein bisschen weiter. Sami, der an der University of Chicago Alte Geschichte studierte und in Michigan nur einen Sommerkurs belegt hatte, schrieb mir, sagte, ich solle den Koran lesen – was ich tat –, und schickte mir ein paar Bücher, um mich aus den Tiefen meiner Ignoranz zu holen.
Nach dem irakischen Staatsstreich vom 14. Juli 1958 fuhr ich zwei oder drei Mal nach Ann Arbor, wo ich wieder Sami und andere Irakis interviewte. Ich entdeckte, dass sie das Ende der Monarchie aus vollem Herzen begrüßten. »Nuri al-Said hat meinen Onkel an einer Laterne in Hillah aufknüpfen lassen«, sagte Sami bei einer dieser Zusammenkünfte. Wir tranken süßen Milchkaffee, den ich eigentlich nicht mochte, aber zu trinken gelernt hatte, und noch jahrelang mit diesen Diskussionen in Verbindung bringen sollte.
Außer den Irakern kamen noch andere zu diesen Treffen, Hussein, ein Kubaner, der in Harvard Arabistik studierte, und George, Ägypter, ein sanfter Mann mit zaghaftem Lächeln, der als Jugendlicher bei den Pyramiden in der Wüste geritten war. Er sollte in jenem Herbst an der Harvard Law School anfangen und überzeugte mich davon, dass Gamal Abdel Nasser unterstützenswert sei.
Die zufällige Begegnung mit einem Mann sollte den weiteren Lauf meines Lebens bestimmen. Als ich ihn fragte, woher er stamme, sagte er: »Palästina.« Wo das liege? »Neben Libanon, Syrien und Jordanien.« Ich habe noch nie von Palästina gehört, sagte ich. »Existiert auch nicht. Die haben mein Land weggegeben.« Aber wenn es nicht existiere, welchen Pass habe er dann? »Einen britischen.« Ich erfuhr nie seinen Namen und sah ihn nie wieder.
»Die haben mein Land weggegeben.« Diese Worte sollten mich viele Jahre lang beschäftigen.
Sobald ich wieder zu Hause war, musste ich mehr über diese Palästinenser herausfinden, deren Land man weggegeben hatte. Ich ging sofort in die öffentliche Bibliothek und fand They Are Human Too von Per Anderson, einen Fotoband über palästinensische Flüchtlinge.
Im Mount Holyoke College belegte ich schließlich Internationale Beziehungen im Hauptfach, mit Schwerpunkt Naher Osten. Als Praktikantin des UNO-Hilfswerks für Palästinaflüchtlinge (UNRWA) reiste ich nach Beirut und eröffnete mir weitere Fenster auf die Region, in der ich mein Leben verbringen sollte.
Beirut, Libanon, 10. Juni 1961
Vollgepumpt mit Impfungen gegen Typhus über Paratyphus bis zu Gelbfieber und von Ma mit einer Rolle Toilettenpapier ausgestattet, kam ich nachmittags am Beiruter Flughafen an. Man hatte mich durch halb Europa geschickt. Das Reisebüro in Bay City, unvertraut mit Reisezielen im Nahen Osten, hatte mich in eine TWA-Maschine nach London Heathrow gesetzt. Von dort sollte es mit Air India nach Beirut weitergehen. Aber es gab keinen Air-India-Flug nach Beirut. Jemand vom Bodenpersonal fuhr mich schnell über das Rollfeld zu einem Alitalia-Flug nach Rom. Das Flugzeug war fast leer und ich durfte in der ersten Klasse sitzen. Von Rom flog ich weiter nach Athen, stand dort vor dem kleinen Flughafengebäude auf dem staubigen Rollfeld und wartete auf das Flugzeug nach Beirut. Griechenland war damals noch zu großen Teilen vom Zweiten Weltkrieg verwüstet und nicht der Touristenmagnet, zu dem es später wurde.
Ich war verwirrt und aufgeregt, es war meine erste Reise außerhalb der USA. Obwohl ich nicht zur vereinbarten Zeit in Beirut ankam, wartete ein Fahrer des UNWRA so lange am Flughafen, bis ich eintraf. Er brachte mich in Windeseile zum Mayflower-Hotel in der Hamrastraße und sagte, der UNRWA-Bus würde mich am Montagmorgen um halb acht abholen.
Mein Zimmer lag im zweiten oder dritten Stock, sehr einfach eingerichtet, zwei Betten, ein Stuhl und ein Tisch. Der Duschkopf hing im Badezimmer in der Mitte der Decke, und wenn ich duschte, wurden Toilette und Waschbecken nass. Ich schlief bis sechs Uhr und wachte von einem quäkenden Hupen auf, ein Eselgespann mit Ölfass. Draußen wimmelte es vor geschäftigem Treiben. Verkäufer schoben Karren voller Obst und Gemüse vor sich her und riefen ihre Waren aus, Auberginen, Bohnen, Kartoffeln, Erdbeeren und Loquats – kleine ovale orangefarbene Früchte, die ich noch nie gesehen hatte. Die meisten Einkäufer waren Männer mit Körben, manche in Anzügen und Krawatten, bereit fürs Büro, andere in T-Shirt oder Unterhemd und Pyjamahose. Auf der gegenüberliegenden Straßenseite ließ eine Frau in geblümtem Hauskleid einen Korb mit einer Bestellliste an einem Seil vom Balkon hinunter. Noch im Schlafanzug holte ich mir den Stuhl auf den Balkon hinaus und setzte mich, gebannt vom morgendlichen Straßentheater.
Beim Frühstücksbuffet unter einer Markise auf dem Hoteldach traf ich meinen ersten »Expat«: Genevieve Maxwell, eine nicht mehr ganz junge Dame mit der Energie eines Teenagers. Sie war gebürtige US-Amerikanerin und schrieb eine Gesellschaftskolumne für den Beiruter Daily Star. Wer ich sei, was ich in Beirut mache, ob ich gern der Foreign International Group beiträte, die sie gerade organisiere, um junge Leute zusammenzubringen. »Libanesen sind nicht erlaubt«, sagte sie entschieden. Da wir uns in Libanon befanden, erschien mir das wenig gastfreundlich, und ich zögerte, in der Woche drauf zum ersten Treffen der Foreign International Group auf dem Hoteldach zu gehen. Schließlich ging ich doch hin und nahm Saud mit, der mal mit einer Kommilitonin vom Mount Holyoke College ausgegangen war. Wir waren uns zufällig auf der Rue Bliss vor der AUB über den Weg gelaufen; er besuchte gerade seine Familie in Beirut. »Er ist Saudi und geht in Amherst zur Universität«, sagte ich zu Maxwell, als ich ihn vorstellte. Ihr Verbot betraf keine Araber per se, nur Libanesen. Ich ging nie wieder zu einem ihrer Treffen.
Das Hotel war mit 20 Dollar die Nacht zu teuer für mich, und ich musste eine andere Bleibe finden. Ich glaube, Genevieve Maxwell schlug das Frauenwohnheim der Universität vor; dort kam ich unter. In jenem Sommer schloss ich dort meine ersten wirklichen Freundschaften. Amerikaner waren damals noch beliebt, dank US-Präsident Dwight Eisenhower, der 1957, nach dem desaströsen Suezkrieg Frankreichs, Großbritanniens und Israels gegen Nasser Druck auf Israel ausgeübt hatte, seine Truppen von der ägyptischen Sinaihalbinsel abzuziehen. Amerikanische Mädchen galten als exotisch.
Nach einem unglücklichen Start mit einer Iranerin, die jeden Morgen anderthalb Stunden zum Zurechtmachen brauchte, teilte ich mir ein Zimmer mit Sawsan, einer syrischen Archäologin. Sie hatte einen Sommerkurs belegt, ging die Dinge gemächlich an und stand spät auf. Ich musste derweil früh am Tor zur Medizinischen Fakultät stehen, um den UNRWA-Bus zu erwischen. Mein Frühstück bestand meist aus einem Käse-Tomaten-Sandwich oder Schokoladenkeks und einer Tasse Instantkaffee mit Milch aus der UNRWA-Kantine.
In jenem Sommer führte ich zwei Leben. In einem ging ich durch palästinensische Flüchtlingslager, um herauszufinden, welche Art von Berufsausbildung sich Palästinenserinnen in meinem Alter wünschten. Ich sprach kein Arabisch, war aber mit einheimischen Mitarbeitern unterwegs, die dolmetschten. Wir fuhren in Jeeps herum und liefen zwischen Rohbetonblocks – Flüchtlingsunterkünfte – durch Gassen gestampfter Erde, in der Mitte offene Abwasserkanäle. Von allen Seiten bedrängten uns Kinder, die neugierig mein kurzgeschnittenes Haar betrachteten. »Jeanne d’Arc«, sagten manche und dachten wohl an den Fünfziger-Jahre-Film Die heilige Johanna mit Jean Seberg. Die Erwachsenen waren ausnahmslos gastfreundlich und großzügig, kratzten die letzten Teeblätter aus ihrer Dose zusammen oder leerten ihre Zuckerdosen, um Tässchen türkischen Kaffees zuzubereiten.
Jerusalem, Juni 1961
Muhammad Jarallah holte mich mit dem Auto vom Flughafen in Amman ab, wir kauften im Zentrum im »Automatique« Sandwiches und machten uns auf den Weg in die Heilige Stadt. Muhammad war ein sehr großer Mann mit breitem Lächeln und grau geflecktem Haar und Bart, der UNRWA-Pressesprecher für Jordanien, das Westjordanland und Ostjerusalem. Als wir von der Hochebene ins Jordantal hinabfuhren, wurde die Luft, die durch die Autofenster hereinwehte, drückend heiß. Muhammad schlug vor, einen Zwischenstopp für ein Bad im Toten Meer einzulegen. Es ist der tiefste Punkt der Erdoberfläche; die Temperatur betrug über vierzig Grad Celsius, und im silberfarbenen, glatt-glitschigen Salzwasser war es nicht viel kühler. Wir liehen uns grobgestrickte Badekostüme von einem Stand und schwebten hoch auf der Wasseroberfläche, achtsam, kein Wasser in Augen, Ohren oder Mund zu bekommen.
Ich hatte ein Zimmer in der »Casa Nova« gebucht, einer franziskanischen Pilgerpension in der Altstadt, gleich bei der Grabeskirche. Das Zimmer war klein und schlicht. In einem schönen Refektorium gab es mittags an einer langen Tafel, an der lauter Mönche und Gäste Platz nahmen, Suppe und Brot. Nach dem Essen spazierte ich durch die Altstadt, blickte schüchtern in Geschäfte, die Gewürze, Süßigkeiten und Kleidung verkauften, und bewunderte reich bestickte traditionelle palästinensische Gewänder, die an Drähten quer über metallenen Ladentüren hingen. Bei diesem oder einem späteren Besuch kaufte ich ein altes Gewand aus einem goldfarbenen, satinartigen Stoff, verziert mit der besonderen Bethlehemer Plattstickerei. Die alte Ladenbesitzerin schenkte mir noch einen Kopfschmuck und ein Armband dazu, und ich zahlte sechs jordanische Dinar. Heute ist ein solches Gewand Hunderte wert.
Abends kam Muhammad mit einem Freund namens Aref vorbei, einem Journalisten, und wir fuhren nach Ramallah. Dort trafen wir uns mit Elise, einer Sekretärin im Beiruter UNRWA-Hauptsitz, die mich als Dolmetscherin auf meinen ersten Exkursionen begleiten sollte. Wir aßen in einem Gartenrestaurant unter Lichterketten Mezze von einem Dutzend kleiner Teller, und tranken dazu Bier und Arak – eine meiner ersten Begegnungen mit dem starken Anisschnaps. Als wir um Mitternacht nach Jerusalem zurückkehrten, waren die ersten Tore der Altstadt schon geschlossen, und wir mussten durch den Suk Khan al-Zeit waten, wo gerade das Kopfsteinpflaster gereinigt wurde. Die Tür der Casa Nova war verschlossen und der Pförtner wachte trotz allem Klingeln nicht auf.
Muhammad nahm mich mit ins Haus seiner Familie im Viertel Scheich Dscharrah. Er gab mir einen grün-weiß-gestreiften Pyjama und sein Zimmer, und ging selbst nach oben, um im Zimmer seiner Schwester zu schlafen. Ich lag lange wach und fürchtete mich vor der Missbilligung seines turbantragenden Vaters, einem ehemaligen Jerusalemer Mufti, der mich von einem Ölporträt an der gegenüberliegenden Wand unverwandt anstarrte.
Am nächsten Morgen frühstückten wir mit dem Untermieter der Familie, einem italienischen Ingenieur. Er arbeitete an der Renovierung des prächtigen Felsendoms auf dem muslimischen Gelände des Tempelbergs in der Altstadt, auf Arabisch al-haram asch-scharif, das edle Heiligtum. »Kommen Sie doch heute Nachmittag vorbei und schauen sich an, wie die Arbeit vorangeht«, sagte er. Auf dem Boden rund um das Heiligtum stapelten sich wunderbar bemalte iranische Kacheln, viele noch aus dem 16. Jahrhundert. Sie wurden durch neue Kacheln ersetzt, wie vom jordanischen König Hussein beauftragt, dem Hüter des Felsendoms, der al-Aksa-Moschee und anderer Gebäude auf dem Gelände. Der Ingenieur bot mir ein paar Kacheln an. Dummerweise lehnte ich ab, denn ich machte mir Sorgen, mein Gepäck könnte zu schwer für den Rückflug werden.
Im Jordantal, in den Hügeln über Jericho, besuchte ich das Flüchtlingslager Akbat Dschaber. 30’000 Menschen lebten dort. Ein älterer Mann in Kaftan und mit Kopfputz verwarf den Plan des UNRWA, Mädchen eine Berufsausbildung zu bieten. Er selbst hatte sieben Kinder, Jungen und Mädchen, alle mit Universitätsabschluss. Palästinensern galt Bildung als einziger Weg zu einem anständigen Leben.
Die meisten Bewohner des Lagers waren im heißen Sommer 1948 angekommen, als die israelische Untergrundarmee sie aus Dörfern nördlich von Haifa und aus den Städten Ramla und Lod vertrieben hatte, auf Befehl Jitzchak Rabins, damals Einsatzleiter der Eliteeinheit Palmach. Die Bewohner Ramlas wurden in Bussen bis an die arabischen Frontlinien transportiert, die unter der Kontrolle der jordanischen Arabischen Legion standen. Die Bevölkerung von Lod wurde Mitte Juni vertrieben und musste zu Fuß bis nach Jericho gehen, wo Anwohner erschöpfte Familien mit Trinkwasser und Nahrung versorgten. Viele Menschen starben auf dem Weg. Meine Studienfreundin Dyala Husseini, damals sieben oder acht Jahre alt, erzählte mir später von ihrer Ankunft. Es waren Tausende von Männern, Frauen und Kindern, wundgelaufen, dehydriert, mit Sonnenstich. Unterwegs hatten sie in Olivenhainen und auf Feldern geschlafen. Viele starben an Austrocknung oder Unterkühlung.
Damaskus, Syrien, Juli 1961
Mein anderes Leben verbrachte ich mit meinen neuen Freunden und Bekannten von der Universität. Sawsan hatte mich in ihren Freundeskreis eingeführt, zu dem auch Dyala Husseini gehörte. Wir gingen an den Strand, schwammen, aßen getoastete Schinken-Käse-Sandwiches aus arabischem Fladenbrot und tranken Bier mit Limonade. In dieser noch immer konservativen Gesellschaft gingen junge Frauen und Männer statt in Paaren stets zu dritt oder zu viert aus. Wir fühlten uns wohl ohne die Herausforderung eines Tête-à-Tête. Wir trugen Baumwollkleider mit schwingenden Röcken und Absatzschuhe, die an den Zehen drückten; die jungen Männer trugen Anzüge und Krawatten. Sie luden ein, und sie bezahlten. Wir gingen zu Fuß oder nahmen Taxis, bezahlten für eine Fahrt ins Zentrum 25 libanesische Piaster, eine Viertel-Lira (0,33 Dollar), und jeder, der unterwegs zustieg, beteiligte sich.
Eines Morgens nahm ich mit Sawsan ein Taxi nach Damaskus. Wir fegten die breite Schnellstraße ins Libanongebirge hinauf, durch Dörfer, in denen Libanesen und Ausländer vor der feuchten Beiruter Hitze Zuflucht suchten und den Sommer in pinienbeschatteten Villen verbrachten. Im Städtchen Chtaura im Bekaa-Tal hielten wir an der laiterie der ehemaligen Bauchtänzerin Badia Masabni und kauften zusammengerolltes Fladenbrot mit Labneh. An der Grenze wurde wegen Visa kein großes Aufheben gemacht; Libanon und Syrien waren – fast – ein Land. Kurz vor Damaskus, einer Oase mit dem Anspruch, die älteste Stadt der Welt zu sein, fuhren wir vorbei an Plantagen voller Aprikosen und Pfirsiche und an Hainen uralter Olivenbäume mit silbrig grünen Blättern.
Die Stadt selbst war ganz anders als Beirut. Damaskus war eine Metropole voller Alleen und schöner französischer Kolonialgebäude, Springbrunnen und Parks. Die grelle Sommersonne schien die neueren Viertel außerhalb der Stadtmauern ausgeblichen und ihnen einen gold-beigen Ton verliehen zu haben, ganz anders als Beiruts kräftige Rosa-, Gelb-, Blau- und Grüntöne vor dem Hintergrund des türkisfarbenen Mittelmeers. Als wir im Taxi zu Sawsans Elternhaus fuhren, sagte sie: »Guck mal, die Straßen. Viel sauberer als in Beirut. Und das schon bevor mein Vater Gouverneur wurde.«
Mit ihrem Vater Rashad hatten Sawsan und ich zuvor in Beirut im »Blue House« bei der Universität zu Mittag gegessen. Er war ein gutaussehender, kräftiger Mann mit dunklem Haar und Schnurrbart, geistreich und charmant. Als Chef der syrischen staatlichen Ölgesellschaft war er in den Jahren 1939 bis 1941 mit seiner britischen Ehefrau ins trostlose Deir ez-Zor in den Osten gezogen. Später wurde er zum Manager eines Unternehmens in Damaskus ernannt, dann zum Gouverneur der Provinz Damaskus, zum Minister für öffentliches Bauwesen und Telekommunikation und schließlich zum Landwirtschaftsminister.
Das Haus der Jabris war ein bescheidener Bungalow mit einem Garten, den Sawsans Mutter Pearl liebevoll pflegte. Sie hatte Sawsans Vater in Manchester kennengelernt, als er dort Bauingenieurwesen studierte.
Sawsan wollte mir die ganze Stadt zeigen. Sie bestand darauf, in einem Nachtklub zu Mittag zu essen, »Les Caves du Roy«, wenn ich mich recht erinnere – wie der Klub in Beirut, wenn auch anders buchstabiert. Der Raum war dunkel, das Essen ausgezeichnet, wie eigentlich überall in Damaskus. Für junge Frauen ohne Begleitung war ein Mittagessen akzeptabel, ein nächtlicher Ausflug nicht. Nachmittags spazierten wir in der Altstadt umher und besuchten das staubige Mausoleum Saladins, des arabischen Befehlshabers, der im 12. Jahrhundert die Kreuzfahrer aus Palästina vertrieben hatte.
An jenem oder dem darauffolgenden Abend, oder am nächsten, gingen wir zu einer Party in die ungemein schicke Wohnung eines Freundes von Sawsan. Die Eltern waren nicht da und wir uns selbst überlassen. Alkohol gab es keinen, aber viel Essen, aufgetragen auf einer Tafel mit feiner Leinentischdecke. Wir hörten arabische Musik und The Green eaves of Summer, eine Ballade, die in jenem Sommer beliebt und aus irgendeinem Grund zu einer Erkennungsmelodie des algerischen Befreiungskriegs geworden war. Ein Lied, das überall und immer wieder gespielt wurde. Die Gespräche waren politisch. Es ging um Nasser, Syriens und Ägyptens Zusammenschluss zur Vereinigten Arabischen Republik, unterstützt von Sawsan und ihren Freunden, die entweder Nassers Bewegung Arabischer Nationalisten angehörten oder mit ihr sympathisierten. Sie hofften, die arabische Welt werde so neuen Antrieb bekommen und sich gegen Israel und die ehemaligen Kolonialmächte, die weiterhin in die arabische Innen- und Regionalpolitik eingriffen, zusammentun.
Montags fuhr ich mit Leuten vom UNRWA-Büro aus Damaskus ins Flüchtlingslager von Jarmuk, dem größten außerhalb Palästinas. Dort lebten etwa 17’000 Flüchtlinge in dürftigen, eingeschossigen Betonsteinhäusern mit Flachdächern, von ihnen selbst entlang unbefestigter Pfade erbaut. Am nächsten Tag begleitete Sawsan mich in die Lager von Homs. Wir besichtigten den berühmten Uhrenturm von Homs. Dem Mann, der im kommenden Jahr am Mount Holyoke College Arabisch unterrichten sollte, schrieb ich eine Postkarte. In Hama aßen wir in einem Restaurant bei den antiken Wasserschöpfrädern, den Norias. Von den erhaltenen Wasserrädern hieß es, sie seien im 12. und 13. Jahrhundert von der von Saladin gegründeten Dynastie der Ayyubiden erbaut, wobei die ursprünglichen Räder schon sehr viel früher in Betrieb waren. Manche seiner Anhänger verglichen Nasser mit dem verehrten Saladin.
South Hadley, Massachusetts, USA, 28. September 1961
Abends berichteten die Fernsehnachrichten über einen Armeeputsch in Syrien und den Austritt des Landes aus der Union mit Ägypten. Nasser hatte sich verrechnet, als er zögerlich darauf eingegangen war, sich mit Syrien zusammenzuschließen. Dort nahm die Macht der kommunistischen Partei zu, was in der syrischen Baath-Partei, der einflussreichen Wirtschaftsschicht des Landes und bei den westlichen Mächten Ängste schürte. Nasser hatte zugestimmt, doch zu Bedingungen, die Syriens Herrscher zurückgewiesen hatten. Trotzdem hatte man die Dokumente über den Zusammenschluss am 22. Februar 1958 unterzeichnet.
Nasser hatte in seinem Umgang mit der Union eine Reihe schwerer Fehler begangen. Er ging hart gegen Kommunisten vor, löste Syriens politische Parteien auf und verbot der Armee jegliche Beteiligung an der Politik. Seine eigene Nationale Union wurde zur einzigen Partei beider Flügel des neuen Staats. Doch das 600-köpfige Parlament war stark zu Ägyptens Gunsten gewichtet, mit 400 Abgeordneten, gegenüber 200 für das viel kleinere Syrien. Zudem erließ Nasser Verfügungen zu Verstaatlichungen, ohne die syrische Regierung zu konsultieren.
Wenngleich die Kommunisten in Syrien und Ägypten ausgemerzt waren, betrachteten Jordanien und Libanon die Vereinigte Arabische Republik als existenzielle Bedrohung. Die westlichen Mächte empfanden die Union und den populären Nasser, der 1948 gegen die Gründung Israels gekämpft hatte, derweil als Gefahr für den jüdischen Staat. Als der libanesische Präsident Camille Chamoun im Mai 1958 eine Verfassungsänderung anstrebte, um eine zweite Amtszeit anzutreten, rebellierten die sunnitischen und drusischen Gemeinden in Libanon und wendeten sich an Nasser, der damit in Libanons ersten Bürgerkrieg involviert wurde. Westliche Bedenken gegenüber Nassers Absichten wurden weiter geschürt, als am 14. Juli 1958 in Irak die Armee die Monarchie stürzte, von Großbritannien nach dem Ersten Weltkrieg eingesetzt. US-Präsident Eisenhower entsandte Truppen nach Beirut, um eine friedliche Machtübergabe sicherzustellen, obwohl die USA gar nicht in der Lage waren, Chamoun im Amt zu halten.
Gelöst wurde die Krise durch die UN-Gesandten Rajeshwar Dayal und den norwegischen General Odd Bull, Mitglieder einer Mission, die überwachen sollte, dass keine Menschen und Waffen über die syrische Grenze nach Libanon geschmuggelt wurden. Mit Godfreys Hilfe, damals indischer Chargé d’Affaires in Beirut, bastelten sie einen Bericht zusammen, der eine Verwicklung der Vereinigten Arabischen Republik bestritt, und verhinderten somit eine größere Krise. General Fuad Schihab, für die zerstrittenen Fraktionen Libanons als Kandidat annehmbar, wurde zum Präsidenten gewählt und übernahm die Präsidentschaft von Chamoun zu Ende von dessen Amtszeit im September 1958.
Die außenpolitischen Abenteuer der Vereinigten Arabischen Republik hatten zusammen mit innenpolitischem Druck in Syrien zu einem Putsch geführt, den sowohl die Baath-Partei als auch Mitglieder der wirtschaftlichen und politischen Elite des Landes unterstützten. Einige Wochen nach dem Zusammenbruch der Union erhielt ich einen bitteren Brief von Sawsan; sie schrieb, ihr Vater habe in der Auflösung der Union eine tragende Rolle gespielt.
South Hadley, Massachusetts, USA, Januar 1962
Nach den Weihnachtsferien, kurz nach meiner Rückkehr ans College, erhielt ich einen Brief vom Ausbildungsleiter des UNRWA, Dr. Van Diffelen. Er schrieb über das Krachen von Schüssen an Silvester, als jüngere Offiziere gemeinsam mit der Syrischen Sozialen Nationalistischen Partei (SSNP), der ersten panarabischen politischen Partei, geputscht hatten. Ziel der säkularen SSNP, 1932 von Antun Sa’ada gegründet, war ein Zusammenschluss der Länder des Fruchtbaren Halbmonds. Die Offiziere wurden sofort festgenommen und SSNP-Mitglieder reihenweise zusammengetrieben, was dem Putschversuch ein Ende setzte. Unter den Verhafteten waren Freunde, die ich in meinem Beiruter Sommer kennengelernt hatte.
Beirut, Libanon, 10. September 1962
Genau ein Jahr nach meiner Abreise kehrte ich nach Beirut zurück. Zum Abschluss am Mount Holyoke College hatte ich mir eine Fahrkarte dritter Klasse auf einem Transatlantikliner gewünscht, und die Weiterfahrt vom Heimathafen bis nach Libanon. Die Queen Frederica, 1926 vom Stapel gelaufen, fuhr unter griechischer Flagge. Im Zweiten Weltkrieg war sie als Truppentransporter eingesetzt und später mehrfach als Passagierschiff modernisiert worden. Mit sieben anderen Frauen teilte ich mir eine Doppelkabine mit vier Stockbetten. Eine der Frauen, eine betagte Griechin, legte sich ins Bett, sobald wir an Bord waren, und blieb dort, bis wir sechs Tage später Athen erreichten. Unter meinen Kabinengenossinnen war eine gutgelaunte Griechin mittleren Alters, Sophia, die mir Volkstänze beibrachte, und ein paar andere Studentinnen. Zu Anfang der Reise saßen wir bei griechischem Essen und Retsina nur zu dritt im Speisesaal der dritten Klasse. Der Rest war oder fühlte sich zu krank zum Essen.
Als ich an der Reling stand, lernte ich drei junge Italo-Amerikaner aus Chicago kennen, Franco, Mario und einen großen harten Kerl, dessen Namen ich nicht mehr weiß. Sie waren Exhäftlinge und wurden nach Sizilien abgeschoben, bevor sie wieder das Gesetz brächen und mit langen Gefängnisstrafen rechnen müssten. Ich fragte Franco, warum er ins Exil geschickt werde. Er sagte, er habe seine Freundin verprügelt, denn sie habe einen anderen gehabt, während er einsaß. Franco rechtfertigte sich und seine Freunde damit, dass sie in gewalttätigen Familien in gewalttätigen Vierteln aufgewachsen seien, und somit Problemen immer mit Gewalt begegneten. Ich antwortete, er habe eine Wahl. Er müsse nicht in einem Kreislauf gefangen bleiben, er könne daraus ausbrechen. Als ich erzählte, dass ein recht bedrohlicher Grieche mir und den anderen Frauen aus meiner Kabine im Schiffsinneren nachstellte, sagte Franco seinem kräftigen Kollegen, der ein Messer in der Socke trug, er solle uns begleiten und sicherstellen, dass wir heil ankämen. Als wir in Palermo anlegten, schüttelten wir uns die Hand. Franco gab mir eine Anschrift. Ich schickte ihm eine Postkarte aus Beirut und erwartete keine Antwort. Doch er schrieb zurück, mit kindlicher Handschrift, in einem Englisch voller Rechtschreibfehler, aber mit schönem Ausdruck.
Ich erreichte den Hafen von Beirut als alleinige Passagierin auf einem kleinen griechischen Schiff. Nach Zwischenstopps in Alexandria und Limassol auf dem Weg von Piräus wollte ich noch schneller ankommen und drängte den Maat zur Eile, bis wir schließlich so früh ankamen, dass Sawsan und Constantine, die mich abholen sollten, noch nicht da waren. Ich bestellte mir und meinen zwei Schrankkoffern ein Taxi zum Tor der Medizinischen Fakultät; wie ich die Koffer die lange Treppe hinunter zum Frauenwohnheim für Doktorandinnen bekam, weiß ich nicht mehr. Mein Zimmer hatte eine fantastische Aussicht über das Mittelmeer, azurblau unter klarem Himmel. Wieder war ich der Enge von Bay City entflohen.
Trotz des Putschversuchs an Silvester erschien Libanon als land of hope and glory. Es war weiterhin ein Zufluchtsort für talentierte und regimekritische Araber aus der gesamten Region, besonders aus den direkten Nachbarländern, Palästinenser, die im ersten arabisch-israelischen Krieg aus ihrer Heimat vertrieben worden waren, und Syrer auf der Flucht vor chronischer politischer Instabilität. Meine Kommilitonen waren Iraner, Jordanier, Libanesen, Palästinenser, Ägypter, Iraker, Afghanen, Pakistanis, Syrer, Zyprer und vereinzelt Amerikaner, von denen einer von der CIA dafür bezahlt wurde, seine Mitstudenten auszuspionieren.
An der AUB belegte ich Graduiertenkurse bei Professoren aus den USA, Syrien und Palästina. Ich arbeitete am Institut für Wirtschaftsforschung als wissenschaftliche Mitarbeiterin von Yusif Sayigh, einem Palästinenser mit syrischem Pass, der ein Buch über die politischen und sozialen Komponenten wirtschaftlicher Entwicklung schrieb. Weil die Büros des Instituts noch eine Baustelle waren, arbeiteten die meisten Angestellten vorläufig im riesigen Eingangsbereich der West Hall oder anderen freien Räumen. Yusif und mir wurde ein kleines Zimmer in der Jessup Hall zugeteilt, im Institut für Politikwissenschaft. Dass wir überall verstreut waren, beeinträchtigte keineswegs den Enthusiasmus der Professoren und ihrer Mitarbeiter, das wirtschaftliche »Durchstarten« der arabischen Länder zu dokumentieren.
Auch politisch gab es große Erwartungen. Araber waren optimistisch, weil der junge Präsident John F. Kennedy während seiner Zeit im Senat arabische Selbstverwaltung und ein Ende der Einmischung in arabische Angelegenheiten gefordert hatte. Gegenüber dem charismatischen Nasser war Kennedy, statt seinen Sturz zu planen, bereit zur Annäherung.
Beirut war eine lebenslustige Stadt. Wir schwammen am Strand der AUB und im Sporting Club im Schatten der berühmten Taubenfelsen, die sich unter Raouche aus dem Meer erheben, und tranken im »Dolce Vita« auf der anderen Seite der Strandpromenade Negronis oder türkischen Kaffee. In den Kinos liefen die neuesten Filme, und in den Boutiquen gab es Chanel, Jacques Fath, Givenchy und Mary Quant. Rashid, ein tunesischer Freund, schaffte das Unmögliche: Er brachte mir das Tanzen bei, hauptsächlich im »Les Caves du Roy«. Dort gingen wir hin, wenn einer von uns gerade Geld hatte, und Aldo, der Barkeeper, servierte uns Erdbeeren mit Sahne und viel zu teure Champagnercocktails. Irgendwann beschuldigte man ihn, ein Agent für die ein oder andere neugierige ausländische Macht zu sein, niemand wusste, welche. Ein tatsächlicher Spion, der britisch-sowjetische Doppelagent Kim Philby, kam zur Weihnachtsfeier der Sayighs, ein paar Wochen vor seiner misslungenen Entführung durch den britischen Geheimdienst. Er tauchte schließlich in Moskau wieder auf.
Ich hatte genug vom Leben im Wohnheim und zog in eine Zweizimmerwohnung in der Nähe der Rue Hamra, der Westbeiruter Hauptstraße. Zwei Monate später zog ich von dort weiter in eine Wohnung im vierten Stock ohne Fahrstuhl, auf einem Hügel über Raouche, im Dachgeschoss mit einem Streifen Meeresblick zwischen dem Shell-Gebäude und anderen Wolkenkratzern. Auf einem grünen Hügel unter meiner großen Terrasse grasten Ziegen, Glöckchen um den Hals, damit der alte Schäfer wusste, wenn eine sich davonmachte.
August 1963
Eines Morgens traf ich mich mit Usama Khalidi auf dem Campus, um den Besitzerwechsel seines vierzehn Jahre alten MG TC amtlich zu machen. Die Mechaniker nannten das Auto »Hadschi«, weil es so oft die Pilgerfahrt in ihre Werkstatt machte. Schon seit Monaten bewunderte ich Hadschi. Verlassen stand er beim Tor der Medizinischen Fakultät. Usama Khalidi, ein Professor für Biochemie, wollte den Oldtimer verkaufen, seit er ein Familienauto hatte. Als wir zur Behörde am Stadtrand fuhren, wo der Besitzerwechsel registriert und das Auto den méchanique, den Straßentauglichkeitstest, bestehen musste, erklärte mir Khalidi das geheimnisvolle Innenleben der Gänge; ich kannte bis dahin nur Automatikgetriebe. Ich sah zu und hoffte, alles verstanden zu haben. Auf dem Rückweg in die Stadt wurde ich ins kalte Wasser geworfen: Mitten im Mittagsverkehr hielt Khalidi vor seinem Wohngebäude, stieg bei laufendem Motor aus und sagte, ich solle nun übernehmen. Ich kletterte über das Getriebe und lernte das Schalten sofort. Knirschende Fehler vergab Hadschi. Soweit ich weiß, fuhr ich in Beirut als erste Frau einen Sportwagen. Viele sahen in Hadschi, einer Schönheit in British Racing Green, nur ein altes Auto, zu gestrig für Bewunderung.
Ich fuhr mit Hadschi durch ganz Beirut und wählte Routen, wo der Hall zwischen den Gebäuden am schönsten dröhnte. Weil Parkplätze im Zentrum schwer zu finden waren, nahm ich zum Einkauf auf dem Souk al-Franj die kleine rote Tram. Dort kaufte ich Käse bei Herrn Mamoud, einem kleinen runden Mann in engem beigem Overall, der im Sommer 250 Sorten Käse führte und im Winter 500, und frisches warmes Brot aus der Bäckerei direkt vor dem Suk.
Gaza, Ostern 1963
Neville Kanakaratne hatte mich zu einer Galaveranstaltung von UN-Friedenstruppen nach Gaza eingeladen, aber ich bekam für die Tage keinen Urlaub. So fuhr ich stattdessen Mitte April, in den Osterferien, für ein paar Tage hin. Wieder saß ich in einem UNRWA-Flugzeug, einer altertümlichen DC-3, in einem Schalensitz mit einer Decke gegen die Kälte, denn das Flugzeug war nicht luftdicht. Ich hatte im »Marna House« reserviert, einer kleinen Pension, geführt von Margaret Nassar, einer schönen Palästinenserin mit Geschäftssinn. Seit meinem ersten Besuch in Gaza wohnte ich immer dort. Für Besucher im Auftrag der UNO und Journalisten ist das Marna House in Gaza stets ein zweites Zuhause geblieben, auch wenn es an der Meeresfront inzwischen modernere Hotels gibt.
Das Abendessen mit den indischen Truppen war ein prachtvolles Ereignis im indischen Offizierskasino, geschmückt mit den Battle Honours des Regiments, Flaggen und Silber – glänzenden Kerzenleuchtern, Bechern, Tellern und Tabletts. Liebevoll poliert. Hinter jeder Person an der langen Tafel stand ein festlich uniformierter jawan, der Speisen und Getränke reichte.
Am nächsten Morgen organisierte Neville für mich eine private Akrobatikshow indischer Soldaten. Auf einem kleinen Sandhügel am Rand des Camps wurde ich mit einem Glas Bier in einen Korbstuhl gesetzt. Neville stand neben mir, ein verschmitztes Funkeln in den Augen, auf der anderen Seite stand Patrick, ein korpulenter Feldwebel irisch-indischer Abstammung. Auf der Ebene unter uns kletterten indische Soldaten einen eingefetteten Pfahl hinauf, machten Purzelbäume, überschlugen sich und stellten ihre Beweglichkeit und ihr Können zur Schau, während ich wie die junge Queen Victoria, leicht verschämt und leicht amüsiert, ihren Übungen zusah. Königinnen erwarten eine solche Behandlung, bloße Sterbliche nicht.
Bay City, Michigan, USA, 18. September 1961
Die Fernsehnachrichten meldeten den Tod von UNO-Generalsekretär Dag Hammarskjöld und fünfzehn Mitarbeitern bei einem Flugzeugabsturz über Nordrhodesien. Sie waren auf dem Weg zu Verhandlungen um einen Waffenstillstand zwischen den Kriegsparteien im Kongo gewesen. Verzweifelt rief ich gemeinsame Freunde in New York an und fragte: »War Neville im Flugzeug?« Niemand wusste es. Meine Eltern standen daneben und wunderten sich, was mich mit diesem Ereignis im fernen Afrika verbinden könnte.
Als Hammarskjölds Rechtsberater hätte Neville im Flugzeug sitzen sollen. Doch man hatte ihn nicht mitgenommen, weil er kein Französisch konnte, die Sprache beider Konfliktparteien in der ehemaligen belgischen Kolonie Kongo. Nevilles mangelnde Französischkenntnisse hatten ihm das Leben gerettet.
Wir hatten uns am Mount Holyoke College kennengelernt. Neville, ein kluger, eloquenter Delegierter der ceylonesischen UN-Gesandtschaft, hatte vor dem Club für Internationale Beziehungen – dessen Präsidentin ich später wurde – eine Vorlesung über die Entkolonialisierung Afrikas gehalten. Er war ein zierlicher Mann mit feinen Zügen und schütterem grauen Haar, prominenter Nase und großen, dichtbewimperten Augen. Er kam gern in das Frauencollege, wo ihn Studentinnen umringten und viele ihn bewunderten. War ich in New York, wo ich bei einem Freund in einer Dienstmädchenwohnung in Sutton Place wohnte, führte Neville uns zum Mittag- oder Abendessen aus. Bei seinen ceylonesischen Freunden zu Hause probierte ich zum ersten Mal Essen vom indischen Subkontinent. Das Fisch-Pickle trieb mir Tränen in die Augen, aber ich entwickelte trotzdem ein Faible für scharfes südasiatisches Essen.
Neville hatte mir eine Karte zur Eröffnung der UN-Generalversammlung 1960 geschenkt und setzte mich am richtigen Eingang zur riesigen Halle ab. Drinnen stand ich plötzlich neben Fidel Castro, der gerade andere Delegierte begrüßte. Von meinem Sitz in der ersten Reihe, eigentlich für hochrangige Beamten bestimmt und nicht für Collegestudenten, hatte ich einen guten Blick auf das Geschehen und die Anwesenden. Die Hauptrede an jenem Tag war auf Serbokroatisch, gehalten vom jugoslawischen Staatschef Tito. Viele Delegierte schlichen zwischendurch hinaus, aber ich traute mich nicht.
Im Frühjahr 1961 lud mich Neville zu seiner Abschiedsparty in seine New Yorker Wohnung ein. An dem Tag sollte ich in einem Seminar bei der eindrucksvollen Ruth Lawson, Professorin für Internationale Beziehungen, ein Referat halten. Ich zerbrach mir den Kopf, ob ich das Referat halten oder zur Party gehen sollte, und entschied mich schließlich für die Party. Wir trafen uns in kleiner Runde in Nevilles Wohnung. Er hatte eine Auswahl scharfer Gerichte gekocht, die er sich während seines Studiums in Cambridge selbst beigebracht hatte. Die meisten Gäste waren weiblich, viele den Tränen nahe; junge Frauen schätzten Neville, der schwul war, als guten Freund und wunderbaren Begleiter über alles. Niemand von uns wusste, dass er aus der Delegiertenlounge in die Räume des Generalsekretärs in den geheiligten 38. Stock ziehen sollte.
Am Morgen nach der Party ging ich in das winzige UNRWA-Büro, tief im Inneren des UN-Gebäudes. Ich wollte wissen, ob es schon Neuigkeiten zu meiner Praktikumsbewerbung für den Sommer im Beiruter Hauptsitz des Hilfswerks gab. Molly, die zuständige Angestellte, sagte: »Du hast Glück, der Generalkommissar ist gerade da. Ich schau mal, ob er Zeit hat.« John Davis sagte mir, dass manche in Beirut mich ablehnen würden: »Eine junge Amerikanerin könnte ein Problem sein.« Doch er entschied, mich als erste Praktikantin und Freiwillige des Hilfswerks anzunehmen. »Sie müssen aber für drei Monate hin. Für sechs Wochen lohnt sich die Reise nach Beirut nicht.«
Wäre ich nicht zu Nevilles Abschiedsparty gegangen, wäre mein Leben anders verlaufen. Zur Sicherheit hatte ich eine zweite Praktikumsbewerbung eingereicht, beim UN-Hochkommissariat für Flüchtlinge in Genf. Den Platz bekam eine Kommilitonin. Professorin Lawson war krank geworden und hatte das Seminar gar nicht halten können. Von den beiden Praktika, die den Kurs erheblich bereicherten, war sie begeistert. Eine einfache Sache, diese Entscheidung.
Neu-Delhi, Indien, 1959
Nach dem ersten libanesischen Bürgerkrieg kehrte Godfrey nach Neu-Delhi zurück, ausgezeichnet mit dem Zedernorden der Republik Libanon. Seine Rolle in der Beendigung des Konflikts wurde von Ministerpräsident Jawaharlal Nehru im Parlament erwähnt. Er bewarb sich um eine weitere Entsendung in den Nahen Osten, doch stattdessen wurden ihm Washington oder Paris angeboten.
Als Godfrey zum Frühstück in Jawaharlal Nehrus Residenz eingeladen war, verspätete er sich wegen des Verkehrs in Delhi um ein paar Minuten und wurde ins Esszimmer geführt. Der Ministerpräsident, seine Tochter Indira Gandhi und Lady Edwina Mountbatten saßen schon am Tisch. Der Diener fragte leise, wie viele Eier Godfrey gerne hätte. »Eins.« Die anderen drei warfen sich einen Blick zu, ein diskretes Lächeln auf den Lippen.
Einige Jahre später fragte Godfrey Indira Gandhi, warum sie bei seiner Frühstücksbestellung gelächelt hätten. Sie antwortete, sie hätten oft gewettet, ob ein Gast eine Einei- oder Zweieierperson sei. »Bei Ihnen lagen wir richtig.«
Was seine Entsendung anbetraf, erzählte Godfrey, dass »Herr Nehru sich entschuldigt« und gesagt habe, er könne »die Bürokraten im Außenministerium nicht umstimmen.«
Godfrey verließ den diplomatischen Dienst. Kurze Zeit arbeitete er in Delhi für den National Herald, herausgegeben von Indira Gandhis Ehemann Feroze Gandhi. Dann wurde er Regionalkorrespondent für den indischen Statesman, kehrte Indien somit wieder den Rücken und zog zurück in die Beiruter Wohnung, in der er schon als Diplomat gelebt hatte, zufrieden, nun keine diplomatischen Empfänge mehr besuchen und eine Krawatte tragen zu müssen. Wäre er Diplomat geblieben, hätten wir uns nie kennengelernt.