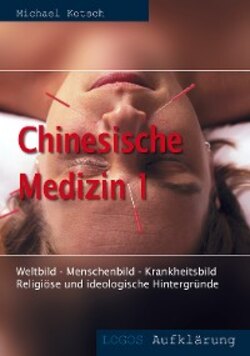Читать книгу Chinesische Medizin 1 - Michael Kotsch - Страница 5
Оглавление1. Chinesische Medizin in Westeuropa
1.1. Geschichte der TCM in Westeuropa
Die frühesten Nachrichten über die TCM erreichten Westeuropa mit den Berichten franziskanischer und vor allem jesuitischer Missionare im 16. und 17. Jahrhundert. Neben diesen ist uns insbesondere der niederländisch- ostindische Schiffsarzt Andreas Clyder namentlich bekannt, der sich schon früh um den Import heilkundlicher Kenntnisse aus China bemühte. Die fremdartigen und skurril anmutenden Techniken der TCM wurden neugierig registriert, nicht aber für die eigene medizinische Praxis übernommen. Im 18. und 19. Jahrhundert fanden besonders die philosophischen und religiösen Überzeugungen der Chinesen Anklang bei europäischen Gelehrten. Dazu gehörten Wolff, Lessing, Goethe und Schopenhauer, vor allem aber französische Denker, die durch den Handel und das entstehende französische Kolonialreich in Asien eine intensivere Beziehung zu China entwickelten. In Frankreich gab es um 1840 eine regelrechte Akupunkturmode. Dort wurde 1937 auch die älteste bestehende Gesellschaft für Akupunktur gegründet. Trotz zahlreicher weiterer nationaler Akupunkturgesellschaften kam es erst durch die Veröffentlichungen von James Reston über seine Erfahrungen mit der Akupunktur in China in der New York Times zu einer breiten öffentlichen Diskussion um die Akupunktur. Um die sich anschließende wissenschaftliche Aufarbeitung der traditionellen chinesischen Medizin in Deutschland bemühten sich insbesondere der Berliner Medizinprofessor Franz Hübotter, der Frankfurter Medizinhistoriker Willy Hartner und Professor Paul Unschuld. 1979 hielt die WHO in Peking einen Kongress über Akupunktur, Moxibustion und Akupunkturanalgesie ab, auf dem eine Liste von fast 100 Krankheiten vorgestellt wurde, gegen die sinnvoll auch Akupunktur eingesetzt werden könne.
1.2. Technikkritik und Alternative Heilmethoden
Weitreichendere Bedeutung erhielt die TCM erst durch die oben genannte Skepsis gegenüber der Wissenschaft, insbesondere gegenüber der modernen Medizin. Der seit dem 19. Jahrhundert angefachte Forschrittsoptimismus erweckte den Eindruck, alles sei durch die Macht von Forschung und Technik beherrsch-und erreichbar. So war es nur eine Frage der Zeit, wann diese Erwartungen enttäuscht werden mussten. Diese neue Skepsis gegenüber den Aussagen und Möglichkeiten moderner medizinischer Wssenschaft wird bis heute immer wieder von Vertretern alternativer Heilkonzepte vorgebracht, um die Notwendigkeit der eigenen Methode zu begründen. Hier einige diesbezügliche Beispiele: Theodor Meyer Steinhagen schreibt: „Die Medizin verhindert in vielen Fällen das Sterben, macht aber nicht gesund. Sie bewirkt den Zustand des chronischen Leidens.”2 Arthur Jores wiederum beruft sich auf „Untersuchungen Hamburger Kassenärzte, wonach etwa die Hälfte aller Patienten unter chronischen Krankheiten litten. Weitere 30 bis 40 Prozent seien Neurotiker, so dass nur 10 bis 20 Prozent jener Krankheiten übrigbleiben, gegen die allein die westliche Medizin über zuverlässige Behandlungsmethoden verfüge. Sie sei, so Jores, verglichen mit dem Krankengut des praktischen Arztes, weitgehend zu einer Medizin der seltenen Krankheiten geworden.”3 Thure von Uexküll schließt sich dieser Beurteilung moderner Medizin an: „Am Ende weiß der Patient, worunter er gewiss nicht leidet; aber was ihm wirklich fehlt, erfährt er nicht. Die moderne Medizin ist für den Kranken längst zu einem Milchstraßensystem geworden, in dem er sich hoffnungslos verirrt - und in dem mit zunehmender Spezialisierung die kompetenten Berater und Helfer des Kranken unweigerlich aussterben”4.
Diese Bedenken gegenüber der Praxis und den Möglichkeiten moderner Medizin sind natürlich nicht aus der Luft gegriffen, sondern beruhen durchaus auf offensichtlichen Missständen. Auch Christen sollten diese Begrenzungen ehrlich sehen und keiner falschen Absolutsetzung westlicher Medizin das Wort reden. Eine darüber hinausgehende Skepsis gegen den methodischen Atheismus und den weitgehenden Ausschluss seelischer und geislicher Zusammenhänge bei Erkrankungen ist für den Christen ebenfalls geboten.
1.3. Wer heilt, hat recht?
Wenn nun vorbehaltloses sicheres Wissen sowohl bei der klassischen Medizin als auch bei der Komplementärmedizin nicht gefunden werden kann, wird fälschlicherweise häufig daraus die Konsequenz gezogen, dass die wirksame Methode auch die richtige sei: „Wenn Patienten geholfen werden kann, ist jedes medizinische Verfahren gerechtfertigt.”5 Das gilt auch insbesondere für die TCM: „Es gibt einen zuverlässigen Bewertungsmaßtab, den man an die fernöstliche Heilkunde auch von außen anlegen kann: ihren therapeutischen Erfolg.”6 „So gilt im Grunde das Prinzip: „Wer heilt, hat recht”. Viele Heilverfahren sind in der TCM allein unter dem Eindruck, dass ein bestimmtes Heilverfahren unter den und den Umständen wirkt, therapeutischer Bestandteil eines ganzen Kanons von Heilstrategien in der Heilkunde geworden, ohne dass man gewusst hätte, warum im Einzelfall eine heilende Wirkung erzielt wird.”7 Da für den Christen allerdings nicht nur Erfolg oder das positiv zu erreichende Ziel Maßstab richtigen Handelns ist, sondern die Ordnungen, Werte und Maßstäbe Gottes, wie sie in der Bibel niedergelegt sind, kann er sich diesem Gedankengang nicht anschließen. Das ist im Bereich der Medizin genausowenig angebracht wie beim Hausbau, wo ich den Banküberfall zur Finanzierung meines Hauses ablehnen muss, weil das zweifellos gute Ziel über einen biblisch nicht akzeptablen Weg erreicht werden soll.
So erfasst der Schweizer Arzt und Psychologe C.G. Jung Tragweite und mögliche Gefahr umfassender Aufnahme östlichen Gedankenguts scharf: „Man bedenke, was es heißt, wenn der praktische Arzt, der ganz unmittelbar mit dem leidenden und darum empfänglichen Menschen zu tun hat, Fühlung mit östlichen Heilsystemen nimmt! So dringt der Geist des Ostens durch alle Poren ein und erreicht die wundesten Stellen Europas. Es könnte eine gefährliche Infektion sein, vielleicht ist es aber auch ein Heilmittel.”8