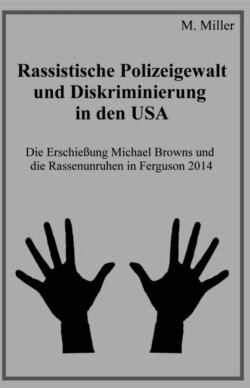Читать книгу Rassistische Polizeigewalt und Diskriminierung in den USA - Michael Miller - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Die Armut und Segregation in den USA
ОглавлениеAuch wenn für viele Außenstehende die Gewalt überraschend kam, für viele afroamerikanische Bewohner waren die gewaltsamen Krawalle nur ein Ventil über die nun unbändige Wut gegenüber weißer diskriminierender Unterdrückung der schwarzen Mehrheit in Ferguson. Die US-amerikanische Öffentlichkeit ist am nächsten Morgen erschüttert. Schnell werden Erinnerungen der letzten Rassenunruhen von 1991 nach dem Rodney King Fall wach, die vielen Menschen das Leben kosteten und etliche Großfeuer hunderte Gebäude in Los Angeles zerstörten oder beschädigten. Damals war das Heartland, der Mittlere Westen der USA, von Unruhen weitestgehend verschont geblieben. Auch während der Bürgerrechtsbewegung der 1960er Jahre blieben St. Louis und die umliegenden Gemeinden ruhig.
In der heutigen Zeit hat St. Louis, eine knapp 320.000 Einwohner großen Stadt, sowie ihre umliegenden Gemeinden noch immer mit der Immobilienkrise zu kämpfen. Eine Stadtflucht der Bewohner aus St. Louis in die Vororte lässt die Immobilienpreise in einigen Vierteln von Ferguson sogar wieder steigen und auch die Zwangsversteigerungen von Immobilien sind rückläufig. Doch profitieren davon zumeist nur die Siedlungen der überwiegend weißen Bewohner. Die Jobs kommen nach der Wirtschaftskrise nur sehr langsam nach St. Louis und Umgebung zurück. In Ferguson entstanden in den letzten Jahren viele neue Geschäfte, darunter Bars, Restaurants und Bekleidungsgeschäfte. Der Optimismus, die Krise endlich hinter sich gelassen zu haben, steckte die meisten Bewohner von Ferguson an. Doch im Vergleich zur größeren Stadt St. Louis liegen die Durchschnittseinkommen weit auseinander. Lag das durchschnittliche Familieneinkommen in St. Louis 2012 bei 75.000 US-Dollar, lag es im selben Jahr in Ferguson nur bei 44.000 US-Dollar. Nach der letzten Volkszählung dümpelte die Arbeitslosigkeit in Ferguson bei rund 20 Prozent, während sie im gesamten Bundesstaat Missouri bei 10,7 Prozent lag.
Sehr deutlich werden solche Zahlen, wenn Armutsberichte der US-Regierung veröffentlicht werden. Demnach leben über 45 Prozent der afroamerikanischen Kinder in Missouri in Armut. Eine solch hohe Rate, die fast jedes zweite schwarze Kind betrifft, ist für Missouri, wie auch für die restlichen USA eine blamierende Tatsache. In der Schule fallen diese Kinder später ebenfalls aus dem Raster, wie eine US-Studie belegt. Unter den mehr als 16.200 landesweiten Schulsuspensionen sind fast 6.200 schwarze Kinder, obwohl sie prozentual einen geringeren Bevölkerungsanteil ausmachen. Erschreckend kommt hinzu, dass rund 30 Prozent aller afroamerikanischen Schüler im Laufe ihres Lebens verhaftet werden. Selbst während des Studiums machen afroamerikanische Studenten rund 27 Prozent aller Verhaftungen auf dem Campus aus, obwohl sie nur 16 Prozent der Studentenschaft darstellen. Viele gehen direkt durch kriminelle Taten von der Schulbank in den Strafvollzug. Für eine Wirtschaftsmacht wie den USA ist das ein extrem kostspieliger Faktor. Experten warnen seit Jahren, dass dadurch kriminelle Karrieren geschaffen werden, aus denen es später kein Entkommen gibt. Hilfsangebote für Ex-Häftlinge und Aussteigerprogramme für Kriminelle sind in den USA rar. Einen Schulabschluss schafft nur rund die Hälfte aller afroamerikanischen Schüler in Ferguson. Landesweit sind es 52 Prozent, während es in Missouri sogar 56 Prozent sind. Diese erstaunlich hohe Anzahl an jungen Bürgern ohne Schulabschluss kostet dem US-amerikanischen Staat später in Form von sozialstaatlichen Transferleistungen viel mehr, als notwendige Investitionen in die Verbesserung von Bildungsmöglichkeiten.
Die Armut in Ferguson ist allgegenwärtig. Die Schulen im Bezirk sind unterfinanziert und haben einen schlechten Ruf. Ein geplanter Zusammenschluss von vier Schulbezirken soll Schulschließungen aufgrund hoher Finanzmangel verhindern. Doch das in der Verfassung verbriefte Recht auf Bildung wird am Beispiel Ferguson nur schwer umgesetzt. In den mehrheitlich afroamerikanischen Gemeinden fehlt es an Lehrern und Sozialarbeitern. Die Ausstattung der Schulen grenzt an absoluter Sparsamkeit und die Instandhaltung wird auf das Nötigste heruntergefahren. Von klein auf haben die afroamerikanischen Kinder einen Nachteil zu erdulden, der ihnen im späteren Leben weitere Nachteile auf dem Arbeitsmarkt einbringen wird. Ohne grundlegende Bildung fehlt es den zukünftigen Erwachsenen an Jobchancen und sozialem Aufstieg.
Eine Ungleichbehandlung fängt schon in der Finanzierung der Schulen an. In Missouri gibt es unterfinanzierte Schulbezirke, die pro Schüler mit knapp 6.400 US-Dollar auskommen müssen, während wohlhabendere Schulbezirke das Dreifache des Budgets, nämlich knapp 19.000 US-Dollar pro Schüler, verwenden können. Auch die Lehrer erhalten in den Schulbezirken unterschiedliche Gehälter, sodass reichere Schulbezirke eine bessere Auswahl an Lehrerbewerbungen haben. Die Leistungsstärke der Schüler spiegelt sich klar in der finanziellen Ausstattung der Schulen wider.
Michael Brown ging in einem der schlechtesten Schulbezirke von Missouri zur Schule. Rund 90 Prozent der Kinder und Jugendlichen erhalten staatliche Unterstützungen, wie in Form von kostenlosem Mittagessen. Es ist ein Grundfehler im US-amerikanischen Bildungssystem, dass gerade die Armenviertel die wenigsten finanziellen Zuwendungen erhalten. Die soziale Ungleichheit wird damit von Grund auf in der Gesellschaft fest zementiert.
Schwarze Bewohner profitieren von den wirtschaftlichen Aufschwüngen ihres Landes nicht mehr. Das Wirtschaftswunder unter dem damaligen Präsidenten Bill Clinton kam bei den Armen größtenteils nicht an. Es machte nur die wohlhabender, die schon gut bezahlte Jobs hatten, auch unter den Schwarzen. Der Unterschied im Vermögensaufbau zwischen Weißen und Schwarzen wird in den mittleren Haushaltseinkommen zudem sehr deutlich. Weiße US-Bürger verdienten 2014 in den gesamten USA durchschnittlich rund 59.000 US-Dollar, während Afroamerikaner nur knapp 30.500 US-Dollar verdienten. Schwarze Familien leben mit einem Anteil von 30,6 Prozent viel häufiger in Armut als weiße Familien mit 9,2 Prozent. Sie beziehen auch häufiger Sozialhilfe und Lebensmittelmarken als weiße Familien. Auch die Kindersterblichkeit ist unter afroamerikanischen Kleinkindern um 3,6-mal höher als bei weißen Kindern. Das liegt vor allem an der schlechten und teuren Gesundheitsversorgung in den USA, die Obama in seiner zweiten Präsidentschaftszeit mit seiner Gesundheitsreform verbessern wollte. Denn gerade die schlechter verdienenden Afroamerikaner haben zumeist keinen Versicherungsschutz, wie sie zumeist besser bezahlte Jobs haben. Die Diskussion um Polizeigewalt und Rassismus in den USA dreht sich zunehmend auch um Themen, wie Wohlstandskluft, Bildung und Diskriminierung auf den lokalen Arbeitsmärkten. Afroamerikanische Bürgerrechtler fordern schon länger einen verbesserten Zugang zu besser bezahlten Jobs, die durch Diskriminierung den qualifizierten Afroamerikanern vorenthalten sein sollen.
Die Teilung der USA in einen wohlhabenden weißen und einen armen schwarzen Bevölkerungsanteil wurde schon von einer Kommission im Jahr 1968 befürchtet. Der von der „Kerner Kommission“ veröffentlichte und viel Aufmerksamkeit erzeugende Bericht warnte vor einer „permanenten Teilung unseres Landes in zwei Gesellschaften“. Darin würde sich der afroamerikanische Bevölkerungsanteil von seiner größtenteils prekären finanziellen Situation nicht selbst befreien können und Generationen von Sozialhilfeempfängern den Weg ebnen. Schon in den 60er Jahren des 20. Jahrhunderts war eine wirtschaftliche Segregation zwischen beiden Bevölkerungsanteilen deutlich zu erkennen gewesen, auch wenn die bürgerlichen Rechte stückweise bei den Afroamerikanern verbessert wurden. In den Ballungszentren der USA wurde in den letzten Jahrzehnten laut dem Pew Research Center die Lücke zwischen den Einkommen von Armen und Reichen immer größer. Dieser Trend hat sich auch in der Trennung der Wohnverhältnisse widergespiegelt. Heute gibt es mehr Stadtviertel und Gemeinden mit großer Armut und hoher Kriminalität sowie reichen Vororten mit wenigen Delikten als noch vor 30 Jahren. Während die schwarze Bevölkerung zu Beginn des 20. Jahrhunderts überwiegend in Slums lebte, wohnt der überwiegende Teil der schwarzen US-Bürger heute in Getto ähnlichen Sozialbausiedlungen. Zwischen 1980 und 2010 stieg der Anteil der bildungsfernen und verarmten Bezirke in den USA von 12 Prozent auf 18 Prozent an. Die Tendenz ist weiter steigend.
Ferguson, mit seinen rund 21.000 Einwohnern, ist ein durch Segregation geteilter Ort. Etwa zwei Drittel der Bewohner sind Afroamerikaner. Rund ein Viertel der Bewohner lebt unterhalb der Armutsgrenze, im Bundesstaat Missouri leben rund 15 Prozent der Bewohner unterhalb der staatlich festgelegten Armutsgrenze. Die starke Segregation ist durch die Gentrifizierung, dem Wegzug der weißen gut saturierten Mittelschicht und dem Zuzug der afroamerikanischen finanzschwachen Bewohner, die aufgrund der sinkenden Mieten angezogen wurden, entstanden. Diese Entwicklung läuft seit den letzten Jahrzehnten und verschärft sich, sobald ein Bezirk „kippt“ und überdurchschnittliche Armut auch die Kriminalität anzieht.
Eine Veränderung der Bevölkerungsstruktur in so kurzer Zeit ist für US-amerikanische Städte und Gemeinden nicht ungewöhnlich. Zwischen 1950 und 1960 wuchs die Bevölkerung von Jefferson County, das südwestlich von St. Louis liegt, um 75 Prozent an. Es war vor allem die weiße Arbeiterschicht, die hier durch die Industrie angelockt wurde. Zur Jahrtausendwende war Ferguson schon eine Stadt mit einem Anteil von 52 Prozent an afroamerikanischen Bewohnern sowie einem Anteil weißer Bewohner von nur noch 45 Prozent. Vierzehn Jahre später ließ die sogenannte „white flight“, die Abwanderung der weißen Bewohner und der Zuzug von Afroamerikanern, die Bevölkerung von Ferguson weiter segregieren, auf nun 67 Prozent Schwarze und 29 Prozent Weiße. Innerhalb von nur zehn Jahren wuchs die afroamerikanische Gemeinde um mehr als 150 Prozent an und sie konzentrierte sich nur auf bestimmte Wohngebiete. Mehr als 90 Prozent aller 230.000 afroamerikanischen Bewohner verteilen sich im gesamten St. Louis County auf Gemeinden, die in oder um Ferguson liegen. In diesen Ballungsgebieten wird wiederum der Kreislauf aus schlechter Bildung, hoher Kriminalität, wenigen Jobs und schlechter Perspektive fortgesetzt. Aber auch Einwanderer aus China, Bosnien und Indien kommen verstärkt nach St. Louis. Diese multikulturelle Gemeinschaft verbirgt jedoch eine soziale Spaltung der Bewohner, weil sie alle eine selbstgewählte Form der Isolation wählen. Es sind Parallelgesellschaften, die sich gegenseitig misstrauisch beäugen.
Die Segregation ist jedoch nicht auf „natürliche“ Weise entstanden. Viele Hausbesitzer in Ferguson sind hochverschuldet, weil ihre Hypotheken nicht den wahren Preis ihrer Häuser widerspiegeln. In der Vermögensbewertung kommen die Bewohner von Ferguson nur auf ein Drittel des Wertes im Vergleich zu den Bewohnern von St. Louis County. Niedrige Mieten ziehen finanzschwache Mieter an. Doch liegen die Gründe der ausgeprägten Segregation auch in der Lokalpolitik sowie diskriminierenden Maklerpraktiken, die kinderreiche zumeist schwarze Familien von innerstädtischen großen Wohnungen fernhalten. Vielmehr werden schon in finanzschwachen Stadtteilen weitere Sozialbauapartments gebaut, die zu einem Sog weiterer Armutszuzüge führen. Dieses Ungleichgewicht an sozialer Durchmischung von finanzstarken und finanzschwachen Bewohnern lässt solche Stadtviertel kippen und die Kriminalität markant anschwellen.
Der Bundesstaat Missouri selbst wird noch von der konservativen weißen Mittelschicht geprägt, die mit großer Mehrheit Abtreibungsgegner sind und den Gewerkschaften nahe steht. Es sind zumeist bodenständige, stark religiöse Weiße, die keine Gemeinsamkeiten mit den afroamerikanischen Vorstadtbewohnern sehen. Zumal die Kriminalität laut Statistik und nach dem „Gefühl“ der weißen Bewohner überwiegend aus den ärmeren afroamerikanischen Gemeinden kommt.
Auch der Stadt St. Louis hat die langanhaltende Wirtschaftskrise stark zugesetzt. Viele Häuser stehen leer, Ruinen säumen manche Straße. Nicht wenige Bewohner sehen die viertgrößte Stadt des Bundesstaats Missouri im Niedergang. Ihre Vorstädte und Gemeinden haben ebenfalls mit Arbeitsplatzverlusten und Wegzug ihrer Mittelschicht zu kämpfen. Der Staat investiert vielerorts nicht mehr in die Infrastruktur, wie in Straßen und Brücken. Im öffentlichen Nahverkehr fehlen Gelder für Instandhaltungen und dem Ausbau von neuen Strecken in urbane Gebiete. Auch wenn sich der Blick durch die Rassenunruhen auf St. Louis und Ferguson richtet, so werden die wirtschaftlichen Grundprobleme der Bewohner nach wie vor übersehen, von denen viele weiter von der Hand in den Mund leben werden.
Ferguson und andere Ballungsräume, die überwiegend von verarmten Familien und kriminellen Gangs bewohnt werden, sind tickende Zeitbomben in den USA. Neben den Großstädten wie Detroit, Los Angeles und Oakland sind es nun auch die kleinen Vorstädte, die gewaltsame Unruhen auslösen können. Denn rund 40 Prozent der landesweit 46 Millionen Armen der USA leben in Vororten von größeren Städten und Metropolen. Sie alle verbindet eine hohe Arbeitslosigkeit, grassierende Obdachlosigkeit, Gangkriminalität und polizeiliches Fehlverhalten. Und ihre ethnische Zusammensetzung besteht überproportional häufig aus afroamerikanischen und hispanischen Bewohnern. In der Kommunalpolitik haben sie jedoch aufgrund ihrer unterdurchschnittlich schwachen Wahlbeteiligung keine Interessenvertretung und werden daher schlichtweg ignoriert. Diese Unterrepräsentanz ihrer Belange spiegelt sich negativ in allen Lebensbereichen ihres Wohnumfeldes wider. Vom sozialen Wohnungsbau und öffentlichen Nahverkehr über die Schulbildung bis hin zu einfachen Infrastrukturmaßnahmen werden diese Stadtviertel übergangen. Die Ausgrenzung dieser Gemeinden geht soweit, dass ihre Bewohner keine direkte öffentliche Anbindung an Gewerbegebiete und arbeitsplatzintensive Regionen haben. Vielmehr erhalten die Regionen Fördermittel und Subventionen, die schon zu den wohlhabenderen Regionen zählen und eine hohe Wahlbeteiligung aufweisen. Und dort leben zumeist weiße Bewohner.
Michael Browns Lebenslauf gleicht dem eines typischen afroamerikanischen US-Bürgers aus einer Sozialbausiedlung. Brown wohnte in einem Neubauviertel mit überwiegend einkommensschwachen Familien. Die Armut sowie die Gewaltbereitschaft unter den Jugendlichen sind hoch. Der Cannabiskonsum unter den arbeitslosen Jugendlichen, die in Gruppen in den Wohngebieten lungern und nicht selten die Bewohner belästigen, ist höher als im US-Durchschnitt. Wohnungseinbrüche, Autodiebstähle, Drogenhandel, Gewaltdelikte wie schwerer Raub, Körperverletzung mit Todesfolge sowie Vergewaltigungen kommen in den Armutsrevieren der Vorstädte überproportional häufig vor. In den dicht bewohnten Häuserschluchten sind Konflikte vorprogrammiert, die nicht selten auch mit der Schusswaffe ausgetragen werden. Gemeindepfarrer beklagen den fehlenden Zusammenhalt in diesen Gemeinden, doch wollen die Bewohner zumeist in den Sozialbauwohnungen häufig nur wieder wegziehen.
Die Polizei hat solche Gebiete speziell auf dem Radar. Ein ungeschriebenes Gesetz sagt aus, dass jeder Bewohner dieser Sozialsiedlungen ein potentieller Krimineller sein könnte. Die Jugendarbeitslosigkeit in den Sozialbausiedlungen ist sehr hoch und viele Jugendliche werden aufgrund fehlender Einkommensmöglichkeiten kriminell. Die vorhandenen Stereotype werden dann von den Polizisten nur bestätigt und auf alle Bewohner dieser Stadtviertel übertragen. Damit ist der Grundstein der Diskriminierung der gesamten überwiegend afroamerikanischen Bewohner gelegt. In den schwarzen Sozialbausiedlungen ist der Anteil von legalen und illegalen Waffenbesitzern hoch und ein erschossener männlicher Jugendlicher ist fast schon keine Nachrichtenmeldung in der Lokalpresse mehr wert. Die Gangkriminalität ist ein ernsthaftes Problem, doch der überwiegende Teil der schwarzen Jugendlichen hält die Polizei für den eigentlichen Feind. Nicht wenige halten sie für die größte Bedrohung ihrer Gesundheit und nicht die eigentlich bedrohlich grassierende Gangkriminalität. Die regelmäßigen grundlosen Kontrollen von Autofahrern und das Filzen von Schülern auf dem Weg zur Schule oder auf dem Heimweg durch die Polizei, macht sie zu einem großen Feindbild. Es suggeriert den Bewohnern, dass sie ständig mit Kontrollen zu rechnen haben und beobachtet werden. Wer ständig von den Strafverfolgungsbehörden als möglicherweise kriminell eingestuft wird, ohne jemals in Konflikt mit dem Gesetz gekommen zu sein oder nur aufgrund des Tragens von szenetypischen Kleidungsstücken, wie dem Hoodie, wird einfach kein Verständnis für diese Polizeitaktiken entwickeln. Vielmehr lernen die Kinder und Jugendlichen von der Polizei, sie zu meiden und Informationen an sie nicht weiterzuleiten. Selbst bei den Ermittlungen im Fall Michael Brown, gibt Justizminister Holder während der Bundesuntersuchungen zu, dass viele afroamerikanische Zeugen nicht mit der Polizei kooperieren wollen und ihre Aussagen verweigern. Sie haben einfach zu viel Misstrauen und Hass gegenüber der Polizei.
Denn die Polizei tritt in den Armenvierteln anders auf, als in wohlhabenderen Bezirken. Das „stop and frisk program“ ist eine solche Vorgehensweise. Aus dem fahrenden Polizeiauto werden Fußgänger ausgewählt und zum Anhalten aufgefordert. Bei sogenannten „sprung outs“ springen mehrere Polizeibeamte plötzlich aus dem anhaltenden Streifenwagen aus und durchsuchen und befragen Bewohner ohne ersichtlichen Grund. Dabei wird mit knappen und bissigen Befehlen die Person zur Kooperation gezwungen und mit mehreren Polizisten in kugelsicheren Westen samt Schusswaffen umstellt. Nicht selten werden durchsuchte Bewohner an die Wand gedrückt oder bei verdächtigen Funden gezwungen sich auf den Boden zu legen. Nach einer solchen anlasslosen Prozedur bleiben viele Betroffene mit einem mulmigen bis wütenden Gefühl zurück, dass die Polizei nicht der Freund und Helfer ist und Afroamerikaner nur Bürger zweiter Klasse sind. Viele Anwohner selbst können von Erfahrungen über Rucksackkontrollen mit anschließender Entleerung des Inhalts auf der Straße und das Abtasten von Kleidungsstücken berichten. Und diese Kontrollen können alle Afroamerikaner betreffen, ob Mann oder Frau, Schulkinder oder Greise. Bei einer Gruppe von schwarzen Jugendlichen gehen die Polizisten bei einer solchen Aktion davon aus, dass der eine oder andere etwas vor der Polizei zu verbergen hat.
Viele Afroamerikaner haben im Freundeskreis oder in der Familie von Fällen zu berichten, in denen Schwarze auf den Boden geworfen, teilweise mit Tasern attackiert und festgenommen wurden, nur aufgrund der Frage nach dem Grund der Kontrolle. Schläge und Tritte sind auch nach der Verhaftung durch Polizeibeamte keine Seltenheit. Es ist ein hohes Maß an Gewalt durch Polizeibeamte dokumentiert. Beschwerden und Klagen gegen Polizeibeamte häufen sich seit Jahren. Strafrechtliche Ermittlungen müssen die Polizisten jedoch oftmals nicht fürchten. Vielmehr erhält der Unbescholtene eine Strafermittlung wegen Widerstands gegen die Staatsgewalt und es droht ein hohes Bußgeld.
Schwarze Fahrradfahrer werden häufiger als weißer Radler durch die Polizei angehalten und darauf geprüft, ob das Fahrrad als gestohlen gemeldet wurde. Schwarze Jugendliche werden von weißen Polizisten mehr dem kriminellen Spektrum zugeordnet als weiße Jugendliche. Und so tritt die Polizei in den schwarzen Siedlungen auf, als befände sie sich in einem feindlichen Gebiet. Eine Zusammenarbeit mit der Polizei findet in den Sozialbausiedlungen daher häufig nicht statt. Bei den sogenannten „drive by shootings“, also dem Schießen aus fahrenden Autos heraus auf verfeindete Gangmitglieder, Passanten oder Gebäuden, fehlt es oftmals an Zeugen, die ihre Aussage der Polizei geben wollen, obwohl die Tat auf einer belebten Straße passiert sein könnte.
Während weiße Bewohner auch in Armenvierteln eine Kontrolle durch die Polizei seltener fürchten müssen, werden schwarze Bewohner proportional häufiger einer Kontrolle unterzogen. Bekannt ist diese Ungleichbehandlung als „white privilege“, die auch eine Ignoranz oder Unwissenheit der weißen Bevölkerung gegenüber der alltäglichen diskriminierenden Behandlung der Schwarzen beschreibt. Weiße Eltern müssen sich weniger Sorgen um ihre Kinder machen, als dass diese von weißen Polizisten erschossen werden könnten. Das für Weiße hochgelobte verfassungsmäßige Recht auf Waffenbesitz könnte für einen Afroamerikaner bei einer Polizeikontrolle einem Todesurteil gleich kommen. Denn das „death by cop“ wird oftmals aufgrund einer vermeintlichen Waffe erklärt, die bei einem Verdächtigen gesehen wurde. Verbalattacken von weißen Polizisten bei Straßenkontrollen sind für Schwarze ebenso alltäglich wie das Stoppen von afroamerikanischen Joggern auf der Straße, die als verdächtig gelten, weil sie vor etwas wegzulaufen scheinen. Das tief verwurzelte Unrecht lässt viele Afroamerikaner verzweifeln. Und jedes Mal, wenn über einen weiteren schwarzen Toten durch einen Polizeieinsatz in den Medien berichtet wird, wächst die Wut der afroamerikanischen Gemeinschaft und spaltet die USA wieder ein bisschen mehr.
Die Zahlen und Statistiken malen ein düsteres Bild für ein Land, das sich als „god's own country“ bezeichnet. Obwohl die Gesamtbevölkerung der Afroamerikaner nur bei rund 12,6 Prozent liegt, sind fast 40 Prozent der Gefängnisinsassen Schwarze. Fast jedes zweite Mordopfer gehört zur Bevölkerungsgruppe der Afroamerikaner. Allein im Staatsgefängnis von St. Louis sind von insgesamt 4.713 Insassen nur 598 Weiße, aber 4.083 Schwarze und dass bei einem afroamerikanischen Bevölkerungsanteil von 49 Prozent für St. Louis. Im Jahr 2012 und 2013 waren in der Stadt 94 Angeklagte wegen Mordes Schwarze und nur zwei waren Weiße.
Tötungen durch Polizisten passieren vornehmlich in kriminellen Schwerpunktgebieten. Der Schusswaffengebrauch durch Polizisten liegt hier deutlich über dem US-amerikanischen Durchschnitt. Experten gehen davon aus, dass Polizeigewalt nicht nur vornehmlich auf eine bestimmte Hautfarbe abzielt, sondern in Gemeinden, deren Bewohner hauptsächlich dem kriminellen Milieu zugeordnet werden. Gerade in Armenvierteln mit einer hohen Kriminalitätsrate ist das Verhältnis zwischen Polizisten und Anwohnern zerrüttet, teilweise sogar irreparabel beschädigt, sodass eine Kooperation zwischen beiden Seiten nicht mehr möglich ist. Eine Polizeistudie aus Philadelphia zwischen den Jahren 1970 und 1990 lässt zudem erkennen, dass erst der Einsatz von Deeskalationskursen für Polizisten und die Ausweitung der Sozialarbeit in den Armenvierteln, die Schusswaffenbenutzung durch Polizisten deutlich sinken ließ.
Befördert hat die Diskussion über alltägliche Diskriminierung der Schwarzen auch die Tatsache, dass zwar mehr als die Hälfte der Bewohner von Ferguson Afroamerikaner, aber nur drei der 53 Polizeibeamten schwarz sind. Der Bürgermeister, der Polizeichef, die Feuerwehr und fünf der sechs Mitglieder des Stadtrates sind Weiße. Die Proteste richten sich auch gegen eine weiße Elite, die selbst dort das Sagen hat, wo die Afroamerikaner klar in der Mehrheit sind. Polizeichef Thomas Jackson gibt nach den tödlichen Schüssen seines Polizeibeamten zwar bekannt, dass die Polizei auch vielfältiger werden muss. Sagt aber zugleich aus, dass jede Kontrolle eines Passanten „einem begründeten Verdacht oder einer anderen wahrscheinlichen Ursache“ entspringen muss. „Das sind die Regeln. Sie können die Bewohner anhalten und mit ihnen sprechen“, führt Jackson fort. Eine diskriminierende Nutzung des „stop and frisk“ Programms sieht er nicht.
Dass das Ansehen der Polizei in den USA schon in der jüngeren Vergangenheit nicht immer das Beste war, geben die Korruptionsberichte aus den 1970er Jahren wieder. Öffentliche Berichte über Bestechungsgelder aus den Abteilungen der Betäubungsmittelbekämpfung geben ein gutes Bild über strukturierte Korruption einzelner Polizeidienststellen wieder. Aussagen ehemaliger Polizisten brachten Skandale zu Tage und beschädigten das Bild über die Strafverfolgungsbehörden nachhaltig. Als Grund für die schwere Korruption waren nicht nur die finanziellen Probleme einzelner Polizeibeamte, sondern die gelebte eigene Subkultur der Cops in den USA. Die Skandale, die nachträglich auch durch weltbekannte Kinofilme medial verarbeitet wurden, förderten einen eigenen Verhaltenskodex zu Tage, der stark an ein Schweigegelübde der italoamerikanischen Mafia erinnert, in dem Aussagen gegen Polizeikollegen in jedweder Hinsicht nicht zu tolerieren sind. So werden auch Aussagen gegen Kollegen verweigert, die exzessive Gewalt angewendet und offensichtliches Unrecht begangen haben. Als das „blaue Gesetz des Schweigens“ bekannt, wird dieses unausgesprochene Gesetz unter Polizisten, keinen Ihresgleichen zu verpfeifen und Aussagen den Ermittlern gegenüber zugunsten des Angeklagten zu verfälschen, seit Jahrzehnten praktiziert.
Zudem ist die Rechenschaftspflicht bei US-Polizisten sehr unterentwickelt. Oftmals füllen die betroffenen Beamten selbst den Rechenschaftsbericht aus, ohne dass ein weiterer Beamter als neutrale Instanz entscheidet, ob Ermittlungen oder Disziplinarstrafen auferlegt werden sollten. Den Polizisten wird somit strukturell die Verantwortlichkeit ihres Handelns übertragen, ohne dass sie bei kleineren bis mittelschweren Vergehen Konsequenzen zu befürchten haben. Nicht wenige Polizisten fühlen sich mit dieser Kombination aus fehlender Verantwortlichkeit und mangelnden Sanktionen unangreifbar. Dieses Gefühl trägt zur Ausübung von unverhältnismäßiger Gewalt maßgeblich bei. Die eigene Aussage des Polizeibeamten genügt zumeist, die Benutzung der Dienstwaffe auch bei tödlichem Ausgang zu erklären und womögliches Unrecht zu verschleiern. Mit dem Hauptargument, das eigene Leben zu schützen, kann der Verdächtige zumeist ohne rechtliche Konsequenzen erschossen werden. In den überwiegenden Fällen wurden in der Vergangenheit Polizisten aufgrund ihrer alleinigen Aussagen und trotz weiterer gegenteiliger Zeugenaussagen vor Gericht freigesprochen. Es reichte hierbei oftmals schon aus, dass der Erschossene eine kriminelle Vergangenheit hatte. Den Polizisten wird vor Gericht auch mehr Glauben geschenkt als den Aussagen von Zeugen, weil sie gerade unter der weißen Bevölkerungsmehrheit ein hohes Ansehen trotz aller Skandale genießen.
Auch Fälle von unübersehbaren Indizien, die auf eine exzessive Anwendung von tödlicher Gewalt und großen Fehlverhalten hinweisen, werden eingestellt oder Polizisten durch Grand Jury Urteile freigesprochen. Im umstrittenen Fall Amadou Diallo aus dem Jahr 1999, der durch die New Yorker Polizei an 41 Schussverletzungen verstarb, gab es keinerlei plausible Gründe für das Vorgehen der Polizei. Und doch wurden die betroffenen Polizisten durch das Gericht freigesprochen. Für viele Afroamerikaner bedeuten diese empörenden Fälle keine Ausnahmeerscheinung, sondern die Regel. Der weltweit bekannte Spruch über die US-Cops „erst schießen, dann fragen“, hat einen ernsten und wahren Hintergrund, der öfters Anwendung findet als viele vor allem weiße US-Bürger erahnen.
Angeklagte Polizisten erhalten durch ihre mächtigen Polizeigewerkschaften zugleich große Unterstützung, die die jeweiligen Staatsanwälte, die zumeist periodisch gewählt werden, in ihren Ermittlungen inoffiziell unter Druck setzen können. Ermittlungen gegen einzelne Polizeibeamte oder gegen eine gesamte Dienststelle können daher nicht auf lokaler Ebene erfolgen, sondern nur durch eine unabhängige Bundesstelle. Hunderttausende Fälle werden so ohne Anklagen oder Strafen eingestellt. Ein Gefühl der Ungerechtigkeit in der Bevölkerung findet somit schleichend Einhalt. Oft verhindern die engen Strukturen zwischen dem lokalen Stadtrat, dem Staatsanwalt und der Polizeigewerkschaft jegliche Ermittlungsarbeit von vornherein. Das Interesse gegen einzelne Polizeibeamte vorzugehen sinkt rapide, wenn eine Seite Nachteile, wie ein Imageverlust, befürchten muss.
In der aufgeladenen Situation in Ferguson wird eine Entscheidung der Ermittlungsbehörden, Anklage gegen den Polizeischützen zu erheben, auch als ein politisches Statement verklärt. Sollte es zu einer Anklage kommen, werden die Polizeibefürworter eine politische Intrige vermuten, die wie im anderen großen, politisch heiklen Fall von OJ Simpson von „oben herab“ diktiert wurde. Damals sprachen die Beweise eher gegen den ehemaligen Footballstar OJ Simpson 1995 in Kalifornien im Mordfall seiner Ex-Frau Nicole Brown Simpson und ihrem Freund Ronald Goldman. OJ Simpson wurde am Ende freigesprochen und löste eine heftige Debatte um Minderheitenschutz aus. Auch damals befürchteten kalifornische Polizeidienststellen gewaltsame Rassenunruhen bei einem Schuldspruch. Sollte im Gegensatz jedoch der Polizeischütze von Ferguson durch die Ermittlungsbehörden nicht angeklagt werden, wird auch dieses Urteil von den meisten Afroamerikanern als ungerecht empfunden werden. Einen Ausbruch von gewaltsamen Protesten würde dann erwartet werden.
Die Rassenspannungen im St. Louis County sind nicht erst seit dem Fall Michael Brown zu spüren. In der Nachbargemeinde Kirkwood ist es am 7. Februar 2008 zu einem Amoklauf eines Afroamerikaners im Rathaus gekommen. Der Schütze Charles „Cookie“ Thornton erschoss damals fünf weiße Beamte aus Hass. Kirkwood ist eine wohlhabende und mit fast 80 Prozent eine vornehmlich weiße Gemeinde. Das durchschnittliche Jahreseinkommen in Kirkwood liegt mit 73.000 US-Dollar rund doppelt so hoch wie in Ferguson. Das hohe soziale Gefälle erzeugt Spannungen zwischen den Bewohnern, die sich in unregelmäßigen Abständen in Gewalttaten entladen.
Und regelmäßig werden Tötungsdelikte durch Polizeieinsätze in den Medien bekannt. Wenige Woche vor der Erschießung Michael Browns kam es ebenfalls zu einer Erschießung eines unbewaffneten Schwarzen durch einen Polizisten im Nachbarort von Ferguson, Bel-Ridge. Am 5. Juli wurde Christopher Maurice Jones erschossen, der zuvor vor einer Verkehrskontrolle auf der Interstate 70 flüchtete und mit seinem Auto 114 Meilen die Stunde über die Autobahn raste. An einer Ausfahrt verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und flüchtete anschließend zu Fuß. Jones war schwerer und größer als der ihm ebenfalls zu Fuß verfolgende Polizist und widersetzte sich seiner Verhaftung. Nachdem Jones sich an den Hosenbund am Rücken gefasst haben soll, vermutete der Polizist das Ziehen einer Waffe und erschoss Jones sofort. Zeugen oder Überwachungsvideos vom Vorfall gibt es nicht.
Einen traurigen Fall von massiven polizeilichen Fehlverhalten hatte die Stadt Ferguson am 20. September 2009 zu verkraften. Der Afroamerikaner Henry Davis, damals 52 Jahre alt, wurde nachts in Ferguson wegen eines angeblichen Haftbefehls von der Polizei angehalten und verhaftet. Auf der Polizeidienststelle stellte sich jedoch ein Irrtum heraus, weil Davis viel kleiner und einen anderen Zweitnamen besaß. Dennoch misshandelten ihn vier weiße Polizisten auf der Wache. Sie schleiften ihn in Handschellen in eine Zelle und traten und schlugen auch dann auf ihn ein, als er am Boden lag. Nachdem sie ihn aufgerichtet hatten, trat ein Polizist mit voller Wucht gegen seinen Kopf und verursachte eine starke massive Blutung. Im Krankenhaus wurden die behandelnden Ärzte angewiesen, keine Fotos von den Verletzungen Davis zu machen. Im Untersuchungsbericht vermerkten die Polizisten, dass Davis mit dem Kopf gegen eine Wand gefallen sei. Zu aller Boshaftigkeit erhielt Davis nach einigen Wochen nach der Tat einen Strafbescheid, der wegen Sachbeschädigung in der Polizeiwache ausgestellt worden war. Als knappe Begründung wurde „wissentliches Bluten auf mehrere Dienstuniformen“ angegeben. Die 30.000 US-Dollar Schäden an den Dienstuniformen sollte Davis selbst bezahlen. Davis geht bis heute gegen den Strafbescheid gerichtlich vor. Ihm plagen bis heute Depressionen und Angstattacken. Den vier Polizeibeamten glückte ihre Vertuschungsaktion, bis heute sind sie nicht angeklagt oder verurteilt worden.
Nur wenige Wochen vor der Erschießung von Michael Brown ereignete sich eine brutale Tat eines Polizisten in Los Angeles am 1. Juli 2014. Während eines Staus zur Rushhour-Zeit auf dem Santa Monica Freeway geht eine Frau den grünen Mittelstreifen in Socken entlang. Die Afroamerikanerin Marlene Pinnock, 51 Jahre alt, machte zu diesem Zeitpunkt einen verwirrten Eindruck. Ein Polizist fängt sie ab, es kommt zu einer kleinen Handgreiflichkeit zwischen beiden. Die Frau will weiter gehen und wird vom Polizisten zu Boden gerissen. Als er auf sie kniet, schlägt er mit seinen behandschuhten Fäusten auf sie mehrfach heftig ein. Erst ein herbeigeeilter zweiter Polizist kann ihn von weiteren Schlägen abhalten. Die Tat wurde von einem Autofahrer mit dem Handy aufgenommen, der im Stau mit hunderten anderen Autofahrern feststeckte. Zeugen vom Vorfall gab es viele. Der Aufschrei der Bürgerrechtler war in den USA groß. Denn schon wieder war das Opfer schwarz und der Polizist weiß. Die Medien verbreiteten den Clip in den Hauptnachrichten stündlich. Über die sozialen Medien wurde er endlos an Freunde und Bekannte verschickt. Der Polizist wurde vom Dienst suspendiert. Nach einer Mediationssitzung und einer Ausgleichszahlung von 1,5 Millionen US-Dollar an Marlene Pinnock, quittierte der betroffene Polizist seinen Dienst bei der Polizei.
Nur sehr wenige Fälle schaffen es überhaupt in die Schlagzeilen und noch weniger werden landesweit bekannt. Der Fall vom 17-jährigen Trayvon Martin brachte Ende Februar 2012 eine breite und langanhaltende Debatte über Rassismus in den USA in Gang. Es gab friedliche Demonstrationen und Protestveranstaltungen im ganzen Land, auch als der Schütze, der selbstberufene Nachbarschaftswächter George Zimmerman, freigesprochen wurde. Zimmerman gab an, in Notwehr geschossen zu haben und dass es zuvor zu einen Kampf mit dem unbewaffneten Trayvon Martin gekommen sein soll.
Auch wenn die Fälle sich unterscheiden, Brown wurde von einem Polizisten erschossen, Martin von einem privaten Nachbarschaftswächter, sind es vornehmlich afroamerikanische Jugendliche und junge Männer, die auf gewaltsamen Weg aus dem Leben scheiden. Und fast allen ist anzumerken, dass sie vorab durch ein diskriminierendes Profiling ausgewählt wurden. Bei Martin war es szenetypische Kleidung, die Zimmerman vermuten ließ, dass es sich um geklaute Waren handelte, die der Jugendliche bei sich trug. Martin hatte sie jedoch zuvor in einem Geschäft gekauft.
Alle Fälle zusammen ergeben ein Bild eines vorurteilsbeladenen Zusammenlebens differenzierter Bevölkerungsteile in den USA. Und die Unglücke scheinen kein Ende zu nehmen. Der afroamerikanische Bürgermeister von Newark, Ras Baraka, sagte nach dem Freispruch des Schützen George Zimmerman, dass dieses Ergebnis „das System der Jim-Crow-Justiz“ ist, welches „dem Mörder von Trayvon Martin in die Freiheit entlässt“. Die „Jim Crow“-Gesetze waren für die Rassentrennung bis in die 1960er Jahre verantwortlich und sollten nach ihrer Aufhebung keine Rolle mehr im US-amerikanischen Leben spielen. „Sie sagen, Jim Crow sei tot. Aber ich sage, Eric Garner ist tot“, sagte Baraka damals sichtlich wütend. Der Afroamerikaner Eric Garner wurde durch einen Polizisten in New York wenige Tage nach der Verkündung des Geschworenenurteils im Fall Martin während einer misslungenen Festnahme getötet.
Die Konflikte zwischen der Polizei und den Bürgerrechtlern verlagerte sich ab Ende der 1960er Jahre zunehmend zwischen der Polizei und unzufriedenen schwarzen Jugendlichen und der afroamerikanischen Bürgerrechtsbewegung. Der Krieg gegen die Drogen, die die USA seit der Hippie-Bewegung überschwemmten, wurde in den 1970er Jahren stärker forciert. Ab 1973 war der Schwerpunkt der nationalen Strafverfolgung der Kampf gegen die ausufernden Drogendelikte. Einige Polizeiabteilungen haben in dieser Zeit Versuche unternommen, das Verhältnis zwischen der Bevölkerung und der Polizei zu verbessern. Die gut sichtbaren Schrotflinten am Armaturenbrett der Polizeidienstwagen wurden in den Kofferraum verlagert. Doch die Gewalt gegen Polizisten nahm in einer solchen Geschwindigkeit zu, dass Politiker und die Polizeigewerkschaften härtere Maßnahmen verlangten. Schusswechsel und sogar Bombenlegungen von Extremisten nahmen erschreckende Ausmaße an. Zu dieser Zeit wurde auch die weltweit bekannte Polizeieinheit „Special Weapons and Tactics“, bekannt als SWAT, in Los Angeles gegründet, die für Geiselnahmen, Banküberfälle und schwer bewaffnete Kriminelle zuständig waren. Die Militarisierung der Polizei nahm hier ihren Lauf.