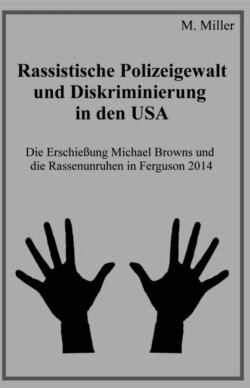Читать книгу Rassistische Polizeigewalt und Diskriminierung in den USA - Michael Miller - Страница 9
Dienstag, 12. August 2014
ОглавлениеDie Unruhen in Ferguson sind nicht die ersten seit einer langen Pause friedlichen Zusammenlebens der Ethnien. In Cincinnati brachen 2001 gewaltsame Proteste aus, als ein weißer Cop einen schwarzen unbewaffneten Jugendlichen erschossen hatte. In Anaheim in Kalifornien brachen 2012 ebenfalls über mehrere Tage gewaltsame Unruhen nach einem ähnlichen Fall aus. In der Stadt Albuquerque in New Mexiko brachen sogar Unruhen in diesem Frühjahr aus. Die größten Unruhen mit insgesamt 52 Toten und rund 1.000 ausgebrannten oder stark beschädigten Gebäuden waren 1992 in Los Angeles. Der Fall Rodney King, der von mehreren Polizisten zusammengeschlagen wurde und ein Beweisvideo in den Nachrichten die afroamerikanische Community erzürnte, war seit der großen Bürgerrechtsbewegung der 1960er Jahre der größte nationale Aufschrei wegen Rassismus. Verbessert hat sich seit 1992 für die Schwarzen in den USA jedoch nicht viel.
Die Demonstrationen in Ferguson verlaufen tagsüber am Dienstag relativ ruhig ab. Mehrere Personen skandieren vor der Polizeistation, die als Schwerpunkt der Krawalle gilt: „Hey hey, ho ho, killer cops have to go!” Die große mediale Berichterstattung über die Krawalle sowie die zunehmende Debatte um Polizeigewalt, lassen die Waffenverkäufe in den USA sprunghaft ansteigen. Meist nach blutigen Amokläufen oder der Androhung einer Waffenrechtsverschärfung steigen die Schusswaffenverkäufe rapide an. Die neuerlichen Gewaltausbrüche in Ferguson lassen in St. Louis und Umgebung die Bewohner ihre privaten Bestände auffüllen. Die überwiegenden Angstkäufe werden von Bewohnern von überwiegend weißen Wohngebieten getätigt, die ihr Eigentum vor den Randalierern schützen wollen. Doch die Krawalle in Ferguson zeichnen sich hauptsächlich in den schwarzen Sozialbausiedlungen ab und betreffen die reicheren weißen Viertel der Stadt zumeist nicht.
Am Dienstag gibt US-Präsident Barack Obama eine Erklärung heraus, indem er den Tod des Jugendlichen als „herzzerreißend“ beschreibt. Die First Lady Michelle Obama spricht der Familie Brown ihr Beileid aus. Es ist nicht das erste Mal für Obama, dass er sein Beileid für einen erschossenen schwarzen Jugendlichen ausspricht. Im Februar 2012 musste der Präsident den Tod des afroamerikanischen 17-jährigen Jugendlichen Trayvon Martin beklagen. „Wenn ich einen Sohn hätte, würde er wie Trayvon aussehen“, sagte Obama schließlich im März 2012. Obama stand da schon längst im Fokus der US-amerikanischen Öffentlichkeit zum Thema alltäglichen Rassismus in den USA. Die afroamerikanischen Wähler, die Barack Obama mit großer Mehrheit 2008 gewählt hatten, steckten auch die große Erwartung an ihm, den alltäglichen Rassismus in den USA zu beenden. Zumindest aber die Polizeigewalt gegenüber der schwarzen Minderheit zu stoppen. Angetreten war Obama auch mit dem Versprechen, die USA in einem „grand bargain“ zu einen, doch vielmehr stellen die US-Bürger jetzt fest, dass die USA mehr denn je in unterschiedliche Ethnien gespalten sind. Viel hat sich seit den sechs Jahren seiner Präsidentschaft für die Afroamerikaner nicht verbessert. Im Alltag erzielt die afroamerikanische Minderheit in den USA keinen Vorteil daraus, dass es einen schwarzen Präsidenten gibt. Die Rassentrennung verläuft jetzt unsichtbarer aber nicht weniger schmerzhaft. Die weißen US-Bürger stellen noch immer die Führungsschicht des Landes, während die Afroamerikaner noch immer die schlechtere Bildung, ein geringeres Einkommen und weniger Chancen auf Wohlstand haben. In der sozialen Mobilität hat die stark wachsende Gruppe der Lateinamerikaner die Afroamerikaner schon längst überholt.
Gleich nach dem Einzug ins Weiße Haus hatte Obama das Thema der Hautfarbe keine allzu große Aufmerksamkeit mehr geschenkt. Er möchte nicht seine Präsidentschaft mit dem Thema der Rassengleichheit in die US-Geschichte eingehen. Eine Einwanderungs- sowie eine Waffenrechtsreform scheinen neben seiner Gesundheitsreform die Meilensteine zu sein, mit denen er als Präsident in Erinnerung bleiben möchte. Außer seiner stark umstrittenen und boykottierten Gesundheitsreform, sind alle weiteren Projekte Obamas nicht vollständig umgesetzt worden. Dafür haben ihn die Republikaner mit ihren Blockaden mürbe gemacht.
Die Machtbefugnisse des US-Präsidenten sind allerdings auch stark begrenzt, um Änderungen von oben durchzusetzen. Durch den Föderalismus in den USA fehlt dem US-Präsidenten der Einfluss auf die Justiz und auf die Polizeibehörden in den Bundesstaaten. Obama kann nur mit der Macht des Wortes Änderungen predigen, doch auch hier spricht der Präsident nach Ansicht seiner Wähler zu wenig über Rassismus und Polizeigewalt in den USA. Doch Obama agiert nicht ohne Grund vorsichtig bis zaghaft. Als erster afroamerikanischer Präsident will er sich nicht einseitig einer Ethnie im Land zuordnen lassen und tritt daher für die meisten Schwarzen zu verhalten auf. Wiederholt hatte Obama darauf hingewiesen, dass ein Präsident das gesamte Land repräsentiert. Doch eine schärfere Verurteilung von Ungerechtigkeiten würde seiner Präsidentschaft letztendlich eher stärken, auch wenn eine klare Positionierung von ihm in den letzten Amtsjahren nicht mehr zu erwarten ist. Der soziale Frieden in den USA wird trotz Wahlversprechens von 2008 nicht durch Barack Obama wieder hergestellt werden können.
Mit Stolz kann die Obama-Regierung allerdings verkünden, dass sie seit 2010 rund 11 Millionen Arbeitsplätze geschaffen hat. Seit der Immobilien- und Bankenkrise steht das Land wieder im Aufschwung dar. Doch die wirtschaftliche Erholung geht an der afroamerikanischen Community fast vollständig vorbei. Die durchschnittliche Arbeitslosenquote von Schwarzen liegt rund doppelt so hoch wie die von weißen US-Bürgern und selbst die stark anwachsende Bevölkerungsgruppe der Lateinamerikaner steht deutlich besser auf dem US-Arbeitsmarkt dar. In den finanzschwachen und von Sozialtransfer abhängigen Familien bewohnten Gebieten der USA zementiert die schlechte und unterfinanzierte Schulbildung die Chancenungleichheit auf dem Arbeitsmarkt für Generationen fest. Die USA weisen damit drei große Bevölkerungsgruppen auf, die sich unterschiedlich entwickeln und deren Aussichten auf erwirtschafteten Wohlstand sich stark unterscheiden.
Am Dienstag tritt auch der Bürgerrechtler Al Sharpton in einer Kirche in Ferguson auf und sagt, dass sich der unbewaffnete Michael Brown mit erhobenen Händen ergeben wollte und dennoch von einem weißen Polizisten erschossen wurde. Mehrere Zeugen sagen nun aus, dass Brown die Arme nach oben gerissen habe und er von vorn erschossen worden sei. Sharpton will Antworten für die Familie Brown und für alle Afroamerikaner auf die Frage, warum das Zeichen der Kapitulation vom Polizeischützen ignoriert wurde. Der Reverent macht in der Rede auch klar, dass er nicht nach Ferguson gekommen ist, um neue Gewalt zu schüren, sondern der Familie Brown zu helfen Gerechtigkeit in dieser traurigen Angelegenheit zu finden. Er fordert die Ermittlungsbehörden auf, die Untersuchungen transparent und gründlich vorzunehmen. Während der Rede in der Kirche, die nur wenige Kilometer vom Tatort entfernt steht, sitzen auch hohe Beamten der Stadt bei, wie der Polizeichef von Ferguson, Thomas Jackson.
Unterdessen wird am Dienstag, dem 12. August 2014 von der Federal Aviation Administration (FAA), der Bundesluftfahrtbehörde, bekannt gegeben, dass sie eine temporäre Flugbeschränkung über den Luftraum von Ferguson und Teilen von Nord St. Louis verhängt hat. Als Begründung wird lapidar angegeben, dass eine „sichere Umgebung für die Strafverfolgung“ hergestellt werden soll. Zudem soll auf einen Polizeihubschrauber geschossen worden sein. Kritiker sehen darin jedoch eine Einschränkung der Pressefreiheit, weil TV-Hubschrauber nun ab sofort nicht mehr über die Unruhen in Nord St. Louis berichten können. Die Untersuchungen würden auch grundsätzlich am Boden stattfinden, sodass nach Ansicht der Kritiker auch keine Beeinträchtigung von TV-Hubschraubern vorkommen sollte.
Als Ergänzung zu den lokalen Ermittlungen wird der Justizminister Eric Holder den Fall dem FBI übergeben. Mehrere Bundesbeamte sind schon in Ferguson eingetroffen. Mitglieder des US-Kongresses begrüßen die bundesstaatlichen Ermittlungen. Der Fall betrifft nun die fundamentalen Bürgerrechte der USA und soll nicht allein von einem lokalen Staatsanwalt untersucht werden. Der Justizminister will seinen Kampf für gleiche Bürgerrechte für jeden US-Amerikaner in Ferguson fortsetzen. Zu Beginn seiner Amtszeit vor fünf Jahren machte Holder mit einer Aussage Schlagzeilen, als er die USA in ihrem unrühmlichen Umgang mit den Rassenkonflikten als eine „Nation von Feiglingen“ bezeichnete. Die Bundesüberprüfung auf mögliche Bürgerrechtsverletzungen hat Holder schon 20-mal geführt. Ferguson wird aufgrund der wütenden und gewaltsamen Proteste ein besonderes Ereignis sein, welches er sich genau widmen möchte.
Holder, selbst Afroamerikaner, unterstreicht sogar, dass es möglicherweise rassistische Profilerstellungen, dem sogenannten „racial profiling“, in der Polizei von Ferguson und St. Louis gäbe. Und das, obwohl der US-Bundesstaat Missouri eine Gesetzesänderung im August 2000 vorgenommen hatte, um dem „racial profiling“ entgegenzuwirken und den Behörden die Gelder zu entziehen, die durch diskriminierendes Verhalten auffällig wurden. Auch die Polizei in Ferguson und St. Louis müssen Daten über kontrollierte Personen erheben, wie das Alter, das Geschlecht und die Hautfarbe. Die Behörden leiten die Daten jährlich an den Staatsanwalt weiter, der wiederum den Gouverneur von Missouri unterrichtet. Nach der jetzt bekannt gewordenen Statistik aus Ferguson wurden Afroamerikaner häufiger als Weiße auch im Bezug zur Bevölkerungsmehrheit der Stadt zu Verkehrskontrollen herausgezogen. Doch fanden laut Statistik die Polizeibeamten proportional mehr illegale Drogen bei Weißen als bei Afroamerikanern, sodass die alltägliche Polizeiarbeit durchaus rassistische und diskriminierende Züge trägt. Denn kleinste Verkehrsdelikte endeten für die schwarzen Bewohner zumeist mit Bußgeldbescheiden, während weiße Verkehrsteilnehmer häufig nur mündlich ermahnt wurden.
Der Justizminister gibt sogleich bekannt, dass „nur die Bundesregierung die Ressourcen hat, die Erfahrung und die uneingeschränkte Unabhängigkeit“, um zu einem objektiven Ergebnis im Fall Michael Brown zu kommen. Die große und heftige Kritik Holders an der Polizei in St. Louis wird auch durch eine Rüge knapp ein Jahr zuvor von der Missouri State Conference bestätigt. Im November 2013 stellte die Konferenz fest, dass es zu rassistischen Profilen innerhalb der Polizeibehörden gekommen war, die die Bürgerrechte verletzten. Auch damals sollen Polizeibeamte Afroamerikaner proportional häufiger als Weiße kontrolliert und verhaftet haben. Daneben sollen in der Einstellung von afroamerikanischen Polizisten diskriminierende Ablehnungskriterien vorherrschen. Dabei sehen Bürgerrechtler den Fall in Ferguson nicht als eine Ausnahme, sondern eher als die Regel für die gesamten USA an. Schon seit jeher gibt es Spannungen seit der Abschaffung der Sklaverei in den USA zwischen den Minderheiten und den Weißen. Nur würden heutzutage Polizeigewalt und Todesfälle in Polizeigewahrsam den Rassismus in den Vereinigten Staaten fortleben lassen.
Für eine große Demokratie wie die USA sind solche Verhältnisse auf Dauer nicht zu dulden. Die USA haben seit den Rassenunruhen der 1960er Jahre einen fundamentalen Wandel durchgemacht, der es afroamerikanischen Bürgern erlaubt, Anwälte, Richter, Abgeordnete und Senatoren und schließlich sogar Präsident und Oberbefehlshaber der USA zu werden. Es ist seit den vergangenen Jahrzehnten nach Martin Luther Kings Tod gelungen, eine afroamerikanische Mittelschicht aufzubauen, die den Weißen in fast nichts nahe steht. Doch für den Großteil der Schwarzen ist die Lage seit Jahrzehnten hoffnungsloser und verzweifelter denn je. Sie kommen aus dem Kreislauf aus schlechter Bildung, fehlenden finanziellen Mitteln und sozialstaatlicher Abhängigkeit nicht heraus. Die Armut, die weite Teile der afroamerikanischen Bevölkerungsgruppe beherrscht, wird seit Generationen an die Kinder weitergegeben, ohne dass es eine Aussicht auf eine Verbesserung ihres Lebensumfeldes geben würde.
Die Zeichen der Straße stehen daher weiter auf Protest und Gewalt. Und der Kampf wird auch im Internet ausgetragen. Am Dienstagmorgen sind die Internetseiten des Rathauses von Ferguson nicht mehr aufrufbar. Auch die Telefonanlage ist abgeschaltet worden. Die ersten Meldungen berichten von einer Überlastung des Internetauftritts der Stadt durch eine Flut von Anfragen, einer sogenannten DDoS-Attacke, die den Server überlasten ließ und zum Abstürzen brachte. Die E-Mail-Postfächer der Stadtverwaltung wurden durch eine Spam-Flut ebenfalls lahmgelegt. Tage zuvor warnten Mitglieder der Gruppe Anonymous, dass sie Angriffe auf das Computernetzwerk von Ferguson und St. Louis planten, falls nicht endlich der Name des Polizeischützen bekannt gegeben werden würde, der Michael Brown erschossen haben soll. Zugleich sollen mit diesen Aktionen auch das gewaltsame und überzogene Vorgehen der Polizei gerächt werden, die viele friedliche Demonstranten Sonntagnacht verletzte. Weitere Behördenseiten werden mit Lahmlegungen bedroht, falls den Forderungen der Gruppe Anonymous nicht nachgegangen werden sollte.
Und die Hacker legten mit einer weiteren Aktion nach. Am Morgen veröffentlichten sie auch die private Wohnadresse und Telefonnummer vom Polizeipräsidenten Jon Belmar sowie die Namen seiner Frau und den Kindern im Internet. Es kursieren auch vermeintliche private Fotos der Familie Belmar im Internet. Die Veröffentlichungen lösten in den US-Medien Entsetzen aus. Das lose Hackerkollektiv hatte sich mit der Reaktion ihres Handelns jedoch verschätzt. Die Empörung war auch unter den friedlichen Demonstranten groß, denn sie rücken die Ziele der Bürgerrechtsbewegung ins schlechte Licht und beschädigen den Kampf gegen die alltägliche Diskriminierung. Die Androhung eines Mitglieds der Gruppe Anonymus, weitere private Dateien im Internet zu veröffentlichen, wurde schließlich zurückgenommen.
Auch die Eltern des Bürgermeisters von Ferguson, James Knowles III, wurden massiv am Telefon von Unbekannten bedrängt. Ihnen wurde angedroht, private Informationen wie die Adresse und Telefonnummer im Internet zu veröffentlichen. Die Hacker verschafften sich Zugang zu Knowles E-Mail Account und erschlichen sich mehrere Passwörter, darunter zu seinen Bankkonten. Mitglieder des Ferguson Police Departments wurden ebenfalls im Internet mit privaten Daten denunziert, darunter sind auch die Privatadressen und Fotos von Polizisten, die im Einsatz bei den Demonstrationszügen beteiligt waren. Polizeibeamte beklagen sich über Einkäufe und Bestellungen im Internet, die sie nie getätigt hätten. So wurde einem Polizeibeamten in Ferguson der Kauf eines LKWs im Wert von 37.000 US-Dollar bescheinigt, von dem er komplett überrascht wurde. Dem Polizeichef von Ferguson, Thomas Jackson, sollen Hacker versucht haben, mit den gestohlenen Bankdaten ein Pferd in der Türkei zu erwerben. Nächtliche Telefonanrufe und wüste Beschimpfungen vermelden einige Familien von Polizisten, die von den Identitätsdiebstählen betroffen sind. Allen Identitätsdiebstählen sowie Morddrohungen gegen einzelne Polizeibeamte im Internet werden ausgewertet und Strafverfahren eingeleitet.
Belmar wird von den Demonstranten und von den US-Medien ein Großteil der Schuld der militärisch auftretenden Polizei in Ferguson zugeschrieben. Nicht nur, weil er der Polizeipräsident ist, sondern weil er von den SWAT-Einheiten kommt, die nun in voller Montur für Angst und Unbehagen bei den Demonstranten sorgen sollen. Es ist seine Entscheidung, dass die Bilder über die paramilitärische Polizei, die wie eine kleine Armee in der Kleinstadt auftritt, entstehen und dass Holz- und Gummiknüppel, Tränengas, Schallkanonen, Rauch- und Blendgranaten, gepanzerte militärische Fahrzeuge gegen friedliche Demonstranten und teilweise auch gegen Reporter eingesetzt werden. Völliges Unverständnis ruft in der Bevölkerung auch die Präsenz von Sturm- und Scharfschützengewehren hervor, die die Polizeibeamten während der Demonstration tragen. Es trägt dazu bei, dass die Polizei als Besatzungsmacht wahrgenommen wird. Als kritisch werden auch die eingesetzten Kabelbinder gesehen, die den Verhafteten angelegt werden, da laut offizieller Lesart nicht genügend Handschellen zur Verfügung stehen. Die Kabelbinder schneiden laut Betroffenen jedoch in die Haut und erzeugen Druckstellen, Rötungen und Blutungen, weil sie oftmals zu eng angelegt werden.