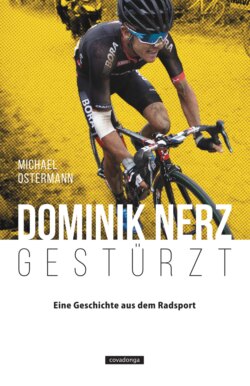Читать книгу Dominik Nerz - Gestürzt - Michael Ostermann - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеIII
LEKTIONEN IN SCHMERZ
Bei der Tour de France 1985 kommt es im Finale der 14. Etappe in St. Etienne zu einem folgenschweren Sturz in der Verfolgergruppe. Auch der Mann im Gelben Trikot geht zu Boden. Es dauert mehrere Minuten, bis Bernard Hinault wieder auf seinem Rad sitzt und die letzten knapp 300 Meter bis ins Ziel rollt. Sein Gesicht ist zerschlagen, das Blut strömt aus der Nase, tropft auf das Maillot Jaune und den Asphalt. Im Ziel muss sich Hinault vehement Platz verschaffen gegen die Fotografen und Journalisten, die einen Blick erhaschen wollen auf den blutenden Patron des Pelotons. Hinault, genannt »der Dachs«, strebt seinen fünften Toursieg an, aber in diesem Moment steht dieses Vorhaben auf der Kippe. Im Film »Slaying the Badger« (»Den Dachs erlegen«) von 2012 beschreibt der englische TV-Kommentator Phil Liggett, was sich anschließend abspielt: »Er nahm seinen heulenden Sohn auf den Arm und sagte zu ihm: ›Berühr meine Nase.‹ Und das Kind berührt seine Nase. ›Siehst du, es ist nichts.‹« »Nichts« ist in diesem Fall ein doppelter Nasenbeinbruch. Doch das kann den Franzosen nicht abhalten. Hinault leidet, aber er gibt nicht auf. Acht Tage später fährt er im Gelben Trikot und mit immer noch geschwollenem Gesicht in Paris ein. Er hat seine Gegner besiegt – und den Schmerz. Vor allem den Schmerz.
Diese Episode ist nicht nur ein Teil der Legende Hinault. Sie ist eine typische Erzählung des Radsports. Denn Radsport und Schmerzen bilden eine unzertrennliche Einheit. Das eine ist ohne das andere nicht zu haben. Radsportler lernen das früh. Nicht nur, wenn sie – wie Dominik Nerz – im allerersten Rennen stürzen. Wenn schon ein doppelter Nasenbeinbruch »nichts« ist, sind ein paar Schürfwunden erst recht nichts. Ein bisschen Tapete ist ab, heißt es dann lapidar. »Stürzen gehört zum Radsport wie das Weinen zur Liebe«, hat der ehemalige belgische Radprofi Johan Museeuw es geradezu poetisch zusammengefasst.
Nach einem Sturz aufzustehen, sich wieder aufs Rad zu setzen, ist für Radprofis ganz selbstverständlich. Als sich der Belgier Philippe Gilbert bei der Tour de France 2018 auf der Abfahrt vom Col de Portet d’Aspet in den Pyrenäen versteuert, sein Rad nicht mehr kontrollieren kann und über die Begrenzungsmauer ein paar Meter in die Tiefe stürzt, klettert er anschließend nicht nur wieder hinauf auf die Straße, sondern auch zurück in den Sattel und fährt die verbleibenden 60 Kilometer bis ins Ziel. Gilbert bewältigt dabei noch zwei Anstiege der ersten Kategorie, den Col de Menté und den Col du Portillon. Und das alles mit gebrochener Kniescheibe, wie sich später herausstellt. Der Italiener Vincenzo Nibali hatte sich ein paar Tage zuvor mit gebrochenem Wirbelkörper noch die letzten vier Kilometer nach L’Alpe d’Huez hinaufgequält. Der deutsche Radprofi Tony Martin war auf der achten Etappe mit der gleichen Verletzung nach einem Sturz bei Tempo 60 ebenfalls noch weitergefahren. Es ist auch für ihn keine neue Erfahrung. »Als Radsportler bist du Stürze gewohnt, hast das Stürzen gewissermaßen gelernt. Man hat sich gewisse Schutzmechanismen angeeignet, die der Körper dann anknipst«, sagt Martin anschließend in einem Interview mit der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung.
Als Radprofi sei man eine Art Trapezkünstler, meint der ehemalige niederländische Radprofi Hennie Kuiper, 1975 Straßenrad-Weltmeister und zwei Mal Gesamtzweiter bei der Tour de France. Oft genug gebe es dabei kein Fangnetz. Und wie im Zirkus stockt dem Publikum der Atem, wenn die Nummer schiefgeht, die Fahrer auf den Asphalt knallen oder wie Philippe Gilbert in einen Abgrund stürzen. Die Stürze sind im Zeitalter von Social Media, in dem jeder Crash zigtausendfach in kurze Clips geschnitten und geteilt wird, längst zu einer Art Entertainment geworden. Zumal all die für die Sinne verstörenden Elemente eines Sturzes – das Quietschen der Bremsen, die Schreie, das Knirschen des Carbons und das Scheppern von Metall auf dem Asphalt – meist nur undeutlich wahrzunehmen sind in der medialen Vermittlung. Wenn man direkt daneben steht, ist die Tonspur sehr viel lauter. Für den Zuschauer bleibt es jedoch so oder so ganz unbegreiflich, wie es Radprofis schaffen, nach solchen Stürzen aufzustehen und einfach weiterzufahren. Schon das Zusehen schmerzt. Dominik Nerz sagt, seine Freunde und seine Familie hätten vermutet, er habe gar keine Schmerzwahrnehmung mehr gehabt. Das stimmt natürlich nicht. Auch Radprofis empfinden Schmerz. Aber es gibt eine rationale Erklärung dafür, warum sie nur dann nicht weiterfahren, wenn es wirklich gar nicht mehr geht.
»Das kann man biologisch und psychologisch erklären«, sagt der Sportpsychologe Professor Jens Kleinert in seinem Büro im neunten Stock des Institutsgebäudes der Deutschen Sporthochschule in Köln. Eine halbe Stunde hat er sich freigeboxt in seinem engen Terminplan, um den verblüffenden Umgang der Radsportler mit dem Schmerz zu erläutern.
Die biologische Erklärung hat mit dem Hormon Endorphin zu tun, das bei extrem hohen körperlichen Belastungen ausgeschüttet wird. Endorphine wurden lange für jene Euphorie verantwortlich gemacht, die beim so genannten »Runner’s High« auftritt. Neuere Studien zeigen jedoch, dass diese Glücksgefühle wohl durch die Ausschüttung körpereigener Cannabinoide ausgelöst werden, während Endorphine eine andere Voraussetzung dafür schaffen: Sie lassen den Schmerz verschwinden.
»Endorphin ist ein Derivat des Morphins, also eines starken Schmerzmittels, das der Körper selbst produziert«, erklärt Jens Kleinert. Schon das Wort Endorphin drückt das aus: Es steht für endogenes, also körpereigenes Morphin. Dieses vom Körper selbst produzierte Schmerzmittel, so Kleinert, werde bei hohen Ausdauerbelastungen in wirksamen Dosen freigesetzt. »Ein lockerer Ausdauerlauf reicht da nicht aus, da passiert nichts.« Radprofis kommen in Leistungsbereiche, in denen auch sie jenes Phänomen des schmerzgedämpften »Runner’s High« erleben können. »Wenn die da den Berg hochfahren, wird tatsächlich Endorphin in relevanten Mengen freigesetzt«, sagt Professor Kleinert. Endorphin wird im Körper auch noch durch andere Einflüsse frei – bei psychischen Extremsituationen. »Wenn ich mich über längere Zeit psychisch stark anstrenge, mich erschrecke oder so etwas, dann wird auch Endorphin freigesetzt«, erläutert Kleinert. Hohe körperliche Belastung, psychische Anstrengung über eine längere Zeit, die Schrecksekunde des Sturzes. Faktoren, die bei Radsportlern den Endorphinspiegel in die Höhe schießen lassen, wodurch sie den körperlichen Schmerz nach dem Aufprall auf der Straße im ersten Moment nicht so stark wahrnehmen. Eine Erfahrung, die auch Dominik Nerz gemacht hat. »Die wirklichen Schmerzen kommen ja erst viel, viel später«, bestätigt er dieses eingeschränkte Schmerzempfinden unmittelbar nach einem Sturz. »Sie kommen noch nicht mal sofort nach der Etappe. Mein Motto war immer: direkt die Wunden sauber machen, egal, was ist. Wenn man das am Abend gemacht hätte – vergiss es.«
Endorphin ist die biologische Komponente. Doch der Reflex, sofort wieder aufs Rad zu steigen und weiterzufahren, wird auch von der Psyche geleitet, und er ist von klein auf antrainiert. Auch Dominik Nerz ist nicht nur nach dem Sturz bei seinem ersten Rennen immer wieder von seinen Trainern aufgefordert worden weiterzumachen. Sein langjähriger Coach Hartmut Täumler glaubt, dass die direkte Rückkehr aufs Rad eine wichtige Rolle spielt bei der Bewältigung eines Sturzes. »Wenn ich das nicht mache, setzt sich das Erlebnis fest und man verarbeitet es nicht mehr richtig«, meint Täumler. Als Profis haben die Radsportler dieses Verhalten längst verinnerlicht. Für sie spielt dann vor allem die Fokussierung auf das Ziel eine entscheidende Rolle.
»Bei Stürzen bei niedrigen Geschwindigkeiten hast du nur den Gedanken: Aufstehen, wo ist mein Rad, draufsetzen, den Anschluss nicht verpassen«, sagt Radprofi Tony Martin im Interview mit der FAZ am Sonntag. Aufmerksamkeitsfokus nennen die Psychologen das. »Der ist in diesem Moment so stark auf die Gruppe gerichtet, die da gerade wegfährt, dass mein Fokus gar nicht intern beim Schmerz ist«, erläutert Sportpsychologe Jens Kleinert. Verschiedene Signale stehen für den gestürzten Radprofi in diesem Moment im Wettbewerb miteinander: der interne Schmerz und das externe Renngeschehen. Diese »Competition of Cues«, dieser Wettstreit zwischen unterschiedlichen Reizen, geht zurück auf eine Theorie des Psychologen James Pennebaker. Auf die Situation des Sturzes übertragen bedeutet sie: Stürzt ein Radprofi, ist das externe Signal, das Rennen, stärker als die körperliche Pein. »Ich nehme den Schmerz gar nicht wahr, sondern nur noch das, was gerade vor meinen Augen, was im Rennen abläuft«, erklärt Professor Kleinert. »Die kriegen schon mit: Das tut weh. Aber durch diese Mechanismen nicht in dem Maße, wie wenn es diese externe Situation nicht gibt.« Diese psychologische Komponente im Zusammenspiel mit der Produktion eines Schmerzmittels im Körper erklärt, warum jemand wie Philippe Gilbert sich mit gebrochener Kniescheibe noch über zwei Pyrenäengipfel quälen, nach dem Rennen aber nicht ohne Hilfe gehen kann. Die Wirkung der Endorphine lässt nach und keine Gruppe muss mehr eingeholt, keine Etappe beendet werden. Das ist der Moment, in dem der Schmerz seine volle Wucht entfaltet.
Den Tag nach einem Sturz beschreiben Radprofis oft als besonders schlimm, weil der Schmerz dann nicht mehr natürlich gedämpft wird, sondern nur noch mit Hilfe von Schmerzmitteln unterdrückt oder mit Willenskraft ignoriert werden kann. Radprofis sind auch darauf trainiert. »Jeder, der nicht so mit Schmerzen umgehen kann, wird sagen: Ich bin verletzt, krank, es geht nicht. Aber als Radfahrer lernt man, mit dem Schmerz umzugehen«, sagt Dominik Nerz, der eigentlich ein sensibler Typ ist und einen eher weichen Eindruck macht. Aber die Härte seines Metiers hat auch er verinnerlicht. »Wenn ich mich mal ein bisschen auf dem Asphalt gerollt habe und genäht wurde oder so was, saß ich am nächsten Tag wieder auf dem Rad. Muss ja.«
Dieses »Muss ja« macht die Essenz des Radsports aus. Die Qualen nach einem Sturz sind dabei nur das Extrem. Aber Radrennen fahren tut auch weh, wenn man nicht auf dem Asphalt aufschlägt. Jedes Training bereitet Schmerzen. Die Muskeln brennen, und wenn die Leistungsgrenze erreicht oder gar überschritten wird, breitet sich im Mund manchmal der Geschmack von Blut aus. In den roten Bereich zu gehen und dennoch weiterzumachen, obwohl der Körper schreit: »Aufhören!« Das ist Alltag für Radsportler. »Radsport ist Leiden«, hat der legendäre Fausto Coppi es treffend zusammengefasst. Das gilt im Training wie im Rennen. Dominik Nerz’ Trainer Hartmut Täumler hat seinen Schützlingen in der U23 stets die Prämisse mitgegeben: »Wenn nichts mehr wehtut, bin ich im Ziel.«
Das Leiden macht seit den Anfängen des Radsports dessen Faszination für das Publikum aus. In den ersten Jahrzehnten überhöhten die Zeitungsreportagen die leidenden Athleten zu Helden von mythischer Gestalt. Heute sind es die Nahaufnahmen der von Anstrengung gezeichneten Gesichter der Fahrer, die sich einen Berg hochquälen, oder die dreckverschmierten Grimassen der Radprofis bei den Frühjahrsklassikern wie Paris–Roubaix, die das Leid auf dem Rad anschaulich machen. Der technische Fortschritt hat die Räder leichter und schneller gemacht, bessere Trainingsmethoden und Doping haben die Leistungsgrenzen verschoben. Aber weh tut es immer noch. Radsportler leiden und dieses Leiden macht die Sache für das Publikum interessant. Mit Sadismus oder mangelnder Empathie hat dieser Reiz allerdings nichts zu tun.
Von einem »Theater des Leidens« spricht der Sportphilosoph Gunter Gebauer in einem Berliner Café, das er als Treffpunkt vorgeschlagen hat. Gebauer ist Mitte 70 und hat bis 2012 an der Freien Universität in Berlin gelehrt. Sein Alter sieht man ihm nicht an. Er ist ein hoch gewachsener ehemaliger Leichtathlet, der Faszination und Elend des Sports philosophisch zu durchdringen versucht. »Dieses Leiden passiert zwar wirklich, aber es ist gleichzeitig in einem Spiel zugefügt – und zwar selbst zugefügt. Das hat also mit dem Leiden eines Kranken oder eines Sterbenden nichts zu tun, geht aber in die Nähe, weil es fast existenziell werden kann«, beschreibt er die besondere Form des Martyriums im Radsport. »Durch diese Spannung zwischen Ernst und Spiel bekommt der Radsport etwas Theatralisches. Wir haben hier das Grundmodell Theater, aber es wird noch eine Endung weitergedreht, weil etwas Realismus reinkommt.«
Die Qualen der Radprofis sind real. Und die für den Zuschauer interessante Frage ist: Wie schaffen die das? Wie können sie das Stoppsignal des Körpers so lange ignorieren? Die Antwort darauf steckt zum Teil im Wesen des Schmerzes. Die Welt-Schmerzorganisation ISAP (International Association for the Study of Pain) definiert Schmerz als »ein unangenehmes Sinnes- und Gefühlserlebnis, das mit aktueller oder potenzieller Gewebeschädigung verknüpft ist oder mit Begriffen einer solchen Schädigung beschrieben wird«.
Der Hinweis auf ein Gefühlserlebnis macht deutlich, dass es auch eine starke emotionale Ebene des Schmerzes gibt. Professor Jeffrey Mogil, Psychologe und Schmerzforscher an der McGill University in Montreal, erklärt in einem Beitrag auf der Website des britischen Radsportmagazins Cycling Weekly: »Schmerz ist mehr als nur eine Sache. Es ist eine Sinneswahrnehmung wie Sehen oder Tasten, er ist eine Emotion wie Wut oder Traurigkeit und er ist ein Zustand, der eine Handlung erfordert, wie Hunger.« Sehen oder Tasten können die meisten Menschen, Wut und Trauer empfinden die allermeisten von uns auch. Emotionen lassen sich leiten, ein Hungergefühl kann man unterdrücken. Den Umgang mit Schmerzen kann man daher ebenfalls trainieren.
Einer der ersten Wissenschaftler, der sich mit der Frage des Schmerzempfindens und der Schmerztoleranz bei Spitzenathleten beschäftigt hat, war der Psychologe Karel Gijsbers von der Universität Stirling in Schottland. Bereits 1981 veröffentlichte er im British Journal of Medicine die Ergebnisse einer Studie, bei der er Schwimmer des schottischen Nationalteams sowie Mitglieder eines Schwimmklubs und Nichtathleten einem Schmerztest unterzogen hatte. Das Ergebnis: Alle drei Gruppen spürten den Schmerz etwa zur gleichen Zeit, die Schwimmer aus dem Nationalkader konnten die Schmerzen allerdings deutlich länger aushalten als die Klubschwimmer und diese wiederum länger als die Nichtathleten. Diese Resultate seien darauf zurückzuführen, dass Spitzenathleten sich systematisch Schmerzerfahrungen aussetzten. Auch der Einfluss von Endorphinen und psychische Mechanismen, den Schmerz zu handhaben, spielten eine Rolle, schreibt Gijsbers. Er fügt hinzu: »Es wird berichtet, dass hoch motivierte Athleten im Schmerz sogar eine gewisse Befriedigung spüren.« Radprofis haben demnach also kein grundsätzlich anderes Schmerzempfinden als andere Menschen, sie haben lediglich trainiert, besser damit umzugehen. Von klein auf spulen Radfahrer Kilometer um Kilometer ab, Schmerzen sind dabei ein ständiger Begleiter. Sie werden Teil des Alltags, schlichtweg normal. »Es ist ja nicht so, dass du auf einmal Schmerzen aushalten musst, die du nicht packen würdest, sondern das geht Schritt für Schritt«, berichtet Dominik Nerz. »Du gewöhnst deinen Körper in einer gewissen Weise daran. Es kann ja auch niemand aus dem Nichts 260 Kilometer Rad fahren. Das würde auch nicht funktionieren. Genauso verhält es sich mit den Schmerzen.«
Der Sportpsychologe Jens Kleinert schmunzelt verschmitzt, wenn man ihn fragt, warum Leitungssportler insbesondere in den Ausdauersportarten wie Radsport so viel besser Schmerzen ertragen können als »normale« Menschen. »Das können sie ja gar nicht«, beteuert er. »Es gibt keine biologischen Unterschiede. Das Schmerzsystem funktioniert genauso, nur dass die psychischen Möglichkeiten, mit Beschwerden umzugehen, sie zu ignorieren oder sich abzulenken, besser sind.« Durch den ständigen Umgang mit Schmerz verändert sich zudem die Wahrnehmung, wie weit der Weg an den Rand des Erträglichen ist. »Die Tatsache, dass man ständig solche Erlebnisse hat, im Training oder im Wettkampf, und damit irgendwie zurechtkommen muss, führt zu einem ganz normalen Lern- und Sozialisationsprozess«, erläutert Professor Kleinert.
In seiner Autobiografie »Shut Up Legs« beschreibt der ehemalige Radprofi Jens Voigt, wie dieser Prozess bei ihm schon in der Sportschule begann. »Und nachdem ich nun knapp 20 Jahre im Profisport unterwegs gewesen bin, glaube ich, dass ich zehn bis 20 Prozent mehr Schmerzen ertragen kann als die meisten anderen.« Tatsächlich variiert die Schmerztoleranz auch bei Spitzenathleten, je nachdem in welcher Phase der Saison sie sich befinden. Je näher ein Sportler dem Saisonhöhepunkt ist, desto ausgeprägter ist seine Fähigkeit, Schmerzen zu ertragen. Dabei ist die Art des Trainings und nicht etwa der Fitnesszuwachs für die Ausprägung der Toleranz gegenüber Schmerzen maßgebend, wie eine Studie an der Oxford Brookes University in Großbritannien aus dem Jahr 2017 festgestellt hat. Je höher die Trainingsintensität, desto besser die Schmerztoleranz. Man muss also schon im Training leiden. Und – auch das stellt jene Studie fest – wer in der Lage ist, Schmerz besser zu ertragen, der kann auch schneller Rad fahren. Daraus ergibt sich eine einfache Formel, die Radrennfahrer intuitiv verinnerlicht haben: Mehr Leiden im Training gleich höhere Schmerztoleranz, höhere Schmerztoleranz gleich bessere Leistungsfähigkeit im Rennen.
Der Sozialisations- und Trainingsprozess ist aber lediglich ein Aspekt. Das subjektive Verschieben der Schmerzgrenze, wie Jens Voigt es beschreibt, hat zu einem Großteil auch eine psychologische Komponente. Voigt selbst verfolgte während seiner Karriere einen autoritären Ansatz im Umgang mit dem Schmerz. Er erteilte seinen Beinen den klaren Befehl: »Shut up legs!« Voigt wurde mit diesem Ausspruch weltweit bekannt und hat ihn nach seiner Karriere zu einer Marke gemacht, unter deren Dach er T-Shirts, Kapuzenpullis und Radtrikots verkauft. In seiner aktiven Zeit war Jens Voigt ein »Baroudeur«, ein Fahrer, der sein Heil in der Attacke suchte, mal in der Gruppe, häufig als Solist. Und dann war er allein mit sich und dem Schmerz in den Beinen, denen er befahl, still zu sein. Wie in den Situationen unmittelbar nach einem Sturz greift auch hier wieder James Pennebakers Theorie der »Competition of Cues«, wonach sich unterschiedliche Reize in einem Wettstreit befinden. Entscheidend ist, auf welchen davon sich die Aufmerksamkeit fokussiert. Nur dass in diesem Fall jener Reiz, der den Fokus vom Schmerz ablenken soll, vom Athleten selbst geschaffen wird. »Normalerweise setzt sich ein Schmerzsignal durch. Das heißt, der innere Reiz, der Schmerzreiz, wird sehr aufdringlich. Aber man kann durch Training tatsächlich den Aufmerksamkeitsfokus von diesem inneren Reiz weglenken«, erläutert Sportpsychologe Jens Kleinert. »Diese Umlenkung des Aufmerksamkeitsfokus wird unterstützt durch imaginäre und verbale Techniken.«
Radprofis berichten häufig davon, dass sie ihre Qualen gerne auf die anderen Fahrer um sie herum projizieren, getreu dem Motto: »Wenn es mir wehtut, tut es den anderen erst recht weh.« Auch Dominik Nerz hat sich gerne mit diesem Gedanken beholfen, wenn am Berg das Brennen in den Beinen unerträglich zu werden schien. Die Vorstellung, den Gegner im nächsten Moment zu überholen, aus dem Sattel zu gehen, um den Druck auf die Konkurrenten zu erhöhen, oder sich im Training vorzustellen, was hinter der nächsten Kurve kommt – alle diese Bilder lenken den Fokus weg vom Schmerz. Das Gleiche gilt für Selbstgespräche, die das Handeln begleiten. Beispielsweise auszusprechen, dass man jetzt weiter rund treten wird. »Dieses Verbalisieren hilft mir, den Fokus auf bestimmte Dinge zu legen. Das kennen alle Menschen, die etwa in den Keller gehen und sagen: ›Mensch, was hatte ich jetzt noch mal gesucht hier?‹
Das sagt man dann wirklich laut vor sich her«, erklärt der Sportpsychologe Jens Kleinert. »Im psychologischen Training wird diese Strategie gelernt und geübt, zum Beispiel welche Sprüche oder welche Selbstgespräche man wann führen sollte. Solche Selbstgespräche können auch gegen den Schmerz gehen. Das heißt: ›Das ist jetzt egal, trotzdem weiter.‹ Das sind selbstmotivierende Schmerzgespräche, die versuchen, vom Schmerz abzulenken und das sportliche Ziel zu fokussieren, das man vor Augen hat.« Oder um es mit Jens Voigt zu sagen: »Shut up legs!«
Mit den Selbstgesprächen oder den Imaginationstechniken wird der Schmerz rationalisiert. Das heißt, die starke emotionale Seite des Schmerzes wird beiseite gedrängt. Schmerz kann mit emotionalen Begriffen wie schrecklich, furchtbar, dramatisch beschrieben werden. Oder aber eher nüchtern definiert werden als dumpf, stechend oder brennend. »Im Gespräch mit dem Schmerz kann ich herausfinden, was sagt er mir gerade, was bedeutet er? Bedeutet er, dass ich ein bisschen runder oder langsamer fahren soll, oder was will der Schmerz mir sagen?«, erläutert Professor Kleinert. »Das ist auch eine Art und Weise, den Schmerz als etwas Rationales zu sehen. Wenn ein Athlet den Schmerz rational beschreibt, versucht er, sich emotional davon zu lösen. Das kann eine wunderbare Strategie sein, da negative Emotionen den Schmerz meist sogar verstärken.«
Radprofis brauchen diese Fähigkeit, den Schmerz in seine Schranken zu weisen, ihn nicht gewinnen zu lassen. Nur diese Fähigkeit ermöglicht es ihnen, erfolgreich zu sein. Doch nicht immer ist es richtig, den Schmerz zu ignorieren, ihn auszuhalten, mit ihm zu verhandeln. Spätestens dann, wenn der Schmerz in Wahrheit kein Bruder des inneren Schweinehunds ist, den es zu überwinden gilt, sondern ein Warnzeichen des Körpers. Gerade weil Radsportler darauf konditioniert sind, Schmerz auszuhalten, laufen sie deshalb Gefahr, entsprechende Warnzeichen zu ignorieren und trotzdem weiterzumachen. »Das ist dann für den Fahrer ein Dilemma und für das Team sogar ein ethisches Problem«, sagt Jens Kleinert. »Eigentlich sollte man nicht weiterfahren, weil es dadurch nur schlimmer wird und dann muss man irgendwann drei, vier Wochen aussetzen, anstatt drei, vier Tage.«
Oft sind es äußere Einflüsse oder die Angst, als Versager dazustehen, die Radprofis dennoch weitermachen lassen. »Ich hätte viel häufiger auf meine inneren Signale hören müssen«, meint Dominik Nerz rückblickend. »Wenn es wirklich an die Gesundheit geht, sollte man vielleicht früher reagieren. Aber es ist halt immer extrem schwierig. Auf der einen Seite hat man selbst den Anspruch und ist gewohnt, zu funktionieren und nicht einfach aufzugeben. Auf der anderen Seite gibt es den Druck von außen. Du willst dein Team, deine Teamkollegen, deinen Sportlichen Leiter, deinen Teamchef und die Sponsoren nicht enttäuschen. Und dann sagt man sich: ›Okay, dann musst du halt jetzt noch ein bisschen mehr auf die Zähne beißen.‹«