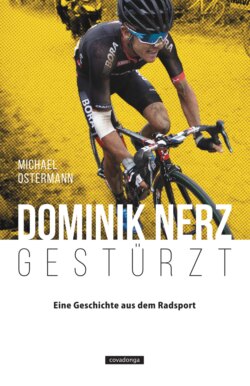Читать книгу Dominik Nerz - Gestürzt - Michael Ostermann - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеIV
NEUE WELT
»Deutschlands verlorener Traum«, titelt das Magazin Cycle Sport in seiner Januar-Ausgabe 2011. Es folgt ein Abgesang auf das Team Milram, das sich nach der Saison 2010 aufgelöst hat und am Ende nur noch eine »Tragikomödie auf zwei Rädern« gewesen sei, wie das britische Magazin festhält: »Alles, woran sie Hand anlegten, endete in Mittelmäßigkeit.« Ein vernichtendes Urteil zum Ende einer Ära.
Mit Milram tritt das letzte deutsche Team von der großen Radsportbühne ab, die damals noch den Titel ProTour trägt. Drei Jahre zuvor hat sich bereits das T-Mobile-Team aus dem Radsport zurückgezogen, das aus dem Team Telekom hervorgegangen war. Einer Equipe, die lange Zeit einen ähnlichen Stellenwert hatte wie die Fußball-Nationalmannschaft. Im magentafarbenen Trikot des Teams war Jan Ullrich 1997 zum Toursieg gefahren. Er löste damit einen Radsportboom aus, der dazu führte, dass die Nation jahrelang den Juli in abgedunkelten Wohnzimmern verbrachte. Dort verfolgte man auf dem Bildschirm, wie Ullrich sich vergeblich daran abarbeitete, seinen Erfolg in Frankreich zu wiederholen, und wie Erik Zabel Jahr um Jahr das Grüne Trikot des besten Sprinters der Tour gewann.
Auf die große Euphorie folgt das große Entsetzen, als 2006 Jan Ullrichs Verwicklung in die Fuentes-Affäre bekannt wird. Ullrich darf deswegen nicht an der Tour de France teilnehmen und beendet Anfang 2007 seine Karriere. Im Mai desselben Jahres folgen die Doping-Geständnisse von Zabel und dessen Kumpel Rolf Aldag. Auch Bjarne Riis räumt kurz darauf ein, gedopt gewesen zu sein bei seinem Toursieg, der ihm 1996 in den Telekomfarben gelang. Als im Sommer 2007 T-Mobile-Profi Patrik Sinkewitz einen positiven Test auf Testosteron abliefert, steigen die öffentlich-rechtlichen TV-Sender ARD und ZDF mit sofortiger Wirkung aus der Tour-de-France-Berichterstattung aus. In der Bonner Zentrale des Telekom-Konzerns hat man endgültig genug. Nach 17 Jahren als Sponsor im Profiradsport zieht man sich am Ende des Jahres zurück.
Der Radsport in Deutschland liegt am Boden, nicht nur an der Spitze. Auch an der Basis, in den Amateurklassen und bei den Junioren, wenden sich die Geldgeber ab. Der Rennkalender schrumpft zusammen: 2005 gibt es sieben Etappenrennen für Profis in Deutschland, 2010 ist lediglich noch die Bayern-Rundfahrt übrig, die nach der Ausgabe 2015 auch eingestellt wird. Das Publikum kehrt dem Sport ebenfalls den Rücken. Radsport wird in der deutschen Öffentlichkeit zum Synonym für Doping. Wie ein betrogener Ehepartner habe sich Deutschland enttäuscht vom Radsport abgewendet, kommentiert der Direktor der Tour de France Christian Prudhomme den Niedergang.
»Sinkewitz war der Worst Case«, sagt Jochen Hahn elf Jahre später in einem Café unweit seines Radgeschäfts in Berlin. »Eine Chance hat der Radsport noch gehabt, und die hat Sinkewitz zerstört. Das war das letzte Leben, das wir hatten, danach war es vorbei.« Hahn ist von 2008 bis zum Ende des Teams 2010 als Sportlicher Leiter bei Milram tätig gewesen. Nachdem sich 2008 auch das Team Gerolsteiner aufgelöst hat, ist Milram die letzte der ursprünglich drei deutschen Mannschaften in der ProTour. Die Nordmilch AG, eine Molkereigenossenschaft, deren Produktmarke Milram ist, erwägt ebenfalls einen vorzeitigen Rückzug aus dem Radsport. Als Dominik Nerz Ende September 2009 am Rande der Straßenrad-WM in Mendrisio in der Schweiz seinen ersten Profivertrag unterzeichnet, weiß Teamchef Gerry van Gerwen erst seit knapp zwei Monaten, dass sein Geldgeber den bis Ende 2010 geltenden Vertrag erfüllen wird. Nerz unterschreibt für zwei Jahre, weil der Radsport-Weltverband UCI das bei Neo-Profis so verlangt. Aber so lange wird es das Team nicht mehr geben.
Ein kleines zweistöckiges Gebäude in einem Gewerbegebiet in Sint-Oedenrode, nördlich von Eindhoven. Gerry van Gerwen empfängt einen im Büro der Firma seiner Tochter. Er ist schon Anfang April braun gebrannt, ein gut gelaunter Ruheständler mit Mitte 60. Immer noch strahlt van Gerwen jenen unerschütterlichen Optimismus aus, den er während seiner Zeit als Chef des Teams Milram immer an den Tag legte, egal wie schwierig die Lage auch sein mochte. Und schwierig war sie oft. Schon ein Jahr bevor Dominik Nerz seine Unterschrift unter den Vertrag setzt, der ihm den von der UCI vorgeschriebenen Mindestlohn von 25.000 Euro im Jahr garantiert, muss van Gerwen kämpfen, um Nordmilch bei der Stange zu halten. »Die wollten eigentlich unmittelbar nach 2008 aufhören«, erinnert sich van Gerwen.
Es ist nicht alleine die Dopingkrise, die Nordmilch das Engagement im Radsport infrage stellen lässt. Auch sinkende Milchpreise spielen bei den Überlegungen in der Konzernzentrale eine Rolle. »Die Konsequenz war, dass Nordmilch finanzielle Probleme gekriegt hat«, sagt van Gerwen. »Der Vorstand war weiter für die Mannschaft, kein Thema. Aber die Leute, die die Finanzen verwaltet haben, waren dagegen. Die Landwirte waren auch gegen die Mannschaft, weil die Milchpreise so niedrig waren und der Radsport in Deutschland einen schlechten Namen hatte.« Anfang Dezember 2008 reist Gerry van Gerwen deshalb gemeinsam mit seiner Tochter Marlies, mit der er die Geschäfte des Teams führt, in die Konzernzentrale der Nordmilch AG in Bremen. Er will seine Equipe retten. »Der Riese Nordmilch gegen die Micky Maus«, beschreibt van Gerwen die Konstellation. Eine Dreiviertelstunde redet er auf die Mitglieder des Vorstands ein. Einen Monolog habe er gehalten, erinnert er sich. »Ich war gut vorbereitet und habe auf Emotion gesetzt.« Die Strategie ist erfolgreich. »Nach konstruktiven Gesprächen mit unserem Partner Velo-City GmbH bestätigen wir, dass die Mannschaft am 1. Januar 2009 als Team Milram startet«, gibt die Nordmilch AG anschließend per Pressemitteilung bekannt. Im Juli erklärt das Unternehmen dann, man bleibe wie geplant auch 2010 noch dabei. Noch einmal wird man den Vertrag danach jedoch nicht verlängern. Für 2011 steht Gerry van Gerwen damit endgültig ohne Geldgeber da.
Die unsichere Zukunft des Teams wird Dominik Nerz’ gesamtes erstes Jahr als Profi überschatten. Doch zunächst einmal ist er schlicht überwältigt von der neuen Welt, die sich da vor ihm auftut. Schon der Mannschaftsbus, in dem er in Mendrisio seinen Vertrag unterschreibt, beeindruckt ihn, obwohl das Gefährt im Vergleich zu dem, was bei anderen Teams Standard ist, eher zurückbleibt. »Das war das erste Mal, dass ich in so einem Bus drinnen war … geil«, sagt Nerz.
Den Deal mit Milram hat Christian Baumer eingefädelt. Baumer ist damals der führende Fahrermanager in Deutschland. Nerz ist auf Vermittlung seines Trainers Hartmut Täumler zu Baumers Klient geworden. Täumler glaubt, dass ein junger Profi jemanden an seiner Seite haben muss, der die finanziellen Dinge regelt und über die entsprechenden Kontakte in der Branche verfügt. »Das hilft so jungen Leuten, sich zurechtzufinden«, erklärt Täumler. »Christian Baumer habe ich als sehr seriösen, sehr soliden Mensch kennengelernt. Der war der Richtige und ich habe auch allen meinen anderen Rennfahrern geraten, sich mit ihm zu verbünden.« Baumer soll für Nerz jedoch lediglich die vertraglichen Dinge mit den Teams regeln. Die Finanzen des jungen Radprofis verwaltet dessen Vater Michael. »Dadurch gab es manche Spannungen, die an Dominik nicht spurlos vorbeigegangen sind«, meint Hartmut Täumler. Auch Michael Nerz räumt ein, dass er mit dem Manager manchmal Knatsch gehabt habe, aber im Wesentlichen sei man gut miteinander ausgekommen. Viele der Fahrer, die Baumer vertritt, sind ebenfalls bei Milram unter Vertrag. Deshalb erscheint es logisch, dass auch Nerz dort unterkommt. Trotz der unsicheren Zukunft des Teams. Zumal Nerz im Jahr zuvor schon für das Milram-Nachwuchsteam gefahren ist.
Im Nachhinein sei Milram nicht die richtige Wahl gewesen, glaubt Täumler heute. »Um den Schritt weiter nach oben zu gehen, war es erst mal okay«, sagt er. »Er konnte nicht viel falsch machen. Aber im Gesamtaufbau gab es bessere Teams zu dem Zeitpunkt.« Für einen Vertrag bei einer anderen Mannschaft hätten aber entweder Baumers Kontakte oder aber Nerz’ Ergebnisse in der U23 nicht ausgereicht. Dominik Nerz behauptet dagegen, es hätte damals durchaus zwei, drei andere Optionen gegeben. Auch die Überlegung, ob er mit gerade einmal 20 Jahren schon den Sprung zu den Profis wagen oder lieber noch ein oder zwei Jahre in der U23 bleiben soll, habe eine Rolle gespielt. Was letztlich den Ausschlag dafür gibt, dass Christian Baumer den jungen Mann bei Milram unterbringt, ist nicht endgültig zu klären. Denn der Freiburger Fahrermanager will sich weder dazu noch zu anderen Fragen, die Nerz’ Profikarriere betreffen, äußern. »Gemäß unserer gängigen Praxis machen wir grundsätzlich keine Angaben über Kenntnisse, Einblicke usw., welche wir aus der Zusammenarbeit mit unseren Athleten gewinnen«, teilt er auf Anfrage per E-Mail mit.
Dass Hartmut Täumler rückblickend der Meinung ist, Dominik Nerz sei in einem anderen Team vielleicht besser aufgehoben gewesen, hat nicht in erster Linie mit dem drohenden Rückzug des Sponsors zu tun. Die Mannschaft befindet sich damals auch sportlich in einem permanenten Umbruch. Zum Start der Saison 2008 hat Gerry van Gerwen die Leitung des Teams übernommen, das zwei Jahre zuvor aus einer Fusion des deutschen Teams Wiesenhof und der italienischen Mannschaft Domina Vacanze entstanden ist. Van Gerwen ist dort zunächst der Marketingchef, Teammanager ist der Italiener Gianluigi Stanga. Mit Alessandro Petacchi und Erik Zabel hat Milram damals zwei der weltbesten Sprinter unter Vertrag. Doch die Zusammenarbeit zwischen dem deutschen Sponsor und der italienischen Teamführung gestaltet sich problematisch. Es kommt zum Zusammenprall zweier Kulturen, die van Gerwen mehr als zehn Jahre später in einer Anekdote anschaulich macht: Milram habe das Team damals nicht nur finanziell, sondern auch materiell unterstützt, indem es die hauseigenen Milchprodukte zur Verfügung stellte. Irgendwann habe man sich bei Nordmilch in Bremen dann jedoch über die große Menge an Käse gewundert, die Stanga orderte. Van Gerwen behauptet, es habe sich um mehrere hundert Kilo im Monat gehandelt, weshalb sich der Konzern an ihn gewandt habe mit der Bitte um Aufklärung. »Ich hab dann Stanga angerufen. Und er sagt: ›Hör mal Gerry, ich habe einen Freund und der hat ein Geschäft: Käse und Schinken. Ich tausche bei ihm Käse gegen Schinken, dann habe ich Käse und Schinken.‹« Van Gerwen sagt, er habe Stanga erklären müssen, dass er es mit einer großen deutschen Firma zu tun habe, mit der man seriös Geschäfte machen müsse. »Wenn du 10.000, 50.000 oder 100.000 Brötchen zu wenig hast, dann musst du das sagen. Aber so geht das nicht. Sicher nicht in Deutschland.«
Solche kulturellen Differenzen habe es häufiger gegeben, erzählt Gerry van Gerwen. Am Ende sind es allerdings weniger Stangas Deals mit Käse und Schinken, die eine weitere Zusammenarbeit unmöglich machen. Ausschlaggebend ist eine andere Seite der Radsportkultur, die den Italiener nicht mehr tragbar macht. Der ehemalige Profi Jörg Jaksche enthüllt in seiner »Dopingbeichte« im Nachrichtenmagazin Der Spiegel Ende Juni 2007, wie Stanga in seiner Zeit als Chef des Teams Polti jahrelang junge Radfahrer systematisch an Doping herangeführt hat. Daraufhin beendet Milram die Zusammenarbeit mit Stanga und überträgt van Gerwen die Leitung des Teams.
Als Teamchef übernimmt Gerry van Gerwen damals eine Menge Probleme. Zwischenzeitlich sei sein Anwalt mit 23 verschiedenen Dingen gleichzeitig beschäftigt gewesen, erklärt er. Unter anderem gibt es Ärger mit dem Radhersteller, der das Team ausstattet und den der Niederländer gerne wechseln möchte. »Es ging von einem Problem zum nächsten. Es war furchtbar«, sagt van Gerwen. Auch das Dopingproblem erbt der Niederländer von seinem Vorgänger. Petacchi ist beim Giro d’Italia 2007 mit einem überhöhten Wert auf das Asthmamittel Salbutamol auffällig geworden, das gleiche Medikament, das zehn Jahre später auch dem mehrmaligen Toursieger Christopher Froome nach einem positiven Test bei der Spanien-Rundfahrt Probleme machen wird. Im Mai 2008 sperrt der Internationale Sportgerichtshof CAS Petacchi für zehn Monate. Der Vertrag des Sprinters mit Milram wird in beiderseitigem Einvernehmen aufgelöst. Kurz darauf wird auch der Spanier Igor Astarloa, der Weltmeister von 2003, erst suspendiert und schließlich Ende Mai entlassen. Bei einer teaminternen Blutkontrolle ist ein überhöhter Hämatokritwert gemessen worden, was als ein möglicher Hinweis auf Blutdoping gilt.
Die anhaltende Dopingdiskussion und der gerade in Deutschland ausgeprägte Generalverdacht gegen den Radsport haben Gerry van Gerwen ein internes Kontrollsystem installieren lassen. So will er Vertrauen schaffen. Der dänische Anti-Doping-Experte Rasmus Damsgaard soll in Verdachtsfällen Fahrer des Teams testen. »Jeder Fahrer hat unterschrieben, dass ich in einem solchen Fall unseren Backup-Spezialisten Rasmus Damsgaard anrufen kann, um die Blutprofile zu testen. Sein Urteil wird dann bindend sein«, erklärt van Gerwen damals. Auch von seinem zu diesem Zeitpunkt noch überwiegend italienischen Personal verlangt der neue Teamchef eidesstattliche Erklärungen, dass sie mit Doping nichts zu tun haben. Nicht alle sind bereit, die Vereinbarungen zu unterschreiben. Weitere arbeitsrechtliche Verfahren sind die Folge. Der Sponsor beobachtet die Querelen mit zunehmender Ungeduld. »Ich habe in den Gesprächen mit Nordmilch gemerkt, dass sie die Nase voll hatten von Italien«, sagt van Gerwen. »Ich hatte nur eine Chance: Mache es deutsch, deutsch, deutsch. Ich musste einen Cut machen, mit einer deutschen Mentalität, einer deutschen Kultur.«
Der große Umbruch erfolgt zur Saison 2009. Die Teamzentrale wird von Italien nach Dortmund verlegt. Doch vor allem bekommt die Mannschaft sportlich ein komplett neues Gesicht. Von den 25 Fahrern des Teams sind nur noch elf aus dem Kader der Vorsaison dabei. Acht Fahrer übernimmt Gerry van Gerwen vom aufgelösten Team Gerolsteiner, darunter ist der Deutsche Meister von 2008, Fabian Wegmann. Auch der Sportliche Leiter Christian Henn, Mannschaftsarzt Mark Schmidt und weiteres Personal kommen von Gerolsteiner zu Milram. Doch die beiden wichtigsten Neuverpflichtungen sind Linus Gerdemann und Gerald Ciolek. Beide kommen vom Team Columbia, das aus dem T-Mobile-Team hervorgegangen ist. Gerdemann hat im Sommer zuvor die Deutschland-Tour gewonnen, die danach für zehn Jahre in der Versenkung verschwindet. 2007 hat Gerdemann zudem bei der Tour de France einen Etappensieg in den Alpen gefeiert und für einen Tag das Gelbe Trikot übernommen. Auf der anschließenden Pressekonferenz sprach er ausführlich, offen und eloquent über das Dopingproblem des Radsports. Seitdem gilt er als das Gesicht einer neuen deutschen Radsport-Generation. Gerald Ciolek hat seit seinem überraschenden Sieg bei den Deutschen Meisterschaften 2005 und seinem U23-Weltmeistertitel in Salzburg 2006 den Ruf, der deutsche Sprinter der Zukunft zu sein. Die beiden Kapitäne sollen zu den Aushängeschildern des neuen Milram-Teams und des deutschen Radsports werden. Doch Gerdemann und Ciolek sind mit der Rolle überfordert, in die sie von ihrem Teamchef gedrängt werden. »Das ist natürlich eine Menge Marketing gewesen. Wir mussten versuchen, uns gut zu verkaufen, der Radsport stand ja in einem schlechten Licht«, sagt der ehemalige Sportliche Leiter des Teams Jochen Hahn. »Es ging Gerry im Prinzip darum, das Augenmerk wieder aufs Sportliche zu lenken, weg von der ganzen Dopingsituation. Und das ging eigentlich nur über den Weg, junge deutsche Fahrer als Hoffnungsträger aufzubauen. Letztlich haben sie sich nicht darüber beklagt, aber für die sportliche Entwicklung war das sicherlich für beide nicht besonders förderlich.« Zumal beide auch nicht in Topform aus dem Winter kommen.
Van Gerwen legt die Messlatte für das gesamte Team sehr hoch: 25 Siege lautet seine Vorgabe für die Saison 2009. »Das war ein Alleingang, das muss man ganz klar sagen«, stellt Jochen Hahn klar. »Ich war rundheraus dagegen, solche Vorgaben zu machen. Da einen Druck aufzubauen und anzufangen, Siege zu zählen, ist schwierig. Erst recht, wenn man eh eine neue Mannschaft hat und man davon ausgehen muss, dass das erst mal nicht so laufen kann.« Mit der Übernahme eines Großteils der Gerolsteiner-Mannschaft muss damals quasi ein Team ins Team integriert werden. Das führt zu Reibereien und Debatten über die sportliche Ausrichtung der Mannschaft. Hahn meint, solche Prozesse seien normal, wenn sich eine Mannschaft neu zusammenfindet. Zumal neben dem personellen Wechsel ja auch ein örtlicher Wechsel zu bewältigen gewesen sei. »Das war ein Riesenumbruch«, sagt er. »So etwas dauert und das hat nichts mit Radsport zu tun.«
Gerry van Gerwen erklärt, genau deshalb habe er bewusst Druck aufgebaut, um die internen Diskussionen zu beenden und ein einheitliches Ziel vorzugeben. Der Umbruch geht ihm nicht schnell genug. Ihm bleibt nicht viel Zeit, ein erfolgreiches Team aufzubauen, weil er ständig fürchten muss, dass ihm der Sponsor abspringt. Im Nachhinein hält van Gerwen es deshalb für einen Fehler, so viel Personal von Gerolsteiner übernommen zu haben. »Das würde ich nie mehr so machen«, betont er. »Dadurch ist die Gerolsteiner-Mentalität ins Team gekommen, aber eine Mannschaft muss eine eigene Identität, eine eigene Kultur entwickeln.« Auch die Fahrer spüren die Differenzen zwischen dem Teamchef und der von Christian Henn angeführten Sportlichen Leitung. »Van Gerwen und Henn hatten unterschiedliche Auffassungen darüber, wie die Rennen gefahren werden sollen«, erinnert sich Fabian Wegmann. Die ständigen Querelen blockieren den sportlichen Erfolg. Van Gerwens Vorgaben werden jedenfalls weit verfehlt. Statt der eingeforderten 25 Siege schafft Milram 2009 nur neun Erfolge. Linus Gerdemann gewinnt die Bayern-Rundfahrt, Gerald Ciolek eine Etappe der Vuelta und Fabian Wegmann das deutsche Eintagesrennen Eschborn-Frankfurt City Loop. »Das ist eindeutig zu wenig. Mit dieser Mannschaft, mit dieser Qualität müssen auch 25 Siege drin sein«, klagt van Gerwen damals.
Als Konsequenz leitet er den nächsten Umbruch ein. Er degradiert den erfahrenen Ex-Profi Henn und setzt Ralf Grabsch als neuen Sportchef ein, der bis Ende 2008 noch selbst für Milram im Sattel saß. »Eins ist klar: So machen wir nicht weiter. Vielleicht waren wir zu demokratisch, zu menschlich. Die Zügel werden angezogen. Wir fahren nicht mehr Rennen, nur um Rennen zu fahren, sondern um Leistung zu bringen«, begründet der Niederländer die Entscheidung. Auch fast neun Jahre später ist Gerry van Gerwen überzeugt, dass dieser Schritt richtig war. Henn sei kein schlechter Kerl gewesen, offen für Argumente, aber er habe immer den Vergleich zu Gerolsteiner gezogen. »Und ich wollte das Team gerne zu einer modernen Mannschaft transformieren«, sagt van Gerwen. »Am Ende des Tages muss einfach gearbeitet und Rad gefahren und auch ziemlich gut Rad gefahren werden. Nur reden und dann keine Ergebnisse, das war natürlich nicht so gut.«
Henns Degradierung kommt für alle überraschend. Es ist die einsame Entscheidung des Chefs und die sorgt für neue Unruhe. Jochen Hahn glaubt, van Gerwen sei angesichts der unsicheren Zukunft der Mannschaft sehr nervös gewesen. Deshalb habe er starken Einfluss genommen auf die sportliche Ausrichtung, selbst auf taktische Belange bei einzelnen Rennen, egal, wer auf dem Papier als Sportlicher Leiter gestanden habe. »Das war eines der Probleme des Teams Milram 2009 und 2010, dass die Sportliche Leitung an der kurzen Leine gehalten wurde«, meint Hahn.
Normalerweise bestimmen die Sportlichen Leiter die Strategie und Taktik für die Rennen. Der Teammanager ist für das große Ganze zuständig, die Verträge mit den Sponsoren und den Fahrern, die Organisation des Unternehmens. Doch bei Milram, so schildert es Jochen Hahn, habe sich der Chef auch um die sportliche Ausrichtung bei den Rennen gekümmert: »De facto war er der erste Sportliche Leiter. Er hat es gut gemeint, aber ich glaube nicht, dass das hilfreich war.«
Gerry van Gerwen findet dagegen, er habe sich nicht genug einbringen können, weil er ständig mit anderen Problemen beschäftigt gewesen sei. Unter dem Strich sind die Kompetenzen nicht klar abgesteckt. Zwar lässt van Gerwen durchaus Kritik zu, aber er behält sich als Teamchef immer das letzte Wort vor. Das gilt auch bei der Verpflichtung von neuen Fahrern. Wobei sich die Beteiligten auch Jahre später nicht einig sind, wessen Idee es gewesen ist, Dominik Nerz für die Saison 2010 ins Team zu holen. Während Jochen Hahn der Meinung ist, die Verpflichtung sei definitiv auf van Gerwens Initiative erfolgt, glaubt der Niederländer, dass es eher Hahns Vorschlag gewesen sei, Nerz unter Vertrag zu nehmen. Fest steht nur, dass sich die Probleme des Teams Milram in dessen Debütsaison als Profi zuspitzen. »Das Team war noch nicht gewachsen und im zweiten Jahr war dann nicht klar, ob es weitergeht«, sagt Fabian Wegmann.
Es ist ein Spiel. Immer wieder schiebt der Nebenmann bei der gemeinsamen Trainingsausfahrt des Teams seinen Lenker ein Stück nach vorne. Es geht immer noch ein bisschen schneller, soll das heißen. »Stecken« nennen die Radprofis das und es soll dem Neuling schon gleich im ersten Trainingslager auf Mallorca signalisieren, wo er steht: am unteren Ende der Hackordnung. »Dieses Spielchen haben sie hin und wieder mit mir getrieben«, erzählt Nerz. »Es war damals normal, dass man einen Neo-Profi halt mal ›tot‹ gefahren hat, damit der wusste, wo er hingehört.« Dominik Nerz fügt sich. Er ist ein aufmerksamer Beobachter, er will nicht anecken, zeigt Respekt vor den erfahrenen Kollegen. Er ist überhaupt ein freundlicher junger Mann, der gerne mit allen auskommen möchte. Und weil er die Hierarchie akzeptiert, wird er gut aufgenommen von den erfahrenen Fahrern im Team. Ältere Profis wie Fabian Wegmann oder der ebenfalls von Gerolsteiner gekommene Johannes Fröhlinger nehmen sich seiner an. Das Hotelzimmer im Trainingslager teilt Nerz mit Servais Knaven. Der Niederländer, 2001 Sieger beim Klassiker Paris–Roubaix, ist ein alter Haudegen, der dem jungen Deutschen mit Rat und Tat beiseite steht, damit er sich in die Abläufe einfindet.
Sein neues Leben als Radprofi zieht Dominik Nerz in den Bann. Es werden ihm nun Dinge abgenommen, die er vorher selbst hat organisieren müssen. Angefangen beim Transfer vom Flughafen ins Hotel, das zudem einen höheren Standard hat als die, in denen er bisher untergebracht war. Das gefällt ihm. Im Speisesaal des Hotels steht eine »Foodbox«, die neben den Produkten des Teamsponsors verschiedene Müslis und andere Nahrungsmittel enthält. Doch vor allem sportlich ist der Sprung von der U23 in die ProTour gewaltig. Er ist erst 20 Jahre alt und nur zwei Jahre in der U23 gefahren, das macht sich bemerkbar. Schon im ersten Trainingslager auf Mallorca bekommt er das zu spüren. Das Grundtempo ist deutlich höher. »Ich musste teilweise früher abdrehen, weil ich einfach dieses konstant hohe Tempo nicht gewohnt war«, erinnert sich Nerz. Doch der Neo-Profi lernt schnell. »Das Gefühl, boah, das pack ich nicht, gab es bei Milram nie«, sagt er. »Bei Milram war ich immer motiviert für die neue Herausforderung. Natürlich habe ich gemerkt: Du musst jetzt was tun. Du musst erst mal auf das Niveau kommen, musst erst mal schauen, dass du beim Training gut mitkommst, und dann, wie es bei den Rennen geht.«
Auf Mallorca wird auch das Rennprogramm für die Saison besprochen. Die meisten Rennen, die die Sportliche Leitung für ihn ausgesucht hat, sagen ihm nichts. »Ich wusste null komma null, auf was ich mich da einlasse. Die haben gesagt, das ist ein super Rennprogramm für dich, das passt. Mir ist nur aufgefallen, dass das ungefähr drei Mal so viele Rennen waren wie im Jahr davor. Aber ich war ja jetzt auch Profi.«
Seinen ersten Einsatz hat Dominik Nerz im Februar bei der Trofeo Palma de Mallorca, einem Kriterium der fünftägigen Rennserie Mallorca Challenge. Es ist ein harmloser Auftakt. Viele seiner alten Kollegen aus dem U23-Bereich sind dort auch am Start. Aber Nerz steht dort jetzt im Trikot eines Profi-Teams und denkt: »Geil, jetzt geht meine Karriere los.« Weil er an einem Mageninfekt erkrankt, kann er die weiteren Rennen auf der Ferieninsel nicht bestreiten. Danach wird Nerz von Milram zur Murcia-Rundfahrt, zur Katalonien-Rundfahrt und zur Baskenland-Rundfahrt geschickt. Zwischendurch bestreitet er noch das spanische Eintagesrennen Grand Prix Induráin. 19 Renntage und fast 2.800 Rennkilometer in einem Monat. »Das waren schon sehr heftige Wochen«, sagt Nerz damals der Branchenpostille Radsport, die vom Bund Deutscher Radfahrer herausgegeben wird. Das Team stellt ihm für die Rennen jedoch Aufgaben, die ihn nicht überfordern. Mal muss er Flaschen holen, mal ein bisschen vorne im Wind Tempo machen, mal in einer Ausreißergruppe dabei sein. Nerz deutet in diesen Wochen an, dass er durchaus mithalten kann bei den Profis. Für einen 20-Jährigen zeigt er erstaunliche Leistungen. Schon bei der Murcia-Rundfahrt zählt er auf der dritten Etappe beim Tagessieg seines Teamkollegen Luke Roberts zu dessen wichtigsten Helfern. »Dominik fährt hier eine starke Woche und hat sich sehr gut in das Team integriert«, lobt ihn der neue Sportchef Ralf Grabsch. »Erst kurz vor dem Gipfel musste er abreißen lassen. Das war eine ganz stolze Leistung auf dieser Königsetappe.« Auch bei der Katalonien-Rundfahrt sorgt er mit einem vierten Platz im Prolog für Aufsehen. Vor ihm liegen nur sein Mannschaftskollege und Tagessieger Paul Voss sowie der Amerikaner Levi Leipheimer und Andreas Klöden, der Gesamtzweite der Tour de France von 2004 und 2006, den Dominik Nerz als Kind bei den Spielen mit seinen Radkumpels aus Wangen darstellen musste. »Ab da dachte ich: ›Jetzt ist es geschafft, jetzt ist der Nerzi angekommen bei den Profis, jetzt gewinnt er Radrennen.‹«
Ganz so einfach ist die Sache dann doch nicht. Denn während die meisten Topfahrer bei Regen kein Risiko im Zeitfahren eingegangen sind, ist Nerz unbekümmert drauflosgefahren. In den Bergen hat er dagegen Mühe mitzuhalten. Doch eine Woche später bei der Baskenland-Rundfahrt, einem durchaus anspruchsvollen Etappenrennen über sechs Tage, ist Nerz dann als 26. der Gesamtwertung bestplatzierter Milram-Fahrer. Er gewinnt zudem das Trikot des besten Nachwuchsfahrers. Die guten Leistungen werden durchaus registriert. Dominik Nerz merkt, dass die erfahrenen Kollegen auf ihn aufmerksam werden, wissen wollen, wer dieser junge Deutsche ist. Selbst Spitzenfahrer wie der damals noch nicht gesperrte Lance Armstrong oder Andreas Klöden, die er voller Respekt betrachtet, interessieren sich auf einmal für ihn, beglückwünschen ihn zu seinen Leistungen.
Nur Dominik Nerz selbst ist nicht zufrieden. Sein Ehrgeiz ist größer. Wie schon in seiner Zeit als Schüler, als ihn seine Trainer immer wieder bremsen mussten. Nerz erwartet von sich Top-Platzierungen unter den ersten fünf oder zehn. Das ist vermessen für einen noch sehr jungen Neuling im Profigeschäft. Heute weiß er das, damals nicht. »Ich konnte das gar nicht einschätzen. Ein 26. Platz war für mich nichts, was man an die große Glocke hängen muss«, sagt er. Damals klagt er seinem Manager Christian Baumer am Telefon sein Leid. Baumer versichert ihm, so schildert es Nerz, dass er sich auf einem sehr guten Weg befindet. Sein Manager habe ihm gesagt, mit einem 26. Platz bei der Baskenland-Rundfahrt müsse er sich um seine Zukunft keine Sorgen machen.
Die Mischung aus Ehrgeiz gepaart mit Selbstzweifeln ist nicht ungewöhnlich, aber bei Nerz sind die Zweifel besonders stark ausgeprägt. Das fällt auch seinem Sportlichen Leiter beim Team Milram auf. »Er hat die Sache sehr ernst genommen, was einerseits sehr schön, andererseits immer so ein bisschen eine Gefahr ist, wenn man sich zu sehr reinsteigert«, erklärt Jochen Hahn. »Das war schon im Trainingslager an zwei, drei Stellen zu spüren. Wenn es mal nicht so lief, hat er mächtig angefangen zu zweifeln. Da habe ich schon gesehen, er zieht sich selbst runter, wenn es nicht läuft. Das ist keine gute Eigenschaft. Mir war klar, diese Gefahr wird ihn die ganze Karriere begleiten.« Hahn behauptet, er hätte es aus diesem Grund schon damals für besser gehalten, wenn Nerz noch ein, zwei Jahre in der U23 geblieben wäre, »um erst einmal erwachsen zu werden, bevor man Erwachsenensport betreibt«. Doch beim Milram Continental Team, für das Nerz vor seinem Wechsel zu den Profis fuhr, existierte ebenfalls nicht die Struktur, um ihm die notwendige Unterstützung zu geben. »Ich glaube, da hat er fast nie Hilfe gehabt«, sagt Hahn. »Im Profisport ist es dann normal, dass einem keiner mehr hilft. Entweder man kann’s oder man kann’s nicht.«
Nerz ist in seinem ersten Profijahr tatsächlich komplett auf sich alleine gestellt. Offiziell ist Jochen Hahn bei Milram für die Betreuung der Nachwuchsfahrer zuständig. Doch die Zusammenarbeit bleibt oberflächlich, eine gezielte Trainingsplanung findet nicht statt. »Milram hat mir keine fixen Ziele gegeben. Sie haben gesagt, da und da wollen wir dich topfit haben«, erzählt Nerz. Zwar habe sich Hahn zu Beginn des Jahres noch um sein Training gekümmert, das sei im Laufe der Saison allerdings immer weniger geworden. Zum ersten Mal benutzt Dominik Nerz während dieser Zeit ein SRM-System, das Leistungsdaten, Tritt- und Herzfrequenz aufzeichnet. Damit kann man das Training gezielt steuern. Das System ist damals schon Standard im Radsport, aber Nerz kann mit den Daten nichts anfangen, geschweige denn sie auswerten. Auch beim Team interessiert sich niemand dafür. Jochen Hahn sagt, für die Trainingspläne sei ja eigentlich noch Hartmut Täumler zuständig gewesen. Täumler dagegen erzählt, dass die Saison bei Milram das Jahr gewesen sei, in dem er den geringsten Kontakt zu Nerz gehabt hätte. Hahn habe sich auch nicht bei ihm nach seinem Schützling erkundigt. »Für Jochen Hahn gab es eigentlich nur zwei Rennfahrer, für die er gearbeitet hat. Das waren Ciolek und Gerdemann. Auf die hat er sich fokussiert. Alles andere war ihm egal«, glaubt Täumler.
Dominik Nerz stört es nicht, dass er quasi ohne System trainiert. Im Gegenteil, er genießt die Freiheit. Er hat es bis in die ProTour geschafft, weil er seinen Instinkten vertraut hat. Er hat intuitiv gewusst, was notwendig ist, und ist bis hierhin gut damit gefahren. Auch weil er das entsprechende Talent und den nötigen Ehrgeiz mitbringt. Sein Training gestaltet er selbst. Er weiß aus seiner Jugend, dass man im Winter lange, ruhige Einheiten trainiert, dass man später Intervalle einbauen muss. Aber eine gezielte Struktur, bei der die Trainingseinheiten aufeinander aufbauen, kennt er nicht. Sie wird auch nicht verlangt. Wenn er das Gefühl hat, er muss intensiv trainieren, radelt er zu seinem Heimatberg im Allgäu und fährt dort bis oben hin am Anschlag. »Danach war ich komplett erledigt und bin heim«, sagt er. Professionell und zielgerichtet ist das alles nicht. Im Grunde habe er machen können, was er will, sagt Nerz. »Bei Milram hatte ich, sportlich gesehen, die allerbeste Zeit, weil ich mich komplett frei entwickeln durfte. Da war keiner, der mir auf die Finger geklopft hat und gesagt hat: ›Mach komplett alles anders, weil du jetzt Profi bist.‹«
Es ist verständlich, wenn Dominik Nerz rückblickend glaubt, dass seine Karriere anders verlaufen wäre, wenn er noch ein Jahr länger bei Milram hätte fahren können. »Für mich hätte es damals nicht besser laufen können. Ich hatte Spaß an dem, was ich tue. Und ich bin mir sicher, die hätten mich genauso weitermachen lassen, weil ich mich schnell entwickelt habe. Körperlich wie auch geistig«, meint Nerz. »Das hätte mir wahrscheinlich sehr, sehr gut getan.« Man kann aber auch der Ansicht sein, dass der Mangel an professioneller Begleitung beim Team Milram letztlich bedeutet, dass er später, als er sich in einem fremden Umfeld bewegen muss, nichts hat, auf dem er aufbauen kann. Sein langjähriger Trainer sieht das so. »Natürlich konnte er sich bei Milram frei entwickeln, weil sich niemand um ihn gekümmert hat«, sagt Hartmut Täumler. »Das kann man positiv sehen. Schön, wenn er das so sieht. Aber am Ende hat es ihm nicht viel gebracht. Denn so weit war er wirklich noch nicht, dass man hätte sagen können: ›Er kann sich da frei entwickeln.‹ Auf welchen Erfahrungswerten denn? Er kommt aus einem Continental-Team und ist das erste Mal in einem Profiteam. Da hat er doch gar keine Ahnung, wie er sich wohin entwickeln muss. Das kreide ich dem Team an, dass da keine richtige Nachwuchsarbeit gemacht wurde, weil die Fixierung auf bestimmte Leute bestanden hat.«
Nicht einmal Dominik Nerz bestreitet in der Rückschau, dass die Strukturen bei Milram alles andere als professionell waren. »Im Nachhinein sage ich, so kannst du kein WorldTour-Team leiten«, stellt er fest. Dass sich niemand mehr wirklich darum schert, was im und um das Team herum passiert, hängt damit zusammen, dass allen Beteiligten sehr schnell klar wird, dass die Mannschaft keine Zukunft mehr hat. Jochen Hahn sagt, er habe eigentlich schon nach der Teampräsentation im Januar keine Hoffnung mehr gehabt, dass die Mannschaft 2011 noch bestehen werde.
Nicht alle bewerten die Lage schon zu Beginn des Jahres so pessimistisch. Doch es dauert nicht lange, da beginnen die meisten Mitarbeiter des Teams daran zu zweifeln, dass es ihrem Chef Gerry van Gerwen gelingen wird, einen neuen Geldgeber aufzutreiben. »Anfang der Saison waren alle noch optimistisch, aber spätestens Mitte des Jahres war klar, dass es nicht weitergeht«, erinnert sich der ehemalige Milram-Profi Fabian Wegmann, der mit seinem verschmitzten Gesicht und der blonden Lausbubenfrisur auch heute noch einen jungenhaften Charme ausstrahlt, der so schnell nicht zu erschüttern ist. Zu dem Gespräch in einem Café in Münster ist er auf einem Hollandrad gekommen. »Die Fahrer haben dann versucht, ihre eigene Zukunft zu sichern und an sich selbst zu denken«, erzählt Wegmann. Gleiches gilt auch für die Sportlichen Leiter, die sich ebenfalls mehr mit ihrer beruflichen Zukunft beschäftigen als mit den Fragen des Hier und Jetzt bei Milram.
Die Auflösungserscheinungen spiegeln sich auch in den sportlichen Ergebnissen wider. Offiziell sind es diesmal elf Saisonsiege, wobei dazu auch die beiden nationalen Meistertitel von Christian Knees in Deutschland und Niki Terpstra in den Niederlanden zählen. Die beiden Hoffnungsträger Linus Gerdemann und Gerald Ciolek bleiben dagegen erneut hinter den Erwartungen zurück. Ciolek siegt bei einer Etappe der Bayern-Rundfahrt. Gerdemann gewinnt zum Saisonauftakt ein Rennen der Mallorca Challenge, später gelingt ihm noch ein prestigeträchtiger Etappensieg bei der italienischen Rundfahrt Tirreno–Adriatico. Meistens jedoch fahren die Fahrer in den Trikots mit den blau-weißen Kuhflecken hinterher. Ein »liebenswerter Verlierer« sei das Team gewesen, schreibt Cycle Sport in seinem Abgesang am Saisonende. Die Vorgabe von Teamchef Gerry van Gerwen hatte zu Beginn des Jahres wieder 25 Siege gelautet. Aber diesmal ahnt auch er, dass seine Mannschaft keine Chance hat, diesem Ziel auch nur nahe zu kommen. »Wenn die Rennfahrer wissen, die Mannschaft hört auf, läuft das immer mehr auseinander«, muss van Gerwen rückblickend eingestehen.
Anders als sein Personal strahlt der Teamchef gerade in der ersten Jahreshälfte noch den gewohnt großen Optimismus aus. Und es ist nicht nur Zweckoptimismus. »Ich hatte immer Kontakte rechts und links, und kurz vor der Tour de France 2010 hat es tatsächlich so ausgesehen, als hätten wir einen neuen Sponsor. Es gab sogar schon den Prototyp des neuen Trikots«, erzählt van Gerwen. Es ist eine deutsche Firma, die bereit ist, in seine Mannschaft zu investieren. Doch am Ende fehlen knapp drei Millionen Euro, weil die Weltwirtschaftskrise zu diesem Zeitpunkt auch in Deutschland angekommen ist. Der Versuch, Milram noch als Co-Sponsor für diese Summe zu gewinnen, scheitert ebenfalls.
Damit ist das Team Geschichte. Am zweiten Ruhetag der Tour de France 2010 verkündet Gerry van Gerwen offiziell das Aus seiner Mannschaft zum Saisonende. Der Rest ist Mangelverwaltung. »Am Ende musst du froh sein, wenn noch acht Fahrer kommen, wenn du sagst, wir haben noch ein Rennen. Das ist furchtbar«, klagt van Gerwen. Es bleibt nicht die einzige Enttäuschung.