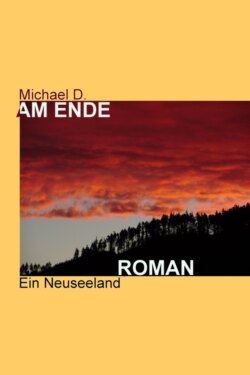Читать книгу AM ENDE - Michael Pain D. - Страница 5
TAG 2
ОглавлениеNach achtstündigem traumlosem Schlaf, der eher einem Koma ähnelte, wache ich auf und brauche eine Minute, um mich zu orientieren. Dann stehe ich auf, dusche mich und mache einen morgendlichen Spaziergang die Saint Stephens Avenue runter Richtung Judges Bay. Vereinzelte Jogger sind unterwegs. Ich verspüre fast den gleichen Kick wie damals vor zwanzig Jahren. Rechts und links wird der Weg von knorrigen Bäumen gesäumt, deren Äste mit ihrem grünen Laub zum Teil bis über die Straße reichen. Holzhäuser hinter weißen Zäunen und Hecken, die meisten zweistöckig, gehobener Mittelstand. In manchen Gärten erheben sich Pappeln, Baumfarne oder Palmen. Ich sehe Gärten mit gepflegten Rasen und verschiedensten Sträuchern. Die meisten Autos stehen in Garagen. Und alles ist in dieses Licht getaucht, welches bei uns im Sommer nie zu sehen ist: satte kontrastreiche Farben und hier und da kleine Wölkchen am strahlend blauen Himmel.
Lichttherapie!
Der Gedanke an den Tod erscheint im Augenblick absurd, genauso wie der Gedanke an das Leben. Ich weiß, dass ich diese Eindrücke nicht ewig halten kann, sie wieder loslassen muss. Sie sind nur Illusion. Ich bin nur Illusion. Alles ist nur Illusion. Es ist angenehm warm, aber auch das ist nur Illusion.
Was ist so schlimm daran?
Nichts. Es ist einfach so, wie es ist.
Am Ende der Straße steige ich die Stufen hinab, blicke auf die Bay links Richtung Hafen. Dann laufe ich langsam zurück, um mir in der Parnell Road Sachen fürs Frühstück zu kaufen: Orangensaft, Schinken, Orangenmarmelade, Butter, Schinken, Eier, löslichen Kaffe, Milch, Zucker, ‚richtiges’ Brot aus einer italienischen Bäckerei. (Toast werde ich noch genug essen.)
Die Sonne scheint. In der Gemeinschaftsküche koche ich ein Ei, nehme mir Besteck und Teller, lasse am Boiler heißes Wasser in die Kaffeetasse laufen und esse wieder draußen.
Die beiden schönen Frauen vom Vorabend packen gerade ihren Sleepervan, in welchem man im Gegensatz zum Campervan nicht aufrecht stehen kann.
Es sitzen noch ein paar andere Reisende an den Tischen und eine Katze schleicht um meine Füße. Mehr Kontakt brauche und will ich im Augenblick nicht.
Nach dem Frühstück mache ich mich zu Fuß auf den Weg in die City. Zuerst gehe ich die Parnell Road hinab. Sie ist eine der Szene- und Restaurantstraßen Aucklands. Vor mir sehe ich einen Teil des Hafens. Nach einer halben Stunde erreiche ich die Queen St. Hier gibt es die einzige wirkliche Skyline Neuseelands, mit bis zu vierzigstöckigen Hochhäusern.
Mein Ziel ist das Intercity-Büro in der Hobson Street, wo ich mir für übermorgen ein Busticket nach Gisborne kaufen will. Doch vorher spaziere ich zum ganz in der Nähe gelegenen Skytower, mit 328 Metern das höchste Gebäude, gleichzeitig Fernsehturm, der südlichen Hemisphäre. Es ist ziemlich touristisch hier. Die Hauptattraktion sind der Blick aus dem sich drehenden Restaurant in fast 200 Metern Höhe und der ‚Skyjump’, eine Art Bungee-Jumping in der Mitte von zwei Brems- und Positionshalteseilen. Ich habe kein Interesse an einem Sprung. Beim bloßen Gedanken daran verspüre ich ein Ziehen von meinem Steißbein bis in den Hinterkopf.
Ich brauche kein Adrenalin, ich brauche keinen Kick. Nur eine Inspiration. Springen. Ist das eine Möglichkeit?
In Chad Taylors Roman Shirker stürzt nur fünf Minuten entfernt von hier auf mysteriöse Weise ein Mann aus dem fünften Stock in den Tod.
Ich löse ein Ticket und fahre mit dem Lift nach oben. Die Aussicht aus den Panoramafenstern, es gibt sogar in den Boden eingebaute Glasfenster, ist grandios. Selbst die Hochhäuser drum herum wirken wie Zwerge. Die ganze Stadt liegt mir zu Füßen, in der Ferne sehe ich Hügel mit Wohnhäusern und dahinter die Bergketten. Im Norden liegt der Hafen und nordöstlich sind Rangitoto Island und andere Inseln im Hauraki Gulf zu erkennen.
Vor mir schwebt an einem Seil ein Mensch mit angespanntem Gesichtsausdruck in der Luft und sinkt plötzlich in die Tiefe, wird nach wenigen Sekunden zu einem ... Punkt ... Menschenpunkt.
Ich inspiziere die Fenster und stelle fest, dass alles hermetisch abgeschlossen ist. Ein Suizid ist so gut wie ausgeschlossen. Vielleicht wäre es möglich, dort hängend, mit einer Zange das Seil zu durchtrennen.
Und dann?
Nur ein paar Sekunden bis zum Aufschlag.
Nimmt man diese Sekunden noch bewusst wahr, ziehen sie sich subjektiv in die Länge, wird es der häufig beschriebene Flug durch einen Lichttunnel? Wird man schon während des Sturzes ohnmächtig, blendet also alles aus? Wird es zum ultimativen Adrenalin-Kick? Oder bereut man es augenblicklich und will zurück? Und was ist mit dem Schmerz beim Aufprall? Wird er für Bruchteile einer Sekunde wahrgenommen? Oder wird auch er in die Länge gezogen?
Vor einigen Jahren beging eine manisch depressive Bekannte von mir Selbstmord. Was für ein hässlicher Ausdruck! Denn er beinhaltet das Wort ‚Mord’. Ich werde im weiteren Verlauf des Tagebuchs andere Begriffe wählen. Aber zurück zu der Bekannten. Sie fuhr mit dem Lift in den zehnten Stock einer Klinik und sprang über die Brüstung. Einige Tage nach ihrem Suizid schaute ich mir die Stelle an. Sie lag fast abgeschieden und in zehn Minuten begegnete mir kein Mensch. Unten war kein Strauch, kein Baum, kein Rasen, kein Mensch und nicht einmal ein Parkplatz zu sehen. Nur purer Asphalt oder Beton - todsicher.
Ja, sie war vermutlich sofort tot.
Unten im Cafe saß eine Freundin von ihr, der sie vor dem Sprung ihre Handtasche mit den Abschiedsbriefen, die sie vorher zu Hause geschrieben hatte, anvertraute. Von ihrem beabsichtigten Suizid sagte sie ihrer Freundin natürlich nichts. Sie sagte lediglich, dass sie mal kurz auf die Toilette müsste.
Nein! Springen ist nicht mein Ding. Nicht vom Dach eines Hochhauses. Vielleicht in den Schlund eines Vulkans, von denen es in Neuseeland einige gibt.
Ich löse mein Busticket in der Hobson Street und laufe noch eine Weile durch die Straßen der City, verlasse diese, gehe an der Art Gallery vorbei, und erreiche nach zehn Minuten die Auckland Domain, Aucklands ältesten und größten öffentlichen Park, eine grüne Lunge auf einem sanften Hügel, einem der ältesten fünfzig Vulkane des Aucklandfeldes.
Mein Ziel ist das War Memorial Museum, Neuseeland ältestes Museum, erbaut in neoklassizistischen Stil, eröffnet 1929. Ein prächtiger Bau mit großem Eingangsportal.
Ich schaue mit zuerst die Kriegsgedenkstätte an. In zwei Gedächtnishallen sind an den Wänden die Namen aller neuseeländischen Soldaten aufgelistet, die in Kriegen und Konflikten des 20. Jahrhunderts ums Leben kamen.
In der Ausstellung sind alte Kampfflieger aus dem Zweiten Weltkrieg zu sehen und sogar ein Schützengraben, den man von Gefechtslärm begleitet durchschreiten kann, ist nachgebaut. An einer Wand hängt eine Fahne mit einem spiegelverkehrten Hakenkreuz?! Absicht? Oder Fehler?, frage ich mich.
Aber das Museum bietet nicht nur Kriegserinnerungen, sondern auch über siebenhundert Jahre Maorikultur in Form von Kunstgegenständen, alten Fotos, Kanus und kompletten Holzgebäuden, darunter ein traditionelles Versammlungshaus mit Holzschnitzereien. Ich lese, dass das Wort Maori ‚natürlich’ bedeutet. Sie kamen ursprünglich aus Ost-Polynesien, führten untereinander Kriege und sogar Kannibalismus soll es gegeben haben. Lange plünderten sie die Natur, brannten ganze Wälder nieder, nur um die letzten Moas, die bis zu 270 kg schweren ausgestorbenen Laufvögel, hinauszutreiben. Und 1769 landete schließlich James Cook und löste die Besiedlungswelle aus. Immer mehr Pakeha, so nennen die Maori die europäischen Einwanderer, kamen, vor allem von den Britischen Inseln. Zwischen 1843 und 1872 kam es zu den Neuseelandkriegen zwischen den Maori und den neuen Siedlern, die immer mehr von britischen Soldaten unterstützt wurden. Die Maori wurden weitgehend enteignet. Erst 2008 wurden sie vertraglich entschädigt und die Stämme wurden wieder zu den größten Waldbesitzern Neuseelands, welches insgesamt noch 24 % Waldfläche hat. Dennoch geht es den Maori in Bezug auf Arbeitslosigkeit und Ausbildung auch heute noch schlechter als den Pakeha.
Immerhin sind sie sehr viel besser in die Gesellschaft integriert als zum Beispiel die Aborigines in Australien. 2008 entschuldigte sich dort Premierminister Kevin Rudd für das Unrecht, welches die Weißen ihnen in der Vergangenheit angetan hatten. Die neuseeländische Regierung entschuldigte sich bereits 1999 bei den Maori.
Zwei Maori veranstalten mit heraushängenden Zungen einen lauten Kriegstanz und Touristen stellen sich anschließend zwischen die beiden, um sich fotografieren zu lassen. Über die Authentizität dieser ‚Show’ lässt sich streiten.
Mein persönlicher Museumsfavorit ist der 1:1 Nachbau einer Straße in Auckland aus dem Jahre 1866. Ein Pub, eine Apotheke, ein Sattler, ein Buchladen, ein Tabakladen, eine Wohnstube und mehr sind bis ins Detail nachgebaut und mit unzähligen Gegenständigen aus der damaligen Zeit ausgestattet.
Ich gehe zu Fuß zum Backpackers zurück. Unterwegs lasse ich Geld an einem ATM-Automaten heraus, besorge mir in der Parnell Road etwas beim Thai Takeaway (meinem Lieblings-Takeaway) und kaufe eine Flasche australischen Rotwein. Der neuseeländische ist zwar sehr gut, aber teurer.
Ich esse wieder draußen an den Tischen, an denen ich ein paar neue Gesichter sehe, aber auch bereits bekannte. Ein Mann Mitte vierzig, mittelgroß, breitschultrig, unrasiert mit zwei Narben, eine an der linken Schläfe und eine am Hals, kommt leicht humpelnd an meinen Tisch und fragt auf Englisch, ob ein Platz frei sei. Ich sage widerwillig ja und esse weiter. Er fragt mich, wo ich herkomme. Ich beantworte seine Frage und stelle ihm die gleiche. Er entpuppt sich als Deutscher aus Frankfurt.
Das passt irgendwie, denke ich.
Ich ordne ihn spontan irgendeinem dunklen Frankfurter Milieu zu und bleibe kurz angebunden. Er erzählt, dass er bereits seit fünf Wochen unterwegs ist und übermorgen wieder zurückfliegen muss.
„Ich will nicht zurück“, sagt er und seine Augen werden feucht.
Feuchte Augen passen nicht zu dem Typ, denke ich.
Ich schaue ihn nur fragend an.
„Mit Neuseeland hatte ich mir einen Traum erfüllt und der endet jetzt. Ich will nächste Woche nicht wieder anfangen zu arbeiten.“
Ich traue mich nicht, ihm darauf zu sagen, dass mein Urlaub gerade erst beginnt und ich traue mich noch viel weniger, ihm zu sagen, dass mein Leben bald enden wird.
„Ist deine Arbeit so schlimm?“, frage ich ihn stattdessen.
„Ich bin Elektroingenieur. Ist eigentlich okay, aber immer häufiger ödet mich der Job trotzdem an, und jetzt natürlich erst recht.“
Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Das mit dem Anöden verstehe ich ganz gut. Ich werfe ihm nur einen verständnisvollen Blick zu, der bei ihm anzukommen scheint.
„Tut mir leid. Das war jetzt kurz, aber ich muss noch ein paar Dinge für den Rückflug erledigen“, sagt er mit gequältem Lächeln und erhebt sich. „Wie heißt du übrigens?“
„Michael“, sage ich.
„Rudi, hat mich gefreut. Vielleicht sieht man sich morgen noch einmal.“
„Ja, wer weiß.“
Er gibt mir die Hand, dreht sich um und geht ins Haus.
Viele der Leute im Backpackers sind für ein Jahr mit einem ‚Working Holiday Visum’ unterwegs. Für die meisten ist Auckland der Ausgangspunkt, für einen kleineren Teil Christchurch auf der Südinsel, weil es auch dort einen internationalen Flughafen gibt. Einige arbeiten direkt erst einmal hier vor Ort, zum Beispiel in einem Backpackers oder Cafe. Andere reisen nach einigen Tagen in die verschiedensten Regionen des Landes, um Kiwis, Äpfel und/oder Trauben zu ernten/pflücken.
Die wenigsten hier sind auf Sauftour, wie zum Beispiel auf dem Ballermann in Mallorca. Kaum einer ist nur für ein paar Wochen hier. Viele sind inspiriert von der neuseeländischen Outdoor-Mentalität.
Die richtigen Adrenalinfreaks zieht es vor allem auf die Südinsel nach Queenstown. Geboten werden dort Para- und Hanggliding, Jetboat, Bungee-Jumping, Mountainbike, Skifahren im Winter und einiges mehr.
Und für die zahlreichen Surfer gibt es jede Menge Spots, der bekannteste ist wahrscheinlich Raglan.
Mittlerweile haben sich ein Schweizer um die dreißig mit dunklen kurzen Haaren und Brille, ein junger etwas schüchtern wirkender Bayer mit Wuschelkopf und ein junger achtzehnjähriger Deutscher an meinen Tisch gesetzt.
Abgesehen von mir trinkt niemand Alkohol.
Der Schweizer, Urs, empfiehlt mir eine Maori-Massage in Ngongotaha nahe Rotorua. Er bewegt sich mental irgendwo zwischen Spiritualität und Intellektualität.
Der Bayer mit Namen Tobias kommt gerade aus dem Nordland und erzählt, dass der dortige Ninety Mile Beach gar nicht neunzig Meilen, sondern nur neunzig Kilometer lang ist und jemand bei der Namensgebung vermutlich die Maßeinheiten vertauscht hat. Darüber hinaus gilt er als offizielle Straße, sogar für Busse. Beeindruckt haben ihn die Mangroven und der Wald mit den Kauribäumen. Das älteste Exemplar, der T?ne Mahuta, soll 2.000 Jahre alt sein.
Ein Österreicher mit Namen Jörg, Mitte vierzig, barfuß und mit Pferdeschwanz, stößt hinzu und setzt sich neben mich. Ich habe ihn bei meiner Ankunft im Garten jonglieren sehen. Er sagt, dass er Lehrer ist und sich eine einjährige Auszeit genommen hat. Ein lockerer Typ, der mit seinem Leben zufrieden zu sein scheint.
Warum habe ich nie so einen Lehrer gehabt, frage ich mich?
Der Deutsche, der sich als Simon vorstellt hat, erzählt, dass er Ski- und Surflehrer sei und dass er sich beim Basketballspielen schon sämtliche Finger gebrochen habe, zum Teil sogar mehrmals. Bei allen Gesprächsthemen wirkt er fast beängstigend allwissend, aber gleichzeitig sehr unemotional. Er behauptet, auch jonglieren zu können. Der Österreicher gibt ihm seine drei Bälle, doch Simons Versuche scheitern kläglich.
Was ist Bluff bei ihm, was nicht?, frage ich mich.
Jörg kommt aus der Nähe von Dornbirn, der einzigen Gegend Österreichs, die ich ein wenig kenne. Ich gestehe ihm, dass ich durch den Kontakt mit den Menschen dort meine Vorurteile gegen sein Land stark reduziert habe.
„Reduziert? Das heißt, ein paar hast du schon noch“, sagt er.
„Na ja, vielleicht, aber ich arbeite dran.“
„Du musst nicht alle Österreicher mögen. Ich denke da zum Beispiel an Peter Alexander oder ... Adolf Hitler.“
„Da kann ich nicht widersprechen.“
Die anderen tragen ihre Erfahrungen zum Thema Vorurteile bei. Zwei Deutsche, ein Bayer, ein Österreicher und ein Schweizer: die ideale Kombination für die Erörterung von Klischees im deutschsprachigen Raum.
Nachdem sich das Thema erschöpft hat, rede ich noch eine Weile mit Jörg. Ich erfahre von ihm, dass er in der Mittelschule die 10 - 14-jährigen in Sport und Englisch unterrichtet, seit drei Monaten auf der Nordinsel herumreist und erst wieder im September ins neue Schuljahr einsteigen wird.
Um 22:00 Uhr steht Jörg auf, um sich zu verabschieden.
„Tut mir leid, aber ich muss ins Bett. Ich muss morgen früh raus, um meine Schwester vom Flughafen abzuholen. Ich fahre mit ihr zusammen noch für ein paar Wochen auf die Südinsel, bevor es wieder nach Hause geht.“
Gegen 23:00 Uhr gehe ich in mein Zimmer, schreibe die Tagesereignisse auf und trinke ein Glas Rotwein dazu. Meinen Jetlag habe ich fast überwunden. Vor dem Schlafen werde ich noch ein paar Seiten in Crime Story von Maurice Gee lesen.