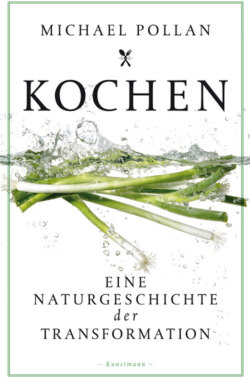Читать книгу Kochen - Michael Pollan, Michael Pollan - Страница 5
На сайте Литреса книга снята с продажи.
VORWORT Warum kochen? I.
ОглавлениеAn einem bestimmten Punkt in der späten Mitte meines Lebens machte ich die unerwartete, aber erfreuliche Entdeckung, dass die Antwort auf mehrere der Fragen, die mich am meisten beschäftigten, tatsächlich ein und dieselbe war.
Kochen.
Einige dieser Fragen waren privater Natur. Zum Beispiel: Was war das Allerwichtigste, was wir als Familie tun konnten, um unsere Gesundheit und unser allgemeines Wohlbefinden zu verbessern? Oder: Wie konnte ich einen besseren Draht zu meinem pubertierenden Sohn finden? Als der beste Weg erwies sich neben den gängigen Verfahren des Kochens und Zubereitens eine spezielle Form davon, nämlich das Brauen. Andere Fragen waren dagegen etwas politischer. Schon seit Jahren hatte ich nach der Antwort auf eine Frage gesucht, die mir oft gestellt wird: Was ist das Wichtigste, was ein Durchschnittsmensch tun kann, um dazu beizutragen, die amerikanische Nahrungsmittelwirtschaft zu reformieren und sie gesünder und nachhaltiger zu machen? Eine weitere, damit zusammenhängende Frage lautet: Wie können Menschen, die in einer hoch spezialisierten Konsumgesellschaft leben, von ihr unabhängiger werden? Schließlich waren da noch die eher philosophischen Fragen, über die ich brütete, seit ich mit dem Bücherschreiben begann. Zum Beispiel die, wie wir in unserem täglichen Leben zu einem tieferen Verständnis der Natur und der besonderen Rolle unserer Spezies darin kommen können. Natürlich kann man sich mit derlei Fragen auf einem Waldspaziergang auseinandersetzen, ich stellte allerdings fest, dass man auf weit interessantere Antworten stößt, indem man einfach in die Küche geht.
Das hätte ich, wie gesagt, nie erwartet. Kochen gehörte immer zu meinem Leben, allerdings eher so wie meine Möbel, also nicht als Untersuchungsobjekt und Forschungsfeld, geschweige denn war es eine Leidenschaft. Ich schätzte mich glücklich, ein Elternteil – meine Mutter – zu haben, das gerne kochte und uns fast jeden Abend eine köstliche Mahlzeit vorsetzte. Da ich als Kind oft in der Küche herumhing, während meine Mutter das Essen zubereitete, kam ich an diesem Ort ganz gut zurecht, als ich schließlich in eine eigene Wohnung zog. Dort kochte ich zwar, wenn ich Zeit dazu hatte, doch ich nahm mir selten Zeit dafür und dachte auch nicht groß darüber nach. So hatten sich meine Kochkenntnisse kaum weiterentwickelt, als ich dreißig wurde. Ehrlich gesagt verließ ich mich bei der Zubereitung meiner erfolgreichsten Gerichte stark auf die Kochkünste anderer, wenn ich etwa meine leckere Salbeibutter über fertig gekaufte Ravioli träufelte. Ab und zu schaute ich in ein Kochbuch oder schnitt ein Rezept aus der Zeitung aus, um mein kleines Repertoire durch ein neues Gericht zu erweitern. Oder ich kaufte ein neues Küchenutensil, allerdings lagen die meisten dieser Anschaffungen am Ende unbenutzt im Schrank herum.
Im Rückblick überrascht mich mein geringes Interesse am Kochen, da mein Interesse an allen anderen Gliedern der Nahrungskette immer groß war. Seit meinem achten Lebensjahr habe ich gegärtnert, besonders Gemüse angebaut, und es hat mir immer Spaß gemacht, mich auf Farmen herumzutreiben und über Landwirtschaft zu schreiben. Ich habe auch schon recht viel über das andere Ende der Nahrungskette geschrieben – über das Essen, meine ich, und über den Einfluss unserer Ernährung auf unsere Gesundheit. Aber über die mittleren Glieder der Nahrungskette, über die Verwandlung von Natur in Dinge, die wir essen und trinken, machte ich mir eigentlich keine großen Gedanken.
Das änderte sich erst, als ich ein merkwürdiges Paradox zu ergründen versuchte, das mir beim Fernsehen bewusst geworden war: Wie kommt es, dass wir Amerikaner in einer Zeit, in der wir die Zubereitung unserer Mahlzeiten zunehmend der Lebensmittelindustrie überlassen, immer mehr Zeit damit zubringen, über Nahrungsmittel nachzudenken und anderen Leuten im Fernsehen beim Kochen zuzusehen? Je weniger wir in unserem eigenen Leben selbst kochen, desto mehr faszinieren uns anscheinend Nahrungsmittel und deren Zubereitung durch andere.
Die Amerikaner befinden sich, was dieses Thema betrifft, offenbar in einem Zwiespalt. Statistiken bestätigen, dass wir von Jahr zu Jahr weniger selbst kochen und immer mehr Fertiggerichte kaufen. Die Zeit, die in amerikanischen Haushalten auf die Zubereitung von Mahlzeiten verwendet wird, halbierte sich seit der Mitte der 60er-Jahre, in denen ich meiner Mutter beim Kochen zuschaute, auf knapp 27 Minuten pro Tag. Die Amerikaner verbringen damit weniger Zeit als der Rest der Welt, der generelle Abwärtstrend ist jedoch global. Gleichzeitig reden wir dafür mehr übers Kochen – und sehen anderen beim Kochen zu, lesen Bücher darüber und gehen in Restaurants, in denen wir live mitverfolgen können, wie dort gekocht wird. Wir leben in einer Zeit, in der Profiköche prominent sind, einige von ihnen sind so berühmt wie Sport- oder Filmstars. Die gleiche Tätigkeit, die viele Menschen als Plackerei betrachten, gelangte irgendwie in den Rang eines beliebten Zuschauersports. Wenn man sich überlegt, dass 27 Minuten weniger Zeit sind, als eine Folge von Top Chef oder The Next Food Network Star dauert, wird einem klar, dass inzwischen Millionen von Menschen mehr Zeit damit zubringen, Kochsendungen im Fernsehen anzuschauen, als selbst zu kochen. Ich muss wohl nicht darauf hinweisen, dass wir die Gerichte, die im Fernsehen gekocht werden, nicht zu essen bekommen.
Das ist schon eigenartig. Schließlich schauen wir uns ja auch keine Fernsehsendungen übers Nähen, Sockenstopfen oder den Ölwechsel beim Auto an und lesen auch keine Bücher darüber. Diese drei anderen häuslichen Tätigkeiten haben wir nur zu gern anderen überlassen – und dann umgehend aus unserem Bewusstsein verbannt. Kochen hingegen ist irgendwie etwas anderes. Diese Arbeit, oder dieser Prozess, hat sich einen emotionalen oder psychologischen Reiz bewahrt, dem wir uns nicht ganz entziehen können oder wollen. Und tatsächlich fragte ich mich, nachdem ich etliche Kochsendungen im Fernsehen angeschaut hatte, ob das Kochen, das mir immer als etwas Selbstverständliches erschienen war, es vielleicht verdiente, etwas ernster genommen zu werden.
Ich entwickelte ein paar Theorien, um das »Kochparadox«, wie ich es nannte, zu erklären. Die erste und naheliegendste lautet, dass anderen beim Kochen zuzusehen eigentlich gar kein neues menschliches Verhalten ist. Selbst als noch »alle« kochten, gab es viele, die hauptsächlich zuschauten: Männer zum größten Teil und Kinder. Die meisten von uns erinnern sich gerne daran, wie sie früher in der Küche ihrer Mutter bei der Arbeit zuschauten. Ihre Kochkünste sahen manchmal aus wie Hexerei, und das Ergebnis war üblicherweise ein leckeres Essen. Im alten Griechenland gab es für »Koch«, »Metzger« und »Priester« nur ein Wort – mageiros. Es hat eine gemeinsame etymologische Wurzel mit dem Wort »Magie«. Ich jedenfalls sah immer fasziniert zu, wenn meine Mutter ihre magischsten Gerichte zauberte, zum Beispiel ihre panierten Hähnchenrouladen Kiew. Wenn man sie mit einem scharfen Messer aufschnitt, quollen geschmolzene Butter und würzige Kräuter heraus. Selbst wenn meine Mutter nur gewöhnliches Rührei machte, fand ich es fesselnd, wie der klebrige gelbe Schleim die Form von duftenden Goldnuggets annahm. Noch das alltäglichste Gericht durchläuft einen magischen Verwandlungsprozess, nach dem es etwas mehr ist als die Summe seiner Zutaten. Und in fast jedem Gericht finden sich neben den kulinarischen Zutaten auch die Bestandteile einer Geschichte: ein Anfang, eine Mitte und ein Ende.
Dann sind da noch die Köche selbst, die Helden, die diese kleinen Verwandlungsschauspiele aufführen. Die Rhythmen und Abläufe ihrer Arbeit verschwinden zwar allmählich aus unserem eigenen Alltag, dennoch ziehen sie uns an. Diese Arbeit wirkt so viel konkreter und befriedigender als die eher abstrakten Tätigkeiten, die die meisten von uns heutzutage in ihren Jobs ausführen. Köche haben es nicht nur mit Tastaturen oder Bildschirmen zu tun, sondern nehmen so ursprüngliche Dinge wie Pflanzen, Tiere und Pilze in die Hände. Und sie arbeiten mit den Urelementen Feuer, Wasser, Luft und Erde. Sie beherrschen sie und nutzen sie für ihre köstliche Alchemie. Wie viele von uns üben noch Tätigkeiten aus, bei denen sie in so direktem Kontakt zur materiellen Welt stehen, der – vorausgesetzt, die Hähnchenrouladen Kiew laufen nicht vorzeitig aus oder das Soufflé fällt zusammen – am Ende zu einem so befriedigenden und appetitlichen Ergebnis führt?
Der Grund, warum wir gerne Kochsendungen ansehen und Bücher übers Kochen lesen, könnte also sein, dass das Kochen einige Aspekte hat, die wir wirklich vermissen. Wir denken vielleicht, wir hätten nicht genug Zeit, Energie oder Kochkenntnisse, um jeden Tag selbst zu kochen, wir wollen das Kochen jedoch nicht vollständig aus unserem Leben verschwinden sehen. Wenn es, wie Anthropologen meinen, eine prägende menschliche Tätigkeit ist – der Akt, mit dem nach Lévi-Strauss Kultur überhaupt beginnt –, dann sollte es uns nicht überraschen, dass es tiefe emotionale Saiten in uns berührt, wenn wir zusehen, wie sich die Prozesse des Kochens vor uns offenbaren.
Die Vorstellung, das Kochen sei eine entscheidende menschliche Tätigkeit, ist nicht neu. So schrieb der schottische Autor James Boswell 1773 den Satz »Kein Tier ist ein Koch« und nannte den Homo sapiens »das kochende Tier«. Womöglich hätte er diese Definition noch einmal überdacht, wenn er die Tiefkühlabteilungen unserer heutigen Supermärkte hätte sehen können. Fünfzig Jahre später behauptete der französische Gastrosoph Jean Anthelme Brillat-Savarin in seiner Physiologie des Geschmacks, das Kochen mache uns zu dem, was wir sind. Indem es die Menschen lehrte, das Feuer zu nutzen, habe es am stärksten zur Entwicklung der Zivilisation beigetragen. 1964 berichtete Lévi-Strauss in Das Rohe und das Gekochte, dass in vielen Kulturen der Welt eine ganz ähnliche Auffassung herrscht, wonach das Kochen als symbolische Handlung den Unterschied zwischen Mensch und Tier ausmacht.
Für Lévi-Strauss war das Kochen eine Metapher für die Verwandlung von roher in gekochte Natur durch den Menschen. In den Jahrzehnten nach der Veröffentlichung von Das Rohe und das Gekochte griffen andere Anthropologen seine Vorstellung auf, die Erfindung des Kochens könne der evolutionäre Schlüssel zu unserer Menschlichkeit sein. Vor einigen Jahren veröffentlichte Richard Wrangham, ein Anthropologe und Primatenforscher von der Harvard-Universität, ein bestechendes Buch mit dem Titel Feuer fangen, in dem er argumentierte, es sei die Erfindung des Kochens durch unsere frühen Vorfahren – und nicht die Herstellung von Werkzeugen, der Verzehr von Fleisch oder die Sprache – gewesen, die uns vom Affen abhob und menschlich machte. Seiner »Kochhypothese« zufolge veränderte das Aufkommen gekochter Nahrung den Verlauf der menschlichen Evolution. Weil diese Kost energiereicher und leichter verdaulich war, konnten die Gehirne unserer Vorfahren wachsen (denn Gehirne sind notorische Energiefresser) und ihre Verdauungsorgane schrumpfen. Da es viel mehr Zeit und Energie kostet, rohe Nahrung zu kauen und zu verdauen, haben Primaten unserer Größe einen deutlich größeren Verdauungstrakt als wir und verbringen viel mehr Zeit mit Kauen – etwa sechs Stunden am Tag.
Das Kochen nahm uns also sozusagen einen Teil der Arbeit des Kauens und Verdauens ab und vollzog ihn außerhalb unseres Körpers, unter Verwendung äußerer Energiequellen. Zudem konnten wir mit dieser neuen Technologie viele mögliche Kalorienlieferanten entgiften und uns dadurch neue Nahrungsquellen erschließen, die andere Lebewesen nicht nutzen konnten. Als die Menschen nicht mehr den ganzen Tag lang große Mengen roher Nahrung sammeln und stundenlang kauen mussten, konnten sie die so gesparte Zeit und Energie für andere Zwecke wie die Entwicklung einer Kultur nutzen.
Tatsächlich bescherte uns das Kochen aber nicht nur die Mahlzeit, sondern auch die Möglichkeit, zu einer bestimmten Zeit an einem bestimmten Ort gemeinsam zu essen. Das war etwas Neues unter der Sonne, denn als wir noch den ganzen Tag mit der Suche nach roher Nahrung beschäftigt waren, aßen wir wahrscheinlich unterwegs und allein, wie alle anderen Tiere – beziehungsweise wie die Konsumenten industriell verarbeiteter Nahrung, zu denen wir in den letzten Jahrzehnten geworden sind, die sich an einer Tankstelle Fertigsnacks besorgen und sie allein futtern, wann immer und wo immer sie wollen. Doch als wir uns zu gemeinsamen Mahlzeiten ums Feuer versammelten, Augenkontakt herstellten, Essen teilten und Selbstbeherrschung übten, förderte dies unsere Zivilisierung. Um dieses Feuer herum »wurden wir zahmer«, schrieb Wrangham.
So veränderte uns das Kochen, und zwar nicht nur, indem es uns geselliger und umgänglicher machte. Sobald es uns erlaubte, unsere kognitive Kapazität auf Kosten der Kapazität unseres Verdauungssystems zu erweitern, gab es kein Zurück mehr: Unsere großen Gehirne und kleinen Verdauungsorgane machten uns von gekochtem Essen abhängig. (Rohköstler aufgemerkt!) Das bedeutet, dass das Kochen nun eine Notwendigkeit ist – es wurde sozusagen in unsere Biologie einprogrammiert. Was Winston Churchill einmal über Architektur sagte – »Zuerst gestalten wir Gebäude, dann gestalten sie uns« –, könnte auch übers Kochen gesagt werden. Zuerst veränderten wir unsere Nahrung, dann veränderte sie uns.
Sollte das Kochen für die menschliche Identität, Biologie und Kultur von so entscheidender Bedeutung sein, wie Wrangham annimmt, leuchtet es ein, dass sein Rückgang beträchtliche Konsequenzen für das moderne Leben hat. Sind diese Konsequenzen alle negativ? Keineswegs. Die Möglichkeit, einen großen Teil der Kocharbeit Unternehmen zu überlassen, befreite die Frauen von ihrer traditionell alleinigen Verantwortung für die Ernährung der Familie und erleichterte es ihnen, außer Haus zu arbeiten und Karriere zu machen. Diese Alternative zum Selbstkochen verhinderte oder entschärfte viele der Konflikte und häuslichen Streitigkeiten, die eine derart große Veränderung der Geschlechterrollen und der Familiendynamik auslösen musste. Sie half uns, alle möglichen anderen Belastungen des Familienlebens – wie längere Arbeitstage oder übervolle Terminkalender der Kinder – zu bewältigen, und sparte uns Zeit, die wir nun in andere Aktivitäten investieren konnten. Überdies brachte sie erheblich mehr Abwechslung in unseren Speiseplan. Selbst Leute ohne Kochkenntnisse und mit wenig Geld können an jedem Abend der Woche eine andere Küche genießen. Alles, was es dazu braucht, ist eine Mikrowelle.
Das sind große Vorteile. Doch was sie uns kosten, beginnen wir erst jetzt zu begreifen. Das industrielle Kochen hat gravierende Auswirkungen auf unsere Gesundheit und unser Wohlbefinden. Unternehmen kochen ganz anders als Privatleute oder Profiköche, weshalb wir ihre Tätigkeit auch nicht kochen nennen, sondern »Lebensmittelverarbeitung«. Sie verwenden in der Regel viel mehr Zucker, Fett und Salz als Leute, die für andere Leute kochen. Und sie setzen neue chemische Zutaten ein, die in privaten Speisekammern kaum zu finden sind, um ihre Lebensmittel haltbarer zu machen und frischer aussehen zu lassen, als sie sind. Deshalb überrascht es nicht, dass der Rückgang des Selbstkochens mit einer Zunahme von Fettleibigkeit und aller ernährungsbedingten chronischen Krankheiten einhergeht.
Der Siegeszug des Fast Food und der Niedergang des Selbstkochens haben auch die Tradition der gemeinsamen Mahlzeit ausgehöhlt. Wir haben uns daran gewöhnt, unterschiedliche Dinge zu essen, oft unterwegs und allein. Statistiken besagen, dass wir mehr Zeit damit verbringen, »nebenher zu essen«, als richtige Mahlzeiten einzunehmen: Der fast ständige Nebenher-Konsum von Fertigsnacks wird inzwischen »secondary eating« genannt, während »primary eating« die recht deprimierende Bezeichnung für die altehrwürdige Tradition der Mahlzeit ist.
Die gemeinsame Mahlzeit ist keine Belanglosigkeit, sondern ein Grundpfeiler des Familienlebens. Dabei lernen unsere Kinder die Kunst der Konversation und die Umgangsformen der Zivilisation: Sie lernen sich mitzuteilen, anderen zuzuhören, zu warten, bis sie an der Reihe sind, Streitigkeiten beizulegen, zu argumentieren, ohne zu beleidigen. Die sogenannten »kulturellen Widersprüche des Kapitalismus« – seine Tendenz, die stabilisierenden sozialen Formen, von denen er abhängt, zu untergraben – prägen die heutigen amerikanischen Essgewohnheiten ebenso wie all die grellbunt verpackten Fertigprodukte, die die Lebensmittelindustrie erfolgreich auf unsere Esstische brachte.
Ich weiß, das sind recht pauschale Argumente für die zentrale Bedeutung des Kochens (und des Nicht-Kochens) in unserem Leben, und ein oder zwei Einwände sind durchaus in Ordnung. Unser Entscheidungsspielraum ist heute natürlich größer, als ich ihn darstellte. Wir haben nicht nur die Wahl, entweder eine Mahlzeit von Grund auf selbst zu kochen oder von Unternehmen zubereitetes Fast Food zu konsumieren. Die meisten von uns entscheiden sich für irgendetwas dazwischen. Wir bewegen uns zwischen den beiden Polen hin und her, je nach Wochentag, Anlass oder Stimmung. Vielleicht kochen wir am einen Abend alles selbst und am anderen gehen wir essen oder bestellen uns eine Mahlzeit nach Hause, oder wir improvisieren und nutzen dabei die vielfältigen und praktischen Möglichkeiten, uns das Kochen zu vereinfachen, die eine industrialisierte Lebensmittelwirtschaft bietet: die Packung Spinat aus der Tiefkühltruhe, die Dose Wildlachs aus der Speisekammer, die fertig gekauften Ravioli aus einem Laden in der Nachbarschaft oder vom anderen Ende der Welt. Seit vor über einem Jahrhundert die ersten abgepackten Lebensmittel in die Küchen gelangten, hat sich die Definition von »selbst kochen« verändert – so sehr, dass sie es mir erlaubte, meine Fertigravioli mit selbst gemachter Salbeibuttersoße als kulinarische Heldentat zu betrachten. Unter der Woche greifen die meisten von uns beim Kochen mal mehr und mal weniger auf verarbeitete Lebensmittel zurück. Neu ist jedoch, dass inzwischen sehr viele Leute an den meisten Abenden Fertiggerichte essen, die sie nur noch warm machen müssen. Alles andere hat die Lebensmittelindustrie bereitwillig für sie erledigt. »Auf ein Jahrhundert abgepackter Lebensmittel folgt nun ein Jahrhundert abgepackter Mahlzeiten«, erklärte mir ein Lebensmittelmarktforscher.
Das ist nicht nur ein Problem für unser aller Gesundheit oder unser Familienleben. Uns geht auch das Bewusstsein dafür verloren, wie unser Essen uns mit der Welt verbindet. Wir entfernen uns immer weiter von jeder direkten physischen Beteiligung an den Prozessen, durch die Rohstoffe der Natur in eine gekochte Mahlzeit verwandelt werden, und dadurch verändert sich unser Verständnis von Nahrung. Es ist tatsächlich schwer zu glauben, dass ein Essen etwas mit Natur, menschlicher Arbeit oder Fantasie zu tun hat, wenn es fertig zubereitet aus einer bunten Packung kommt. Essen wird einfach zu einem weiteren Konsumgut, zu etwas Abstraktem. Und sobald das geschieht, werden wir zu einer leichten Beute für Unternehmen, die künstliche Versionen von echter Nahrung verkaufen – ich nenne sie essbare nahrungsähnliche Substanzen. Am Ende versuchen wir uns von Bildern zu ernähren.
Vielleicht wurmt es einige Leser, dass ein Mann diese Entwicklungen kritisiert. Denn immer wenn ein Mann die Bedeutung des Kochens betont, klingt das für gewisse Leute, als wolle er die Uhr zurückdrehen und die Frauen wieder in die Küche schicken. Aber das habe ich überhaupt nicht im Sinn. Ich bin zu der Auffassung gelangt, dass das Kochen zu wichtig ist, um es nur einem Geschlecht oder einem Familienmitglied zu überlassen. Männer und Kinder sollten ebenfalls in der Küche aktiv werden, und das nicht nur aus Gründen der Fairness oder Gleichberechtigung, sondern weil sie dort so viel zu gewinnen haben. Tatsächlich konnte sich die Lebensmittelindustrie vor allem deshalb in diesen Bereich unseres Lebens hineindrängen, weil das Kochen so lange als »Frauenarbeit« abgestempelt wurde, die nicht wichtig genug war, um von Männern oder Jungen erlernt zu werden.
Es ist allerdings schwer zu sagen, was am Anfang stand: Wurde das Kochen abgewertet, weil diese Arbeit hauptsächlich von Frauen verrichtet wurde, oder blieb das Kochen größtenteils an ihnen hängen, weil die Gesellschaft diese Arbeit gering schätzte? Das Thema Küchenarbeit und Geschlechterpolitik, auf das ich in Teil II näher eingehen werde, ist hoch kompliziert und war es wohl schon immer. Seit der Antike haben bestimmte Sonderformen des Kochens einen hohen Prestigewert: Homers Krieger grillten ihr Fleisch selbst, ohne dass dies ihrem Heldenstatus oder ihrer Männlichkeit Abbruch tat. Und seither genießen Männer, die in der Öffentlichkeit oder berufsmäßig – also gegen Bezahlung – kochen, gesellschaftliche Anerkennung. Allerdings erlangten Profiköche erst in unserer Zeit den Status von Künstlern. Doch während des größten Teils der Menschheitsgeschichte wurde das meiste Essen von Frauen gekocht, die diese Arbeit außerhalb der Öffentlichkeit verrichteten und dafür keine gesellschaftliche Anerkennung erhielten. Abgesehen von den wenigen Ausnahmesituationen, in denen Männer für das Essen zuständig waren – bei religiösen Opferritualen, Grillfesten am Nationalfeiertag oder in Vier-Sterne-Restaurants –, war das Kochen traditionell Frauensache, ein wesentlicher Bestandteil der Hausarbeit und der Fürsorge für die Kinder. Deshalb verdiente es keine weitere – das heißt männliche – Beachtung.
Doch gibt es möglicherweise noch einen anderen Grund, der nicht ausreichend berücksichtigt wurde. Janet A. Flammang, eine Politikwissenschaftlerin und Feministin, die eloquent die soziale und politische Bedeutung der »Arbeit mit Nahrungsmitteln« aufzeigte, vermutet in einem kürzlich erschienenen Buch mit dem Titel The Taste for Civilization, dass das Problem etwas mit den Nahrungsmitteln selbst zu tun hat, die von ihrer Natur her zur falschen Seite – zur weiblichen Seite – des Geist-Körper-Dualismus der westlichen Kultur gehören.
»Nahrung wird mit dem Tastsinn, dem Geruchssinn und dem Geschmackssinn wahrgenommen, die in der Hierarchie der Sinne einen niedrigeren Rang einnehmen als das Sehvermögen und das Gehör, die beiden Sinne, über die wir nach landläufiger Meinung Wissen erlangen«, schreibt sie. »In Philosophie, Religion und Literatur wird Nahrung meistens mit dem Körper, dem Tierischen, dem Weiblichen und dem Appetit in Verbindung gebracht – mit Dingen, die zivilisierte Männer durch Wissen und Vernunft zu überwinden suchten.«
Sehr zu ihrem Schaden.