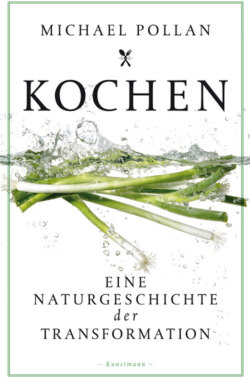Читать книгу Kochen - Michael Pollan, Michael Pollan - Страница 7
III.
ОглавлениеMit der Zeit wurde ich in der Küche immer sicherer. Ähnlich wie das Gärtnern nimmt einen das Kochen auf eine angenehme Art in Anspruch, ohne einen intellektuell allzu sehr zu fordern. Es lässt einem reichlich Raum für Tagträume und Reflexionen. Ich dachte dabei unter anderem über die Frage nach, warum ich freiwillig eine Arbeit verrichtete, die in unserer Zeit eigentlich unnötig geworden ist, eine Arbeit, für die ich weder besonders begabt noch qualifiziert bin, sodass ich vielleicht nie wirklich gut darin werde. Das ist die unausgesprochene Frage, die in der modernen Welt immer im Raum steht, wenn wir etwas kochen. Warum machen wir uns diese Mühe?
Rein rational betrachtet ist wohl selbst das tägliche Kochen zu Hause keine kluge Nutzung unserer Zeit – vom Brotbacken oder Fermentieren von Kimchi ganz zu schweigen. Diese Auffassung vertraten zumindest die Zagats – das Ehepaar, das die Zagat-Restaurantführer herausgibt – in einem Artikel über die Gastronomie, der kürzlich im Wall Street Journal erschien. Statt nach der Arbeit heimzugehen und zu kochen, sollten die Leute lieber eine Stunde länger im Büro bleiben und das tun, was sie gut können, und dann preiswerte Restaurants das tun lassen, was diese am besten können, meinten die Zagats.
Das ist, in Kurzform, das klassische Argument für die Arbeitsteilung, der wir, wie Adam Smith und unzählige andere betonten, viele Segnungen der Zivilisation verdanken. Sie ermöglicht es mir, davon zu leben, dass ich vor einem Bildschirm sitze und schreibe, während andere meine Nahrung anbauen, meine Kleidung nähen und die Energie erzeugen, die mein Haus beleuchtet und heizt. Wahrscheinlich verdiene ich mehr Geld, wenn ich eine Stunde lang schreibe oder unterrichte, als ich spare, wenn ich eine Woche lang selbst koche. Die Spezialisierung hat unbestreitbar große soziale und wirtschaftliche Vorteile. Aber sie schwächt uns auch. Sie erzeugt Hilflosigkeit, Abhängigkeit und Ignoranz und untergräbt letztendlich jedes Verantwortungsbewusstsein.
Unsere Gesellschaft weist uns sehr begrenzte Rollen zu: Wir stellen bei der Arbeit ein bestimmtes Produkt her und konsumieren in der restlichen Zeit eine ganze Menge anderer Produkte, und einmal im Jahr oder so schlüpfen wir kurz in die Rolle des Staatsbürgers und geben eine Stimme ab. Wir delegieren die Erfüllung buchstäblich all unserer Bedürfnisse und Wünsche an Spezialisten der einen oder anderen Art – für unsere Mahlzeiten sind die lebensmittelverarbeitenden Unternehmen zuständig, für unsere Gesundheit die Ärzte, für unsere Unterhaltung Hollywood und die Medien, für unsere geistige Gesundheit die Psychotherapeuten oder die Pharmakonzerne, für den Naturschutz die Umweltschützer, für politische Maßnahmen die Politiker und so weiter. Allmählich können wir uns kaum noch vorstellen, irgendetwas selbst zu tun, außer der Arbeit, mit der wir unser Leben bestreiten. Wir glauben, dass wir alles andere verlernt haben oder dass andere es besser können. Unlängst etwa hörte ich von einer Agentur, die, falls man keine Zeit findet, seine alten Eltern zu besuchen, stellvertretend eine nette Person bei ihnen vorbeischickt. Anscheinend meinen wir, dass nur Fachleute oder spezielle Einrichtungen oder bestimmte Produkte unsere täglichen Bedürfnisse befriedigen und unsere Probleme lösen können. Diese erlernte Hilflosigkeit ist natürlich von großem Vorteil für die Unternehmen, die sich darum reißen, all diese Dinge für uns zu erledigen.
In unserer komplexen Wirtschaft besteht das Problem mit der Arbeitsteilung darin, dass sie es uns erschwert, die konkreten Auswirkungen unserer täglichen Handlungen und damit unsere Verantwortung für sie zu erkennen. Die Spezialisierung lässt uns leicht vergessen, wie viel Dreck das Kohlekraftwerk produziert, das unsere Hightech-Bildschirme leuchten lässt, oder welche Knochenarbeit es ist, die Erdbeeren für unser Müsli zu pflücken, oder was für ein elendes Dasein das Schwein fristete, das starb, damit wir seinen Schinken genießen können. Die Spezialisierung verschleiert unsere Verwicklung in all das, was unbekannte andere Spezialisten irgendwo auf der Welt für uns tun.
Was ich am Kochen vielleicht am meisten schätze, ist, dass es ein wirkungsvolles Korrektiv dieser Lebensweise ist – eine Möglichkeit, etwas an ihr zu verändern, die wir alle nach wie vor haben. Wenn man eine Schweineschulter zerlegt, wird man zwangsläufig daran erinnert, dass dies die Schulter eines großen Säugetiers ist, die aus verschiedenen Muskelgruppen besteht, deren ursprünglicher Zweck nicht darin bestand, uns zu ernähren. Die Arbeit selbst weckt bei mir ein größeres Interesse an der Geschichte des Schweins: Wo kam es her? Und auf welchem Weg gelangte es in meine Küche? Sein Fleisch fühlt sich eher an wie ein Naturprodukt als wie ein Industrieprodukt, eigentlich gar nicht wie ein Produkt. Und der Anbau des Blattgemüses, das ich zu diesem Schwein serviere und das im späten Frühjahr fast so schnell nachzuwachsen scheint, wie ich es schneiden kann, erinnert mich ständig an die Fülle der Natur, an das tägliche Wunder der Verwandlung von Lichtphotonen in etwas Köstliches.
Die Beschäftigung mit diesen Pflanzen und Tieren, die Erzeugung und Zubereitung von zumindest einem Teil des eigenen Essens haben die heilsame Wirkung, dass sie die Verbindungen wieder sichtbar werden lassen, die durch Supermärkte und Fertiggerichte erfolgreich ins Undurchschaubare gerückt wurden, aber natürlich nach wir vor bestehen. Gleichzeitig übernimmt man dadurch auch wieder eine gewisse Mitverantwortung und wird zumindest ein wenig bedachter in seinen Äußerungen.
Das gilt besonders für Äußerungen über »die Umwelt«, die plötzlich nicht mehr »irgendwo da draußen« ist, sondern viel näher erscheint. Denn was ist die Umweltkrise, wenn nicht eine Krise unserer Lebensweise? Das große Problem ist nicht mehr und nicht weniger als das Gesamtergebnis unzähliger kleiner alltäglicher Entscheidungen, die größtenteils wir Verbraucher treffen – die Konsumausgaben machen fast drei Viertel der amerikanischen Wirtschaft aus –, und die übrigen fällen andere im Namen unserer Bedürfnisse und Wünsche. Wenn die Umweltkrise letztlich eine Krise des Charakters ist, wie Wendell Berry uns in den 1970ern erklärte, dann werden wir uns früher oder später auf dieser Ebene mit ihr auseinandersetzen müssen – zu Hause, in unseren Gärten und Küchen.
Sobald man diese Sichtweise einnimmt, erscheint der alltägliche Wirkungskreis Küche in einem ganz neuen Licht. Sie wird wichtiger, als wir uns je vorstellen konnten. Der unausgesprochene Grund, warum politische Reformer von Wladimir Iljitsch Lenin bis Betty Friedan die Frauen aus der Küche holen wollten, war, dass dort nichts von Bedeutung stattfand – nichts, was ihren Talenten, ihrer Intelligenz und ihren Überzeugungen entsprach. Die einzig angemessenen und anerkannten Arenen, um etwas zu bewirken, waren der Arbeitsplatz und der öffentliche Raum. Aber das war, bevor die Umweltkrise sich abzeichnete und die gravierenden Auswirkungen der Industrialisierung unseres Essens auf unsere Gesundheit erkennbar wurden. Öffentliches Engagement wird immer nötig sein, um die Welt zu verändern, doch in unserer Zeit genügt das nicht mehr. Wir müssen auch unsere Lebensweise ändern, denn die Orte unseres täglichen Umgangs mit der Natur – unsere Küchen, Gärten, Häuser, Autos – sind heute für das Schicksal der Welt von größerer Bedeutung als je zuvor.
Kochen oder nicht kochen wird also zu einer wichtigen Frage. Ich weiß, das ist etwas überspitzt formuliert. Kochen hat für unterschiedliche Leute zu unterschiedlichen Zeiten unterschiedliche Bedeutungen. Es ist selten eine Alles-oder-Nichts-Option. Doch selbst wenn man an mehr Abenden kocht als bisher, am Sonntag ein paar Mahlzeiten für die Woche zubereitet oder vielleicht ab und zu versucht, etwas selbst zu machen, was man bisher immer fertig kaufte, sind diese kleinen Veränderungen eine Art Votum. Ein Votum wofür genau? Nun, in einer Welt, in der nur noch wenige von uns gezwungen sind, überhaupt zu kochen, ist die Entscheidung, es trotzdem zu tun, ein Protest gegen die Spezialisierung – gegen die totale Rationalisierung des Lebens. Gegen das Vordringen kommerzieller Interessen in die allerletzten Winkel unseres Lebens. Wenn wir aus Vergnügen kochen, in unserer Freizeit, erklären wir uns unabhängig von den Unternehmen, die aus jeder Minute unseres Tages eine weitere Gelegenheit zum Konsum ihrer Produkte machen wollen. Und wenn ich es mir recht überlege, auch aus jeder Nacht: Schlaftablette gefällig? Es bedeutet, die lähmende Vorstellung zurückzuweisen, wonach die Herstellung von etwas, zumindest in unserer Freizeit, eine Arbeit ist, die am besten von jemand anderem erledigt wird, und dass die einzig legitime Form von Freizeit und Muße Konsum ist. Diese Abhängigkeit nennen Marketingfachleute »Freiheit«.
Das Kochen verwandelt nicht nur Pflanzen und Tiere. Es verwandelt auch uns – von bloßen Konsumenten in Produzenten. Nicht restlos und nicht ständig, doch schon eine kleine Verschiebung des Verhältnisses zwischen diesen beiden Identitäten beschert uns zutiefst befriedigende und überraschende Erfolgserlebnisse. Deshalb lädt dieses Buch alle Leserinnen und Leser dazu ein, das Verhältnis zwischen Produktion und Konsum in ihrem Leben zu verändern, sei es auch nur ein kleines bisschen. Jeder kann lernen, einen Teil dessen, was er zum Leben braucht, selbst herzustellen. Die regelmäßige Anwendung dieser einfachen Fertigkeiten steigert unser Selbstvertrauen und vergrößert unsere Freiheit, zugleich verringert sie unsere Abhängigkeit von kühl agierenden Konzernen. Wenn wir keines unserer täglichen Bedürfnisse selbst erfüllen können, fließt ihnen nicht nur unser Geld zu, sondern auch unsere Macht. Doch sobald wir beschließen, mehr Verantwortung für unsere Ernährung zu übernehmen, erlangen wir diese verlorene Macht wieder, und das Geld fließt an uns und an die Allgemeinheit zurück. Das war eine frühe Erkenntnis aus der wachsenden Bewegung für den Wiederaufbau einer lokalen Lebensmittelwirtschaft, deren Erfolg letztlich von unserer Bereitschaft abhängt, uns mehr Gedanken über unsere Ernährung zu machen und mehr selbst zu kochen. Nicht jeden Tag, nicht jede Mahlzeit – aber öfter als bisher, so oft wie möglich.
Das Kochen gibt uns die im modernen Leben so seltene Gelegenheit, ganz unmittelbar für uns selbst und für unsere Familie tätig zu werden. Wenn das nicht sein »Leben bestreiten« ist, dann weiß ich nicht, was das überhaupt heißen soll.
Wirtschaftlich gesehen ist das für einen Amateurkoch vielleicht nicht immer die effizienteste Nutzung seiner Zeit, auf emotionaler Ebene fällt die Bilanz dafür großartig aus. Denn ist etwas weniger egoistisch, weniger entfremdete Arbeit und weniger Zeitverschwendung, als für Menschen, die man liebt, etwas Köstliches und Nahrhaftes zu kochen?
Beginnen wir also.
Am Anfang, mit dem Feuer.