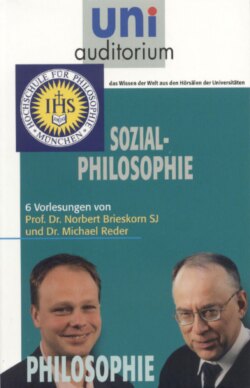Читать книгу Sozialphilosophie - Michael Reder - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Erkennen der Gesellschaft. Anmerkungen zum sozialen Konstruktivismus
ОглавлениеDamit wenden wir uns nun Theorien zu, die vom Erkennen der Gesellschaft sprechen, und zwar im Besondern jener Theorie von der sozialen Konstruktion der Wirklichkeit. Um dies einzuleiten, können wir in einem ersten Punkt sagen: Unabdingbar ist menschliches Erkennen perspektivisch. Wir haben immer eine bestimmte Raum- und Zeitstelle eingenommen. Wir haben nicht den Standpunkt eines alles wissenden Wissenschaftlers, der alles beobachten kann
Immer stehen wir zu einer bestimmten Zeit an einem bestimmten Ort und beurteilen nur Ausschnitte. Der Ethnologe weiß dies. Er sieht an sich selbst, wie er aus seiner Kultur heraus andere Gesellschaften nur unter einer ganz bestimmten Perspektive in den Blick bekommen kann. Wir sagen dazu Perspektivität.
Gesellschaften wählen aus vielen Möglichkeiten aus, etwa wie man Siedlungen anlegt oder Häuser baut, wie man eine bestimmte religiöse Bauart vorzieht oder Hauptstraßen einer Stadt auf heilige Berge hin ausrichtet. Dabei weiß man genau, dass es auch andere Möglichkeiten gegeben hätte. Platon spricht immer wieder an, dass das Wissen und die Weltsicht eines Bürgers auch von seinem gesellschaftlichen Standort und seiner politischen Rolle abhängen. Der Angehörige des Handwerker- und Bauernstandes hat eine andere Bezugsweise zum Arbeiten oder zu den Tugenden als der Herrscher. Thomas von Aquin hat dies auf den Punkt gebracht: „Was auch immer erkannt wird, wird nach Art des Erkennenden erkannt.“Diese Perspektivität wird uns bleiben und bedeutet doch auch überhaupt nichts. Zum Beispiel bedeutet sie nicht, dass wir Relativisten sind. Relativismus heißt, dass wir ein und dieselbe Sache unter entgegengesetzten Kriterien oder Bewertungen ansehen. Nur so viel zum Relativismus. Wir kennen vielleicht schon einige Argumente. Wer behauptet, alle Erkenntnisse sei relativ, nimmt eben dies in seinen Satz von der Relativität aus. Wir würden heute fast technisch sagen: Es ist ein Selbstwiderspruch im Sprechen, ein performativer Selbstwiderspruch. Das ist hinlänglich bekannt.
Interessant finde ich, wie Theodor W. Adorno diesen Einwand des Relativismus aufgegriffen hat. Er sagt, dieser Einwand sei armselig, denn er „verwechselt die allgemeine Verneinung eines Prinzips mit ihrer eigenen Erhebung zur Bejahung ohne Rücksicht auf die spezifische Differenz des Stellenwerts von beidem.“
Adorno will damit sagen, dass man zwar etwas kritisieren kann, aber man trotzdem in diesem Satz auch etwas bejahen und ausdrücken will. Adorno hat besonders interessiert, dass sich darin ein haltlos gewordenes, sich suchendes, zerrissenes Bürgertum ausdrückt. Er fragt, ob der Relativismus nicht auch an eine bestimmte geistige Haltung und soziale Position gebunden ist.
Relativismus ist für Adorno damit eine beschränkte Gestalt des Bewusstseins, welches dem bürgerlichen Individualismus eigen ist. Man könnte noch weiter gehen und mit Franz Marc sagen: Der Relativismus ist ein Versuch, sich jeder Infragestellung zu entziehen und die Erkenntnisebene für die Seinsebene zu halten. Relativismus wäre dann ein Ausweichen vor dem Bekenntnis.
Aber neben dieser allgemeinen Perspektivität und Relativität gibt es heute eine Wissenschaft, welche diese Frage intensiv behandelt. Dies ist die social epistemology, die soziale Erkenntnislehre. Sie untersucht einerseits wie soziale Beziehungen, Institutionen und Interessen auf Gesellschaft einwirken. Andererseits fragt sie, wie Gesellschaft und sozioökonomische Umstände auf das Wissen und die Reflexion Einfluss haben.
Warum sind wir beispielsweise in vielen Ausdrucksweisen patriarchalisch? Warum geht man heute bereits einen weiteren Schritt und spricht von der Erfindung der Frau? Damit ist natürlich nicht eine biologische Neuschöpfung gemeint, sondern eine Erfindung der Frau in den großen Diskursen und Texten der patriarchalischen Gesellschaft oder mittlerweile auch der kritisch dazu stehenden Gesellschaft.
Was uns interessiert ist der implizierte Konstruktivismus. Ich darf diesen in einigen Punkten mit seinen Thesen vorstellen und dazu Stellung nehmen.
Eine erste These sagt: Wir nehmen gar nicht Inhalte wahr, sondern nur Intensitäten. Es führt kein Weg zum Ding an sich. Die Frage ist allerdings: Setzt aber nicht doch erst unser Kenntnisvermögen mehr oder weniger intensive Einwirkungen zu Farben und Tönen um? Wird dann dieses Sinnesmaterial nicht so bearbeitet, dass es zu einer Überprüfung kommen kann, ob das Ergebnis mit der Sache übereinstimmt? Nehmen wir also Inhalte wahr oder nur Intensitäten? Ist zweiteres nicht durch unser alltägliches Erkennen widerlegt?
Sicherlich mögen wir oft zuviel von dem Erkennen erwartet haben. Und deswegen nur ein Hinweis auf einen Philosophen, der hier an dieser Hochschule gelehrt hat, und zwar Josef de Vries: „Die Wahrheit, also die Satzwahrheit, die in Sätze eingegangene Wahrheit fordert nicht, dass das Denken das Seiende mit all seinen Bestimmungen wiedergibt und in diesem Sinne angemessene Erkenntnis ist. Es genügt eine unangemessene Erkenntnis, wenn nur die Merkmale, die gedacht oder ausgesagt werden, sich wirklich im Seienden finden.“
Mit anderen Worten: Die Wahrheit fordert nur eine Angleichung an das jeweils erfassbare Objekt. Deshalb kann man fragen: Wie kommt es, wenn man nur Intensitäten wahrnimmt, zu einem solchen Satz? Oder wie kommt es überhaupt zu einer Theorie? Und können wir über eine Theorie sagen, dass sie wahr ist? Denn auch die Theorie, die besagt, dass wir keine Inhalte, sondern nur Intensitäten wahrnehmen und kein Weg zum Ding an sich führt, beansprucht ja, ein wahrer Satz zu sein. Muss es nicht doch also ein anderes Erkennen geben?
Ein zweiter Aspekt zum Konstruktivismus, der noch zentraler ist. Erkennen sei Beobachtung, welche das System durchführe. Und erst mit den vom System selbst zubereiteten Inputs operiere das System. Es habe somit nie direkten, sondern nur indirekten Kontakt mit der Außenwelt. Und es gehe mit den Inputs so um, dass man sagen könne: Das System erfinde sich seine externen Daten. Damit würde Erkenntnis nichts anderes heißen als Selbstbeschäftigung des Systems mit sich selbst. Wie kann aber dann wissenschaftlicher Austausch stattfinden? Ist nicht jedes System schon aufgebrochen und auf andere bezogen? Wie kann man andere überhaupt verstehen? Natürlich gibt es in modernen Gesellschaften keine letzte Instanz, die sagt: Dies ist wahr. Und sicherlich gibt es gesellschaftliche Beeinflussungen. Wir haben dies in der Auseinandersetzung mit der Perspektivität und dem Wohlwollen gesehen, das ja auch gesellschaftlich mit bestimmt ist. Aber keine Gesellschaft kann nur aus sich heraus diese zahlreichen, sich widersprechenden Erkenntnisse aufnehmen, ohne sie nicht auch zu prüfen. Ein konstruktivistisches Vorgehen muss auf bereits erworbene Erkenntnisse und den Zusammenhang zwischen diesen Rücksicht nehmen. Wie wird Stabilität hergestellt? Welchen Hypothesen wird der Anschluss verweigert? Welche passen nicht zu wohl erprobtem und bewährtem Wissen? Es ist also ein Außenkontakt in einer noch so einfachen Form unabdingbar, wenn das erkennende System mit anderen kommunizieren will. Drittens können wir sagen, dass Forschungen von Gegenständen der Welt handeln. Der soziale Konstruktivismus argumentiert, dass Forschungsergebnisse nur Repräsentationen der Forschergruppe sind. Es ist egal wie man zu den Gegenständen kam, denn das Wissen über sie ist sozial konstituiert. Was Forscher mitteilen, gebe nicht den Blick auf die Wirklichkeit frei, sondern auf die soziale Wirklichkeit der Forscher. Was heißt Objektivität dann? Sie ist nur die Objektivität der Forschergemeinschaft.
Es ist sicherlich richtig, dass Faktum und Glaube nicht scharf zu trennen sind und wir in den wenigsten Fällen die Fakten eigens nachprüfen können. Die meisten wahren Sätze unseres Lebens beruhen auf der geglaubten Autorität der Forscher. Es gibt auch kein ahistorisches Wissen. Aber diese Konstruktionstheorie wird zweierlei zu erklären haben: Wie ist das Verhältnis der Rekonstruktionen zu dem vorgegebenen Verhalten, auf das sie ständig zurückgreifen, d.h. wie ist das Verhältnis zu Menschen, klimatischen bzw. geografischen Strukturen und damit den Konstruktionsvorgaben selbst? Gibt es nicht ein Veto der Wirklichkeit?
Es bleibt unklar, wie in einem streng konstruktivistischen Ansatz das intersubjektive Verstehen zu erklären ist. Wie können Menschen sich verständigen? In dieser Hinsicht sind die Auskünfte des Konstruktivismus außerordentlich mager.
Wenn man den Konstruktivismus ernst nimmt, dann verfährt man antirealistisch gegenüber der Welt, aber gleichzeitig realistisch gegenüber der Wissenschaft, der Forschergruppe und ihren Traditionen. Wo diese Konstruktion als Freiheit gedeutet wird, wie das Heinz von Foerster macht, wenn er sagt: „Ich kann in jedem Augenblick entscheiden, wer ich bin“, so kann ich darin nicht mehr als eine rhetorische, wenn auch brillante Übertreibung entdecken. Denn nicht einmal die Sprache vermag der Konstruktivist jederzeit zu wechseln. Es gibt ein Anfangswissen, aufgrund dessen er überhaupt Erfahrungen machen kann. Auch das übersieht eine solche Theorie.
Eine weitere Theorie besagt, man verneint nicht die Existenz der Außenwelt, doch lässt sich in ihr gar nicht antreffen, womit das Erkennen beständig arbeitet. Als Beispiele hierfür werden negative Stellungnahmen, Unterscheidungen oder Beurteilungen von möglich und notwendig angeführt. Das ist richtig. Aber Unterscheidungen, die wir machen müssen, sind keine Konstruktion. Es sind Beigaben des Geistes, damit er Klarheit gewinnt. Deswegen muss er unterscheiden, verneinen und nach möglich und unmöglich aussortieren. Doch damit baut er keine Wirklichkeit, sondern arbeitet sie klarer heraus. Differenzierung ist noch nicht Konstruktion in der hier behandelten Bedeutung.
Eine letzte These sagt: Es gelte das Realisationsprinzip. Leben sei Erprobung auf Lebbarkeit hin. Vorstellungen, die ich habe, sind nur wahr, wenn sie mir lebensdienlich sind. Wenn diese Begriffe und Vorstellungen sich dann auch in den Modellen von anderen als lebbar erweisen, dann gewinnen sie eine Gültigkeit, so Heinz von Foerster oder Francisco J. Varela. Diese Gültigkeit könnten wir dann mit gutem Recht objektiv nennen.
Kurz: Wahr ist, was funktioniert. Wahr ist, was unsere Gesprächspartner zusammen mit uns als zutreffend und funktionierend bezeichnen. Damit ist der Wahrheitsbegriff ausschließlich in einem technisch-naturwissenschaftlichen oder pragmatischen Kontext angesiedelt. Man könnte nicht einmal von so einem Wahrheitsbegriff aus über eine solche befinden. Wer nur den Nutzen entscheiden lässt, der verwechselt das mögliche Ergebnis, kann sich darauf einschränken mit dem Ausgangspunkt – dass man nämlich gar keine anderen Alternativen habe für einen Wahrheitsbegriff. Offen bleibt wiederum, wie man sich mit anderen verständigen kann. Offen bleibt auch, gerade wenn man nach Nutzen fragt, wie man die in das Gespräch kommenden Interessen eigentlich bewertet. Und wenn es um Interessen geht, sind wir fast notgedrungen immer bei der Unterscheidung von wahren und falschen Interessen. Wie will man mit einem solchen Wahrheitsbegriff darüber befinden?
Das einmal zum Abschluss dieser knappen Auseinandersetzung mit dem Konstruktivismus, der einige wichtige Aspekte betont und einige wichtige Seiten unseres Erkennens in Gesellschaft beleuchtet, der aber eben ausgesprochen einseitig das Finden von Wahrheit und den Wahrheitsbegriff ausdeutet.
Zum Schluss wird man sagen müssen, dass selbst der Konstruktivismus als ein Produkt der Gesellschaft zu bezeichnen ist. Er entsteht nicht überall, sondern gehört einer bestimmten Zeitgeschichte an. Das entwertet ihn nicht völlig. Dies sollte ihm aber selbst bewusst sein, um seine eigenen Grenzen zu erkennen.
Erkenntnistheorien sind geschichtlich bedingt wie auch das Erkennen selbst geschichtlich eingeschränkt ist. Aber in dieser Beschränktheit lässt sich das Wahre erkennen.