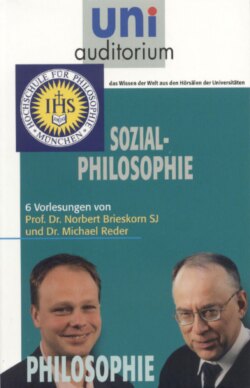Читать книгу Sozialphilosophie - Michael Reder - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Zugänge zur Gesellschaft
ОглавлениеGehen wir zu dem Kapitel über, das uns mit Zugängen zur Gesellschaft beschäftigt. Der Satz, dass Gesellschaft ist und dass es sie gibt, ist als wahr auszuweisen und zu begründen. Ein solcher Ausweis gelingt in sinnvoller und nicht mehr bestreitbarer Weise dann, wenn Gesellschaft Bedingung dieses Bestreitens ist. Gesellschaft ist eine solche Vorbedingung, weil jegliches Behaupten – und auch dies ist eine Form des Behauptens – eine Verständigungs- und damit Sprachgemeinschaft voraussetzt. Auch der, welcher die Existenz von Gesellschaft in Frage stellt, ist und bleibt von ihr mitbestimmt.
Die Frage, die sich dann weiter stellt, lautet: Wie ist Gesellschaft zu erkennen? Dabei gilt: Wer immer einen Gegenstand erkennen will, hat sich ihm zu öffnen. Dieses Thema wird uns jetzt in einem ersten Block beschäftigen. Sich dem Gegenstand zu vergegenwärtigen, dieses das ist Inhalt des zweiten Abschnittes. Und schließlich werden wir uns darüber aussprechen, wie über Gesellschaft angemessen zu sprechen ist.
Zuerst also unsere Frage nach der Einstellung des Erkennenden gegenüber der Gesellschaft. Kurz am Beginn zusammengefasst: Jegliches Verstehen von etwas oder von jemandem, somit auch der Gesellschaft, verlangt eine wohlwollende Einstellung ihm gegenüber. Das war die Ansicht von Aurelius Augustinus, Blaise Pascal, Johann Wolfgang von Goethe und vielen anderen. Sie alle hielten das Wohlwollen gegenüber dem zu erkennenden Gegenstand für eine unabdingbare Voraussetzung des Erkennens.
So schreibt Augustinus in einer Schrift, die gegen einen bestimmten „Faustus“ gerichtet ist, dass nur der, der liebt, zur Wahrheit gelangt. Und Pascal nahm um 1658 diesen Grundgedanken des Augustinus-Textes in einer kurzen Abhandlung über das Überzeugen auf: „Sobald man eine Sache liebt und sie trotz alledem noch wenig kennt, geleitet uns die Liebe von dort weg, hin zu einer besseren und vollständigeren Erkenntnis.“
Diesen Text nahm übrigens Heidegger in „Sein und Zeit“ ganz getreu auf. Und Goethe offenbarte seinem Freund Friedrich Jacobi: „Man lernt nichts kennen als das, was man liebt. Und je tiefer und vollständiger die Kenntnis werden soll, desto stärker und lebendiger muss Liebe ja Leidenschaft sein.“
Man kann ebenfalls auf Friedrich Nietzsche verweisen, der diese Frage in der Schrift „Die fröhliche Wissenschaft“ in zwei Aphorismen (§ 110 des Dritten Buches und § 333 des Vierten Buches) aufgreift. Er spricht davon, dass das Erkennen eines Gegenstandes (noch dazu eines Gegenstandes, der uns vereinnahmen oder nivellieren will, wie das bei der Gesellschaft der Fall ist) erst zu gelingen vermag, wenn Widerstände, Ablehnung und beharrliche Irrtümer unsererseits überwunden sind. Doch dieser Kampf schließt das wohlwollende Grundinteresse nicht aus, sondern eher ein. Es wäre unmöglich, einen solchen Kampf ohne Wohlwollen durchzustehen.
Meiner Ansicht nach gibt es ein rechtes Verhältnis von Nähe und Ferne zu einem jeden Gegenstand. Auch gegenüber der Gesellschaft gibt es ein solches richtiges Verhältnis von Nähe und Ferne. So kann man sagen, dass es ein solches Verhältnis bereits gegenüber dem Erkenntnisvermögen geben muss. Dazu hat sich Platon in der „Politeia“ auf wunderbare Weise geäußert: Die dialektische Methode, also jenes im Dialog vorangehende Suchen nach der Wahrheit, zieht Auge der Seele gelinde hervor und führt es aufwärts“.
Gegenüber dem Gegenstand, der uns gegeben ist, ist deshalb eine Distanz einzunehmen, die ein zu nah wie ein zu fern vermeidet.
Zwei kleine Beispiele dazu: Es gibt einen Spruch der kynischen Schule, der dem Diogenes von Sinope zugeschrieben wird, der gesagt haben soll: „Wenn du dich wärmen willst, geh nicht zu nah an das Feuer, so dass deine Kleider in Flammen aufgehen würden und du dich verbrennst. Bleibe aber auch nicht so fern, dass das Feuer dich nicht erwärmt.“
Wir selbst kennen dies, wenn wir uns mit dem Auto auf der Straße bewegen. Dann können wir nämlich eine Reklametafel, die am Straßenrand aufgebaut ist, immer nur aus einer bestimmten Distanz lesen. Ist sie zu weit entfernt, dann sehen wir nur einen dunklen Punkt rechts von der Fahrbahn. Ist sie zu nah, dann sehen wir nur die Rasterpunkte des Großfotos, jedoch nicht die gesamte Montage. Und so haben wir uns grundsätzlich gegenüber der Gesellschaft zu verhalten. Es gibt ein zu nah und es gibt ein zu fern von ihr. Wir könnten zwischendurch fragen, ob es immer auch mit Anerkennung zu tun hat, wie wir uns gegenüber dieser Gesellschaft verhalten. Anerkennung ihrer Institutionen und Anerkennung der Menschen. Aber wie ist das Verhältnis von Erkennen und Anerkennen? Ist, so können wir fragen, das Erkennen früher als das Anerkennen oder müssen wir zuerst etwas anerkannt haben, um es zu erkennen?
Die Erfahrung zeigt: Wir müssen zuerst wissen, was überhaupt Anerkennung ist und wen ich anerkennen soll, um dann meine Anerkennung aussprechen zu können. Wer alles und jedes unterschiedslos anerkennen würde, würde eventuell auch das anerkennen, was zu anderem, das er bereits anerkannt hat, in Widerspruch stünde und dem Anerkennenden schaden würde. So würden wir uns in einen manchmal vielleicht lähmenden Widerspruch versetzen, wenn wir nicht zuerst das Erkennen üben würden.
Eine gleichsam blind vorgenommene Anerkennung könnte man auch als Zeichen der Gleichgültigkeit auslegen. Bevor ich also anerkenne, muss ich erkennen wollen. Das erscheint mir einsichtiger, weil sachlogisch das Erkennen dem Anerkennen vorausgeht. Allerdings wird das erste Erkennen von Ehrfurcht begleitet sein müssen – begleitet sein müssen, wohlgemerkt. Und das beinhaltet Anerkennung.
Eine solche Ehrfurcht lässt sich aber ihrerseits nur als Folge einer Erfahrung von Wirklichkeit verstehen, die sich schon vor dem Beherrschen der Sprache und vor der Reflexion eingestellt haben muss.
Es gibt also hier ein auf keinen Anfang rückführbares zirkuläres Verhältnis. Wer jemanden anerkennt, anerkennt ihn als jemanden. So blickt er auf zweierlei: auf den, den er anerkennen will, und auf einen Maßstab, einen anderen Menschen, eine Institution oder eine Norm. Diese Distanz, die mit dem „als“ eingenommen ist, wird uns bleiben.
Gehen wir nach diesen einführenden und theoretischen Ausführungen nun über zu dem Verhältnis von Mensch und Gesellschaft.
Etwas zu kennen gelingt nur, wenn man die Vergegenwärtigung des Gegenstandes im Gedächtnis festhält. Ihn festzuhalten verlangt jedoch, ihn zu versinnlichen. Es ist aber sehr schwierig, Gesellschaft anschaulich zu machen. Denn sinnlich einprägsame Gegenstände, die wir mit Gesellschaft verbinden – ein Kongressgebäude, eine Flagge, eine Kanzlerin – stehen allenfalls für ein Ganzes, sind es aber nicht. Und so liegt es nahe, zuerst den Blick auf uns selbst zu richten. Erstens machen uns Sprache, Kleidung, Wohnung oder Arbeitsplatz zu Mitgliedern der Gesellschaft. Sie ist schon allein deswegen kein fernes Objekt, das unabhängig von dem Erkennenden existieren würde. Denn die von Menschen installierten Lebensformen sind bis in die kleinsten Verästelungen vom gesellschaftlichen Leben durchtränkt. Dies gilt gleichermaßen für unsere Sprache, Kleidung, Wohnungen oder den Arbeitsplatz. Dies ist unabhängig davon, ob wir von nationalen Gesellschaften ausgehen oder wir erkennen, dass diese gar nicht abschottbar sind und auf eine Weltgesellschaft hinweisen, deren Teile die Institutionen und einzelnen Menschen sind.
In der Rede vom Menschen als einem gesellschaftlichen Wesen schwingt das in Besitz genommen sein durch Gesellschaft mit. Auf Griechisch hat Aristoteles dies als „zoon
politicon“ ausgedrückt und Thomas von Aquin spricht vom „animal sociale“ und meint damit das gesellschaftliche Lebewesen. Gesellschaft gehört natürlich zu unserem Leben. Von August Comte berichtet man Folgendes: Er hat seinen Schreibtisch vor einen Spiegel gestellt. Während er über Gesellschaft schrieb, war er sich dabei selbst immer vor Augen. Als Teil der Gesellschaft dachte er über sie und damit über sich selbst nach. Wie eine Klette hängt die Gesellschaft an ihrem Beobachter und infiziert alle zu erkennenden Gegenstände mit sich – egal ob man sich in unberührter Natur glaubt, als isoliertes Individuum einkapselt oder ins scheinbar unberührte private Glück einnistet: Die Gesellschaft ist immer dabei.
Das zeigt uns noch deutlicher: Wenn wir auf unser Denken, unsere Einstellungen und unser Reflektieren schauen, kann dies nie ohne Sprache geschehen. Sprache ist ein gesellschaftliches Instrument. So kann immer nur eines ihrer Mitglieder oder ein Mitglied einer anderen Gesellschaft über Gesellschaft nachdenken. Auch die persönlichen Einfärbungen der Sprache und Sprechakte sind nie bloßer Eigenbau, sondern wachsen auf von der Gesellschaft geliehenem Boden.
Der heimlich erzählte Witz über den Tyrannen soll allen – auch ihm – verständlich sein. Dass viele Menschen am Bau der Gesellschaft mitarbeiten und jeder ihr seine persönliche Färbung verleiht, entfremdet letztlich nicht voneinander, sondern stößt uns auf unsere eigene Wirklichkeit, eine gemeinsame Wirklichkeit mit je eigener Ausprägung. Jeder gewinnt so neue Zugänge zu den anderen, erkennt sie selbst im schärferen Profil, aber eben als Gesellschaftsmitglied. Dies hat ein Soziologe folgendermaßen ausgedrückt: „Über Gesellschaft lässt sich nur aktiv und mit und durch Gesellschaft hindurch, das heißt in gesellschaftlichem Handeln ermitteln.“
Drittens wird somit in jedem Erkennen von Gesellschaft etwas über den Menschen und in jedem Erkennen des Menschen auch etwas über die Gesellschaft mit ausgesagt. So vermehrt sich mit jedem einzelnen Wissen das Wissenspotential der Gesellschaft insgesamt. Ebenso geht mit dem Vergessen und Verstummen einzelner Menschen Wissen über Gesellschaft verloren. Wissen über Gesellschaft ist immer zugleich Wissen der Gesellschaft als Subjekt. Aber dies haben wir noch weiter zu klären und in Frage zu stellen. Das ist Aufgabe des nächsten Abschnittes. Es geht dabei vor allem darum, dass der Mensch zwar von Gesellschaft, aber nicht nur von dieser geprägt ist.
Lassen Sie mich zur Eröffnung wiederum auf ein literarisches Beispiel eingehen. Dieses Beispiel soll verdeutlichen, dass sich gerade das Gerechtigkeitsvermögen – das dem Menschen eigene Vermögen über gerecht und ungerecht zu befinden –nicht der konkreten Gesellschaft, sondern einer Naturbegabung des Menschen verdankt. Natürlich aber formt Gesellschaft dieses aus, setzt diesem Vermögen Akzente auf oder blendet Bereiche aus.
Das zeigt sich fast überdeutlich in Heinrich Bölls Geschichte „Die Waage der Baleks“ von 1953. Eine für mich in ihrer Einfachheit ungeheuer beeindruckende Geschichte. Es befindet sich eine Waage in einem von dem Großgrundbesitzer bewusst abgekapselten Dorf. Mit dieser Waage der Baleks, so wie die Geschichte heißt, müssen alle Dorfbewohner ihre Waren wiegen lassen und erhalten von dem einzigen Kapitalisten, also den Baleks, dafür ihr Geld. Da es die einzige Waage ist, ist keinerlei vergleichende Überprüfung möglich. Wir erfahren, dass die Dorfbewohner ihre Produkte mit viel zu niedrigem Gewinn verkaufen müssen, wohingegen die Familie Balek den Dorfbewohnern zu überhöhten Preisen ihre Waren überlässt. Erst als ein Kind der Dorfbewohner seine Produkte zufällig auf einer Waage außerhalb des Herrschaftsbereiches dieser Familie wiegen lässt, kommt die lang unterdrückte Wahrheit ans Licht. Die Waage allerdings wird nicht korrigiert.
Diese kleine Gesellschaft eines Dorfes, repräsentiert durch den Reichen, verfälschte überlebenswichtige Prozesse und bot von sich aus keine von ihr unabhängige Kontrolle ihrer Bewertungen an. Trotzdem konnte Gerechtigkeit letztlich nicht manipuliert werden. Es war – und das ist im Bewusstsein aller, sogar vielleicht dieser Familie – über Jahrzehnte lang ein ungerechter Vorgang, indem mit dieser Waage die mühsam produzierten Güter des Dorfes gewogen wurden. Es kann also beides auseinanderklaffen: Leben im gesellschaftlichen Netz und Leben in Gerechtigkeit. Keineswegs ist Leben in Gesellschaft immer ein Leben in Gerechtigkeit. Gerechtigkeit, die nicht nur Armut verurteilt, sondern auch jegliche Manipulation am Menschen. Erst wer sich als in Gesellschaft hinein verflochten begreift, versteht wie nötig Distanznahme ist. Es ist nötig, Abstand zu gewinnen und die Maßstäbe der Gesellschaft zu überprüfen. Deswegen ist die These von einer totalen Eingebundenheit des Menschen in Gesellschaft falsch.
Wir können anthropologisch sagen, dass in keiner Handlung der Handelnde völlig aufgeht. In keiner Handlung ist er völlig gegenwärtig, mag er sich noch so mit seiner Handlung identifizieren. Allein dass er sagen kann: es ist meine Handlung, ist ein Indiz dafür, dass er außerhalb von ihr steht und sie betrachten kann. Das gilt nicht nur bei Äußerungen, die den Zweck haben, sich zu verbergen und unkenntlich zu machen, sondern bei jeder noch so einfachen Handlung.
Im „Hamlet“ heißt es im dritten Auftritt: „Unsere Gedanken sind die unsrigen, mit den Wirkungen haben wir nichts mehr zu tun.“
Dies bedeutet, dass wir unser Handeln gar nicht völlig im Griff haben können und trotzdem sagen müssen: Es sind Wirkungen von uns. Auch hier gibt es eine Übersteigerung über das von uns geplante und geregelte Handeln hinaus. Anders gesagt: Wir stehen für unser Denken und die Wirkung der Worte ein, sind aber nicht in jedem Fall verantwortlich. Aber es ist unser Leben, das auch das Leben in Verantwortung überragt.