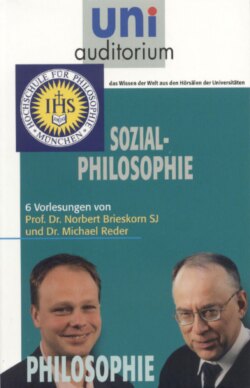Читать книгу Sozialphilosophie - Michael Reder - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Verhältnis von Mensch und Gesellschaft
ОглавлениеDer Mensch ist immer auch mehr als sämtliche seiner Mitgliedschaften in einer Gesellschaft. Dies lässt sich an einer Überlegung und den Gedanken dreier Autoren systematisch herausarbeiten.
Zuerst an einer Überlegung: Die Beschreibung einer totalen Eingebundenheit widerlegt sich selbst. Unsere Reflexion hätte gar nicht die Möglichkeit, Gesellschaft zum Beispiel als ein Gefängnis zu skizzieren, wenn unsere geistige Kraft es nicht vermocht hätte, sich außerhalb oder überhalb der Grenzen der Gesellschaft zu stellen. Jedes Sprechen über Gesellschaft kann nur geschehen, wenn wir Distanz genommen haben. Wenn wir auf den reflektierenden Geist des Menschen sehen, so erfährt sich der Geist gebunden und ungebunden zugleich. Er ist einerseits an den Körper gebunden (wir können auch sagen: an den gesellschaftlichen Körper), welcher einen Standort in der Gesellschaft und ihrer Geschichte hat. Und andererseits kann dieser Geist alles und jedes einschließlich seiner selbst zum Gegenstand seiner Reflexion machen.
Auch hier ein Beispiel von Shakespeare: Es begegnen sich auf der Weide im „King Lear“ Edgar und Lear. Sie erkennen sich nicht und Lear jammert, wie schlimm es um ihn steht. Edgar sagt ihm: Solange wir sagen können, es steht schlimm um uns, steht es gar nicht so schlimm, denn unser Geist zeigt darin Distanz. Dass er unsere schlimme Situation überragt, zeigt uns eben auch eine Überlegenheit
Natürlich können wir den Körper zerstören, zum Beispiel durch Folter. Wir können auf ihn einwirken. Aber letztlich bringen wir durch den gewaltsamen Tod allenfalls den Träger unseres Geistes zu einem Ende, nicht aber den Geist selbst. Das ist nicht so gemeint, als ob es sich hierbei um eine faktische Unmöglichkeit handeln würde, unsere Freiheit oder Reflexion zu bändigen oder wie Hans Kelsen sagt, dass keine Gesellschaft letztlich so ausstaffiert sein kann, dass sie alles und jedes beherrscht. Nein, es geht nicht um eine faktische Unmöglichkeit, sondern um eine prinzipielle. Es ist der Geist als ein Vermögen, das sich allem und jedem entwinden kann und eben auch sich selbst. Wir sind ein grundsätzlich unbeherrschbarer Ort inmitten der Gesellschaft. In uns gibt es, wie das Friedrich Schelling großartig gesagt hat, zwar eine Reflexion auf alles, aber eben auch einen nicht aufhellbaren Rest. Ein Rest, der – wie Schelling sagt – sich nicht entdämonisieren lässt. Es bleibt etwas, das sich nicht aufhellen lässt und damit etwas, das von Gesellschaft nicht korrumpiert und ergriffen werden kann. Platon meint dies in seinem Dialog „Menon“, wenn er sagt: Wir haben uns zu erinnern. Mit diesem „uns“ meint er genau etwas, was nicht von dieser Gesellschaft bereits beherrscht ist. Für Thomas von Aquin ist der Mensch in einer für uns heute vielleicht schwer eingänglichen Weise ein Gesellschaftswesen. Thomas betont sehr deutlich, wie sich der Mensch dem Gemeinwesen ein- und unterzuordnen hat. Das Gemeinwesen darf sogar von ihm verlangen, dass er sich während eines Krieges dem leiblichen Tod aussetzt. Aber gleichzeitig hebt Thomas von Aquin hervor, dass Gott mehr zu gehorchen ist als den Menschen. In dieser anderen Dimension ist der Mensch nicht bloß einer, auf den die Gesellschaft Druck ausübt und Anforderungen stellt.
Der modernere Soziologen Georg Simmel fragt wiederum, ob es nicht in uns bestimmte – lassen sie mich das einmal technischer sagen – Aprioris gibt. Gibt es also bestimmte Vorgaben, die wir uns nicht angeeignet haben, aber an denen wir nicht vorbeikommen und die das erste Erkennen bereits bestimmen. Simmel benennt vier solcher Apriori; von denen interessiert uns im Moment nur das zweite. Simmel sagt etwa um die Jahrhundertwende 1890/1900: Menschen nehmen andere Menschen immer in einer spezifischen Weise wahr, indem sie sich sagen: dieser Mensch geht nie gänzlich in den sozialen Bezügen und damit nie in Gesellschaft auf. Menschen seien, so Simmel, nach unserem vorgegebenen Wissen immer mehr als wie sie vor uns treten. Es bleibt immer etwas von ihnen außerhalb. Sie sind Gesellschaftsteil, aber immer noch etwas außerhalb davon. Er nannte dies ein soziales Apriori.
Dieses Wissen spielt in jeder zwischenmenschlichen Begegnung mit: Bei jedem Menschen, der mir gegenüber tritt, gibt es eine der Gesellschaft nicht zugewandte, ja der Gesellschaft abgewandte und damit von der Gesellschaft nicht ergriffene Seite. Diese steht nicht einfach beziehungslos neben dem sozial bedeutsamen Teil, aber sie zeigt sich eben nicht. Kurz: Jeder Mensch ist mehr als er sich in Gesellschaft zeigt. Jeder Mensch hat ein Außerhalb gegenüber dieser Gesellschaft.
Wir könnten diesen Gedanken noch einmal mit Beispielen umrahmen. Nehmen wir wiederum Shakespeare, von dem wir schon aus dem Hamlet und King Lear etwas gehört haben. Shakespeare wird eine ganze Reihe von Figuren schaffen – Falstaff, Hamlet, Lear, Othello, Cleopatra, Jago oder Macbeth. Diese Figuren gehen nicht in dem Text völlig auf, den ihnen Shakespeare gegeben hat, und auch nicht in den Handlungen, die sie auf der Bühne aufführen. Diese Figuren sind deshalb groß zu nennen, weil sie mehr sind als der ihnen zugemessene Text und die von ihnen ausgeführten Handlungen. Sie sind mehr als alle ihre Auftritte zusammen. Wir bezeichnen solche Figuren berechtigter Weise als groß. Und wir bezeichnen auch die Dramatiker als groß, die solche Figuren zustande bringen.
Um diesen Gedanken zu veranschaulichen, noch einmal ein Blick auf die Philosophie, und zwar auf eine Philosophie, die der des Thomas entgegengesetzt ist. Gemeint ist hier die philosophische Einstellung der Lyrikerin Ingeborg Bachmann. Diese hat in ihrer Rede zur Verleihung des Hörspielpreises der Kriegsblinden 1959 unter dem Titel „Die Wahrheit ist dem Menschen zumutbar“ Folgendes zum Ausdruck gebracht: „Es ist mir auch gewiss, dass wir in der Ordnung bleiben müssen, dass es den Austritt aus der Gesellschaft nicht gibt und wir uns aneinander prüfen müssen. Innerhalb der Grenzen aber haben wir den Blick gerichtet auf das Vollkommene, das Unmögliche, Unerreichbare, sei es der Liebe, der Freiheit oder jeder reinen Größe. Im Widerspiel des Unmöglichen mit dem Möglichen erweitern wir unsere Möglichkeiten. Dass wir es erzeugen, dieses Spannungsverhältnis, an dem wir wachsen, darauf, meine ich, kommt es an. Dass wir uns orientieren an einem Ziel, das freilich, wenn wir uns nähern, sich noch einmal entfernt.“
Wir sehen, wie hier in einer immanenten Sicht, das heißt in einer Sicht, die kein Übersteigbares annimmt und sich gleichsam auf die Gesellschaft beschränkt, gesellschaftliche Ziele entdeckt werden, die diese Gesellschaft überschreiten. Wenn Menschen sich auf diese ausrichten, so sind sie immer mehr als bloß ein gesellschaftliches Mitglied. Damit ist die These von der totalen Eingebundenheit des Menschen widerlegt.
Es gibt allerdings eine Gefahr und die sei nicht verschwiegen. Diese Gefahr besteht darin, dass wir jenen Mensch, der die Einbindungen in Gesellschaft zu sprengen und das Normalmaß zu übersteigen scheint, als sittlich ungebunden auffassen, das heißt als ein Wesen jenseits von Gut und Böse.
So schrieb Goethe nach seinem Treffen mit Napoleon naiv: „Außerordentliche Menschen wie Napoleon treten aus der Moralität heraus. Sie wirken wie physische Ursachen, wie Feuer und Wasser.“
An Feuer und Wasser stellen wir keine moralischen Ansprüche. Aber Napoleon ist eben nicht Feuer und Wasser, er ist ein Handelnder in der Geschichte und damit Teil der moralischen Menschheit. Solche enthusiastischen Aussprüche dürfen nicht übersehen lassen, dass auch solche Menschen unter dem Gewissensspruch stehen. Diesen hat Aristoteles immer wieder betont, wenn er über den allseits guten Menschen spricht. Dieser ist eine gewisse Übersteigerung, insofern er nicht ganz der Gesellschaft angehört.
Aber er ist für Aristoteles eben nur gut, weil dieser Handelnde den Anforderungen der Tugenden gerecht wird und sich in ihnen erst vollendet.
Wie gehen wir nun mit den Grenzen im Erkennen von Gesellschaft um? Wir haben gesehen, dass wir Distanz einnehmen und vertraute Gegenstände das eine oder andere Mal neu und ungewohnt ansehen müssen. Es gibt einen zu verantwortenden Mangel an Distanz. Wir haben darum zu wissen, dass Gesellschaft wie jeder andere Mensch nie als Ganze in den Blick kommt und auch nicht kommen kann. Sie vermag sich zudem als Ganze nicht zu repräsentieren. Wenn es im Folgenden um das Erkennen geht, dann können wir immer nur bestimmte Beziehungen zwischen uns und der Gesellschaft knüpfen. Wir wissen, dass wenn wir etwas ins Licht rücken, anderes damit in den Schatten versetzen. Dazu ein Beispiel aus der Rechtsphilosophie, das verdeutlich, dass unser Moderne einen guten Weg genommen hat: Wir machen heute Menschen für Handlungen verantwortlich, scheuen uns aber sehr, Rückschlüsse auf das ganze Leben der Handelnden zu ziehen. Es ist eine richtige Bescheidung, wenn wir nur über das Unrecht einer Tat und nicht über Täter Recht sprechen wollen. Nur über das konkrete Handeln sprechen wir Recht, nicht aber über die gesamte Persönlichkeit.