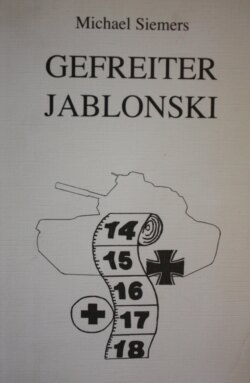Читать книгу Gefreiter Jablonski - Michael Siemers - Страница 4
Kasernenalltag
Оглавление„Die Rotärsche kommen!“ rief einer der Soldaten in halblautem Ton und
kündigte damit das Erscheinen der neuen Rekruten an, die ihr erstes Mittagessen
im Speisesaal der Graf Golz-Kaserne einnehmen durften. Das Geklapper der
Bestecke und das allgemeine Redegewirr verstummten. Kaum, dass der erste
Rekrut den Saal betrat, hämmerten gut 300 Bestecke auf den Tischen und
verursachte einen ohrenbetäubenden Lärm. Zurückhaltend traten die Rekruten
nacheinander ein und sahen sich verlegen um. Steif wie ihre gebügelten Arbeitsanzüge
waren ihre Bewegungen, blass und frisch ihre Gesichter. Jeder trug sein
Namensschild auf der rechten Brust und hatte im Gegensatz zu den anderen
Barettträgern ein Schiffchen auf dem Kopf. Wenn sie auch in einem Panzerbataillon
stationiert waren und den Dienstgrad „Panzerschütze“ trugen, so waren
sie von dieser Einheit noch weit entfernt. Sie hatten erst einmal die
Grundausbildung zu absolvieren, bevor sie hautnah mit der 48-Tonnentechnik
eines Kampfpanzers konfrontiert wurden.
Der Empfangslärm ebbte erst ab, als auch der letzte Rekrut den Saal betrat. Von
ihrem Unteroffizier wurden sie an zwei separate Tischreihen geführt, damit sie
sich langsam in das Bataillonsleben integrierten. So lautete die formelle
Anweisung des hiesigen Bataillonskommandeurs Oberst Fleck. Im Klartext hieß
das nichts anderes, als: „Kein Rotarsch soll sich erdreisten, sich an einen Tisch
mit Reservisten zu setzen.“
Reservisten waren normalerweise Soldaten, die zur Reserveübung eingezogen
wurden. Doch nannten sich auch diejenigen Reservisten, die das letzte Vierteljahr
abzuleisten hatten. Daher wurden die Rekruten mit der aktuellen Tageszahl „89“
begrüßt. Was das zu bedeuten hatte wurde ihnen sehr schnell klar. Mit ihrer
astronomischen Zahl von über „500“ hätten sie nur lockeres Gelächter ausgelöst.
Das Panzerbataillon 174 war in der Graf Golz Kaserne in Hamburg-Rahlstedt
stationiert. Urkundlich tauchte das namensgebende märkische Uradelsgeschlecht
schon im Jahre 1297 auf. Wie sehr es vom militärischen Flair überschattet war,
bewiesen 22 Generale, von denen mindestens vier in die Geschichte eingingen.
Der letzte unter ihnen war Rüdiger Graf von der Golz, General und Kommandeur
jener deutschen Truppen, die Finnland im Jahre 1918/19 von der Roten Armee
befreiten. In dieser Kaserne waren die erste Stabs- und Versorgungs-, die dritte
und vierte Kampf- und die zweite Ausbildungskompanie untergebracht. Die
klotzigen Backsteingebäude waren genauso trist wie das Leben darin. Alles war
gleich: jeder Flur, jede Stube und jeder Keller. Persönliche Gestaltung war
lediglich in den Büros zu finden, wenn man einige Bilder und Blumen so nennen
durfte. Die Stuben der Soldaten, sechs bis acht Betten und Schränke, sowie die
gleiche Zahl Stühle und einen Tisch waren nach dem Architekturschema „F“
gestaltet. Anfang der siebziger Jahre wurden die Blocks renoviert. Unterrichts-und
Sanitätsgebäude waren derzeit die einzigen Neubauten, die sich im Stil von
den übrigen Blocks abzeichneten. Die Steinböden der Flure rochen nach scharfen
Reinigungsmitteln, die sich mit allen möglichen Gerüchen vermischten. Schweiß,
Leder, Chlor und gelegentlich wohlriechende Seifen und Deos durchzogen die
Räume der Kompanien. In der Kasernenmitte breitete sich der riesige, asphaltierte
Exerzierplatz aus, auf dem Appelle, Befehlsausgaben, Begrüßungen, Beförderungen
und Verabschiedungen im großen Stil abgehalten wurden. Rechts vom Exerzierplatz
standen die Hallen der Lkws und die Werkstätten der Instandsetzung. Dahinter reihten
sichkorrekt ausgerichtet die schwerfälligen M48-Kampfpanzer, die in Lärm,
Anfälligkeit und Kraftstoffverbrauch unschlagbar waren. Sie warteten darauf,
durch den modernen Leopard Panzer abgelöst zu werden.
Vorgeschmack war der Bergepanzer Leopard, kurz „Leo“ genannt. Selbst wenn
dieser einen Panzer im Schlepp hatte, so musste der „M-48“ schon eine heiße
Kette hinlegen, um nicht die Schlusslichter entschwinden zu sehen. Es gab
Soldaten, die sich auf zwei Jahre verpflichteten, wenn sie in dieser Zeit den Leo
lenken durften. Man mag darüber denken, was man will, aber eine schöne
Geländefahrt in einem Panzer dieser Größenordnung war eines der beliebtesten
Dinge, die einem in so einem Bataillon widerfahren konnte.
Der achtzehnmonatige Wehrdienst war mit Ausnahme der dreimonatigen Grund-,
Fahr- und Fachausbildung, ein träges Dahinsiechen. Langeweile und
Lustlosigkeit machten sich da breit, wo es galt, seine Zeit abzubummeln. Die
Unproduktivität ihrer Arbeit, das stumpfsinnige Pflegen und Warten der
Maschinen und Geräte sowie die langatmigen Appelle ließen die Männer
abstumpfen. Fairerweise aber sei gesagt, dass Ausnahmen nicht selten waren.
Pioniere beispielsweise, die bei Sturm und Regen Brücken bauten, um sie danach
wieder wegzusprengen. Grenadiere, die durch Schlamm robbten und Schützengräben
aushoben, während ihnen der eisige Sturm ins Gesicht fegte. Hinzu kamen
die Einengung der Privatsphäre, die unbezahlte Anwesenheit für Wachen,
Bereitschaften, Übungen und Sonderdienste. Dies erstickte jedes Interesse an der
Bundeswehr.Doch hatte der Wehrdienst auch seine positiven Aspekte. Gerade Mütter
dienender Soldaten begrüßten die Sauberkeit und Ordnung. Das Leben in der
Gemeinschaft lehrte zur Solidarität und Kameradschaft. Jede erdenkliche
Ausbildung war großzügig, gut und teuer. Der knappe Wehrsold zwang zur Sparsamkeit
und die Verantwortung für Wäsche und Geräte veranlassten die Soldaten,
sorgsam und pfleglich mit den ihnen anvertrauten Sachen umzugehen. Um es auf
einen Nenner zu bringen: Der Wehrdienst war in den Augen der Eltern der letzte
Schliff ihrer, auf der Strecke gebliebenen, Erziehungstheorien.
Die Mittagspause war gerade beendet und das allgemeine Betriebsleben nahm
seinen Lauf. Einige Teileinheiten der ersten Kompanie marschierten geschlossen
zu ihren Arbeitsplätzen. Ein paar Offiziere pendelten zwischen Stab, Kasino und
Kompanien hin und her. Vor einigen Kompanieblocks standen Lkws, die be- oder
entladen wurden.
Es war ein Tag wie jeder andere und alles ging recht lahm und lustlos voran. Die
Neuen brachten wenigstens ein bisschen Abwechslung in den olivgrünen Alltag
der Kaserne, und man konnte endlich wieder die sorgsam gehüteten Witze an den
Mann bringen. Auf dem Exerzierplatz reihten sich gerade die Rekruten zur
Formalausbildung auf. In ihren sauberen kräftig grünen Kampfanzügen sahen sie
noch recht geschniegelt aus. Die Zugführer waren bemüht, ihnen Disziplin und
Gehorsam einzubrüllen und somit die krause Zivilhaltung auszubügeln. „Würden
Sie“ und „könnten Sie“ wechselte in „Marsch, Marsch“, und „Zack, Zack“.
Mit dummen Bemerkungen mitten aus der Reihe heraus marschierte der Inst.-Zug
(Instandsetzungszug) der Ersten an ihnen vorbei. In ihren blauen verwaschenen
Arbeitsanzügen sahen alle gleich aus und der ablehnende Ausdruck ihrer
Gesichter machte jeden Rekruten deutlich klar, dass diese Männer ihre
Grundausbildung schon weit hinter sich hatten.
„Ruhe da vorn!“, mahnte der nebenher marschierende Feldwebel, als die Lautstärke
der Witzeleien zunahm. Es war ein Entgegenkommen gegenüber ihren
ausbildenden Kameraden, die jedoch genug mit ihren Soldaten zu tun hatten und
sich gar nicht darum kümmerten.
Langsam stieg der Gefreite Gerd Jablonski die grauen Steinstufen zum VU-Boden
(Versorgungsunteroffizier) im Dachgeschoss hinauf. Seine Beine waren
noch schwer wie Blei nach seinem Mittagsschlaf, den er sich regelmäßig gönnte.
Das Resultat war jedoch immer gleich: Er war hinterher noch niedergeschlagener
als vorher. Das stets ungekämmte blonde Haar reichte knapp bis zu seinem
Kragen. Mit gestrecktem Hals und heruntergezogenem Kragen konnte er sich
jedoch stets durch den Haarappell mogeln. 1970 wurde der sogenannte
„Haarerlass“ erteilt, was den Soldaten erlaubte, das lange Haar zu behalten. „Es
kommt nicht darauf an was der Soldat auf dem Kopf hat, sondern was er im Kopf
hat“, war die Wahlparole der damaligen SPD und verbuchte so erfolgreich einige
Wählerstimmen für sich. Für das Tragen langer Haare war die Benutzung eines
Haarnetzes vorgeschrieben. Die ersten Haarnetze waren so dünn, dass sie
allenfalls drei Tage hielten. Es dauerte nicht lange und der Nachschub kam ins
Stocken. So wurden dann die ersten Ausnahmen erteilt, was wiederum zur Folge
hatte, dass die Soldaten bei der Beschädigung nachhalfen. Nach ca. einen halben
Jahr kamen die neuen Haarnetze. Dunkelbraun, stabil und so eng wie eine zu
klein geratene Pudelmütze. Einige fanden heraus, dass man darin locker fünf
Flaschen Bier transportieren konnte, und es hieß, es ließe sich sogar ein LKW
damit abschleppen. Wie die meisten Soldaten zog es auch der Gefreite Jablonski
vor, sein Haar kurz zu tragen, um dieses unbequeme Witzteil nicht benutzen zu
müssen. (Zwei Jahre später wurde der Erlass wieder zurückgenommen.)
Sein schwarzes Barett mit silbernem Panzeremblem saß schräg auf seinem Kopf.
Über die Schulter hing lose der Parka, den er tauschen wollte. Der Gefreite
Jablonski war Wehrpflichtiger und hatte noch ein Vierteljahr abzuleisten. Stolz
wie jeder Reservist, der etwas auf sich hielt, trug er eine Maßbandrolle, deren
Zentimeter die jeweilige Tagesrestzahl anzeigte. Er war nicht das, was man einen
Mustersoldaten nannte, dafür aber war er clever genug, sich durch zumauscheln
und konnte seine Vorgesetzten gut unterscheiden. Vom zackigen Gruß, zum
freundlichen guten Morgen bis hin zum kleinen Scherz, wusste Jablonski sehr
gut, wie er sich zu verhalten hatte. Außerdem war er recht beliebt bei seinen
Kameraden, da er als Sanitäter das Behandlungszimmer des San-Bereichs
(Sanitätsbereich) unter sich hatte. Alle, die vom Stabsarzt kamen, holten sich bei
ihm Verbände und Medikamente ab. Da lag es schon nahe, dass sich der eine
oder andere etwas zu besorgen versuchte. Der Küche und der Werkstatt gegenüber
war Jablonski besonders großzügig, was ihm einige Extrawürste einbrachte.
Die Medikamente der Bundeswehr waren ohnehin gut und teuer, was auch die
Angehörigen der Soldaten zu schätzen wussten. Die Legende von roten und
weißen Einheitspillen war die Erfindung unwissender Soldaten. Dass viele die
gleichen Medikamente bekamen, lag daran, dass sie mit den gleichen, meist
simulierten Symptomen zum Stabsarzt gingen.
Als Jablonski die schwere Eisentür zum VU-Boden öffnete, kam ihm der Geruch
von Mottenkugeln und Lederstiefeln entgegen. Unteroffizier Hechler war der VU
(Versorgungsunteroffizier) und ein Streber, der seinesgleichen suchte. Sein
kantiges Gesicht, die braunen Augen, die sich hinter einer Hornbrille versteckten,
hatten zynische Züge an sich. Seit er zum Stabsunteroffizier vorgeschlagen
worden war, kannte seine Eifrigkeit keine Grenzen. Seine Lebensauffassung
bestand darin, nach oben zu kriechen und nach unten zu treten. Daher war er hier
oben in seinem Kleiderloch recht gut aufgehoben. Sogar Soldaten seines Ranges
legten keinen großen Wert auf seine Gesellschaft. Die wenigen Freunde, die er
hatte, akzeptierten ihn auch nur deshalb, weil er als Versorgungsunteroffizier mal
das eine oder andere ohne große Formalitäten beschaffen konnte. Offiziere hatten
bei ihm natürlich Vorrang. Da genügte ein Anruf und schon schickte er seinen
Gehilfen los. Es spielte auch keine Rolle, wann der Anforderungszettel eingereicht
wurde. Hechler war gerade mit Unteroffizier Schrader beschäftigt, der
einige Sachen zu tauschen hatte. Schrader war Fahrlehrer der ersten Kompanie,
bei dem auch Jablonski seine Führerscheine C.E und F1 gemacht hatte und zu
dem er noch immer guten Kontakt hatte. Er grüßte nickend, als Jablonski seinen
Parker auf den Tresen legte. Dabei blickten seine Augen müde zwischen die
Regale hindurch zum VU.
„Hemd, Hose, Schuhe. Alles?“, fragte Hechler, als er die Sachen über die
Tresenplatte schob.
„Ne Krawatte kannst du mir noch mitgeben, meine ist schon so ausgeblichen. Die
bringe ich dir nachher hoch“, sagte Unteroffizier Schrader tonlos. Der VU
verschwand hinter den Regalen, auf denen pedantisch geordnet die
verschiedensten Wäschestücke lagerten. Ein Bilderbuch hätte die Ordnung nicht
besser darstellen können. Selbst die ausgesonderte Kleidung war trapezförmig
auf dem Fußboden gelagert. Die Schuhe standen sortiert in Reih und Glied. Eine
DIN A4 Seite verriet, dass er noch immer die Hemden in Rekrutenmanier
zusammenlegte. Die Abstände zwischen den Wäschestapeln betrug genau 4
Zentimeter, das Maß eines Dachlattenstückes. Unteroffizier Hechler brachte ihm
die Krawatte. Schrader packte seine Sachen zusammen und ging zum Ausgang.
„Empfehlen Sie uns weiter, Herr Unteroffizier!“, rief Jablonski ihm scherzhaft
nach. Schrader nickte kurz und ließ ein knappes Lächeln über die Lippen
huschen.
„Einmal tauschen“, sagte Jablonski tonlos, schob den Parka rüber und legte
seinen Anforderungszettel daneben. Eindringlich untersuchte Hechler den Parka,
während Jablonski ihm schweigend mit berechtigter Vorahnung auf die Finger
sah. Er hatte schon einmal Ärger mit diesem VU gehabt. Damals wollte Jablonski
durchlöcherte Strümpfe tauschen, doch musste er sie erst stopfen, tragen und
wieder waschen. Als es dann endlich soweit war, waren keine Strümpfe auf
Lager. Sein Protest wurde mit dem kurzen Befehl „Raus!“ beendet. Hechler
verstand es, wenn auch ungewollt, seine Beliebtheitsskala auf den Tiefstand zu
bringen. Mit jedem UvD (Kompaniewache als Unteroffizier vom Dienst) oder
Wachdienst schaffte er sich neue Feinde. Fieberhaft suchte er nach Fehlern am
Parka.
„Suchen Sie Flöhe?“, fragte Jablonski ungeduldig.
„Ihr Parka weist diverse Löcher auf. Es fehlen drei Knöpfe und schmutzig ist er
auch. So nehme ich ihn nicht an.“
„Wäre er in tadellosem Zustand würde ich ihn wohl nicht tauschen wollen.“
„Interessiert mich nicht!“, wehrte Hechler ab und begründete sein Handeln: „Laut
Dienstvorschrift hat er sauber und heil zu sein.“
„Westphal hat es nie so eng gesehen“, erinnerte Jablonski ihn, womit er auf
dessen Vorgänger anspielte.
„Ich bin nicht Westphal“, wehrte Hechler gelassen ab.
„Rein menschlich sind Sie auch weit davon entfernt, Herr Unteroffizier!“, sagte
Jablonski, nahm seinen Parka und wollte gehen.
„Ihr Ton passt mir nicht, Herr Gefreiter!“, schrie Hechler ihn an und stützte seine
Hände auf. Lässig zog Jablonski sein Maßband aus der Tasche und hielt sie dem
Unteroffizier sichtbar hin. „Neunundachtzig,“, kommentierte er knapp. Hechler
blähte sich auf und drohte: „Wenn Sie mir noch einmal ihre Tageszahl nennen,
nehme ich Sie fest!“
„Sie können mich so fest nehmen wie Sie wollen, Herr Unteroffizier, das ändert
nicht an der Tatsache, dass ich nur noch 89 Tage habe“, wiederholte Jablonski
und steckte das Maßband wieder weg. Wie von einer Tarantel gestochen jagte
Hechler um den Tresen herum und baute sich drohend vor Jablonski auf. Dieser
sah ihn erwartungsvoll und abwartend an.
„Gefreiter Jablonski, hiermit nehme ich Sie vorläufig fest. Folgen Sie mir aufs
Geschäftszimmer!“
Unbeeindruckt steckte Jablonski die linke Hand in die Hosentasche und fragte: „
Wie wollen Sie ihre Festnahme begründen?“
„Wegen Beleidigung eines Unteroffiziers.“
Jablonski überlegte kurz. Ein Gedankenblitz ließ sein Gesicht aufhellen.
„Okay“, sagte er überlegen, „Sie machen Meldung über die Beleidigung und ich
beschwere mich darüber, dass Sie mir in den Schritt gefasst haben. Was halten
Sie davon?“
Unteroffizier Hechler verschlug es die Sprache. Er rang fieberhaft nach Worten
und brauchte eine geraume Zeit, sich zu fassen. Ihm war klar, dass er ohne
Zeugen gar nichts machen konnte. Seine Unsicherheit festigte Jablonskis
Haltung.
„Selbst wenn meine Beschwerde abgelehnt wird, so werden sich doch einige ihre
Gedanken machen. Und wer sich Gedanken macht, plaudert gern. So entstehen
Gerüchte Herr...“
„Halt die Schnauze!“, fuhr Hechler ihn an, wobei sein ganzer Körper bebte und
das rotanlaufende Gesicht verriet die Wut, die in ihm tobte. Die Fäuste ballten
sich und er wankte unschlüssig hin und her. Der sonst so dienstbewusste
Unteroffizier vernachlässigte seine vorschriftsmäßige Umgangsform nur dann,
wenn er in Rage geriet und es keine dritten Zuhörer gab. Er nutzte die Zeit
einiger Atemzüge, um zu überlegen, wie er diesem rotzfrechen Gefreiten
beikommen konnte. Aber ihm fiel nichts gescheites ein.
„Du mieses kleines Dreckschwein“, fluchte er leise vor sich hin.
„Dienstgeile Z-Sau!“, konterte Jablonski, drehte sich um und ließ ihn stehen.
„Eines Tages krieg ich dich!“, schrie Hechler in seiner Verzweiflung hinterher.
Ohne sich noch einmal umzudrehen, hob Jablonski die Faust in die Höhe und
streckte den Mittelfinger. Deutlicher hätte er seine Abneigung gegen Hechler
nicht zeigen können. Dem VU blieb nichts anderes übrig, als zahlreiche Flüche
hinterher zu schicken. Diese kleine Niederlage bekam der VU-Gehilfe Gefreiter
Liebherr zu spüren. Für seine fünfminütige Verspätung faltete Hechler ihn
gnadenlos zusammen und ließ ihn die ausgemusterten Stiefel putzen, die auf
einem Regal unterhalb des Fensters aufgereiht waren.
Liebherr war ein stiller, introvertierter Typ mit einem regelrechten Milchgesicht,
der nur schwer mit der rauhen Realität der Bundeswehrumgebung zurechtkam.
Hechlers Opportunismus machte ihn unweigerlich zum Duckmäuser und
Denunziant. Niemand legte Wert auf seine Bekanntschaft und er fühlte sehr wohl
die Ablehnung seiner Kameraden. Er selbst aber verbaute sich, ob ungewollt oder
aus Dummheit, den Anschluss an das kameradschaftliche Kasernenleben. Der
Hang zur Absonderung ließ ihn zu einen Leisetreter werden. Die Anbiederungen
an Hechler tat ihr übriges. Er und der VU verkörperten das typische Herr- und
Knechtgespann.
Jablonski hängte seinen Parka wieder in den Spind zurück und ging ohne große
Eile zum San-Bereich. Nach kurzer Rückmeldung beim Gruppenführer begab er
sich in das Bestrahlungszimmer, wo der Gefreite Hoppe hastig einen Lappen griff
und vorgab, als putze er die Geräte. Er ließ sich und den Lappen auf einen Stuhl
fallen, als er seinen Kameraden erkannte.
„Bestrahlung?“, erkundigte er sich scheinbar besorgt. Jablonski beantwortete die
überflüssige Frage gar nicht erst. Es war längst ein offenes Geheimnis, dass sich
von Zeit zu Zeit die Sanitäter eine Bestrahlung verabreichten. Er nahm den
Lichtkasten, schraubte fünf der sechs Glühbirnen lose und legte sich auf die
Liege. Hoppe stülpte ihm den Kasten über den Kopf. Doch der Schein trog im
wahrsten Sinne des Wortes. Statt der Hitze genoss Jablonski für die nächste halbe
Stunde die Ruhe. Die eine Birne tat seiner Müdigkeit keinen Abbruch. Dies alles
wurde vom San-Gruppenführer Oberfeldwebel Hamann stillschweigend und
indirekt geduldet. Er legte nur Wert darauf, dass ihm die lasche Disziplin nicht
außer Kontrolle geriet. Wichtig waren ihm die An- und Abmeldung, die
morgendliche Meldung des San-UvD´s (Sanitätsunteroffizier von Dienst) und die
Beschäftigungsbereitschaft seiner Soldaten. Es interessierte ihn nicht, ob das
Ordentliche noch einmal geordnet, das Geprüfte noch einmal geprüft oder das
Saubere noch einmal gereinigt wurde. Die Hauptsache war, das niemand untätig
herumstand. Wenigstens nicht in seiner Nähe. Seine Bemühung, es jedem Recht
zumachen war zwar lobenswert, aber es klappte nicht immer. Wer glaubte, vom
Oberfeldwebel fordern zu können, hatte plötzlich einen diensteifrigen Vorgesetzten
vor sich. Die Sanis kannten ihn sehr gut und wussten, wie weit sie gehen konnten.
Oberfeldwebel Hamann war ansonsten ein geselliger Mann, der besonders in kleiner
Runde sehr kameradschaftliche Züge hatte. Seine Angewohnheit war es, jeden Morgen
das Behandlungszimmer zu betreten, sich die Hände zu waschen und die Zunge vor
dem Spiegel herauszustrecken. Danach wechselte er ein paar unbedeutende
Worte mit Jablonski und verschwand wieder.
Bis auf den morgendlichen Krankenverkehr war der San-Dienst eher stupide.
Abwechslung hatten eigentlich nur die Kraftfahrer, zu denen auch Jablonski
gehörte. Zweimal die Woche war technischer Dienst, kurz TD angesagt. Da
hielten sich die Sanis an ihren Fahrzeugen auf und achteten lediglich darauf,
schnell ein Werkzeug oder die Ölkanne in die Hand zu nehmen, wenn der
Schirrmeister (ähnlich Fuhrparkleiter) seine Runde machte. Denn bei dem
chronischen Bewegungsmangel der San-Fahrzeuge, die nur bei Alarm und
Übungen zum Einsatz kamen, war ohnehin nichts zu pflegen und zu warten. Man
wartete höchstens auf Dienstschluss. Dann jedoch blühte die Eifrigkeit gegen
frühen Abend wieder auf und alles wurde in Bewegung gesetzt, um nicht nach 17
Uhr irgendwelchen dienstlichen Mist erledigen zu müssen. Das Wörtchen Dienstschluss
motivierte alle noch einmal schnellstens die Kompanien, beziehungsweise
die Stuben zu erreichen.
Jablonski stand vor dem Schwarzen Brett seiner Kompanie und überflog die
Zeilen. Bekanntmachungen, Befehle und Maßnahmen reihten sich aneinander.
Für den kommenden Dienstag war ein Fünfundzwanziger (25 Kilometer langer
Marsch) angekündigt. Das bedeutete wieder allerhand Arbeit für die Sanis.
Morgens die Simulanten, die sich vor dem Marsch drücken wollten, und mittags
die Fußkranken. „Wenigstens winkt dem Ersten einen Tag Sonderurlaub zu“,
dachte er bei sich.
Was das Marschieren anging, hatte Jablonski eine gute Kondition und somit gute
Chancen den Tag für sich zu gewinnen. Etwas weiter rechts waren die
erzieherischen Maßnahmen angeheftet, die der Kompaniechef in seiner
Herrlichkeit gern erließ. Damit konnte man ohne große Formalitäten Druck auf
Soldaten ausüben. Eine kleine Meldung genügte und der Abend oder das
Wochenende waren dahin. Als Jablonski seinen Namen las, stutzte er und überflog
die Zeilen. Ihm wurde befohlen, am kommenden Sonntag um 10 Uhr seine
gesamten Dienst- und Kampfjacken dem UvD vorzuzeigen. Neugierig besah er
sich den UvD-Plan. Der Name des Hauptgefreiten Specht war durchgestrichen
und dahinter stand kein anderer als der des Unteroffiziers Hechler. Jablonski
wurde einiges klar. Hechler hat nicht nur mit seiner Meldung zum Schlag
ausgeholt, er bot sich sogar als UvD an um die Kontrolle selbst zu übernehmen.
Auf direktem Weg ging Jablonski auf das Geschäftszimmer. Stabsunteroffizier
Weber sortierte gerade einige Papiere und an der Schreibmaschine hämmerte der
Gefreite Bernstein in die Tastatur.
„Wieso steht denn Unteroffizier Hechler auf dem UvD-Plan?“, fragte Jablonski in
den Raum, als meinte er alle beide. Weber hob die Schultern und drückte seine
Ahnungslosigkeit aus. Hauptfeldwebel Schmidt trat aus dem Nebenraum und
erfragte den Grund seines Interesses. Mit knappen Worten begründete Jablonski
seinen Verdacht, dass der Unteroffizier ihm eins auswischen wollte
„Wenn Specht mit dem Tausch einverstanden war“, erklärte Hauptfeldwebel
Schmidt, „ kann ich nichts unternehmen. Außerdem haben Sie ja nichts zu
befürchten, wenn ihre Kleidung in Ordnung ist.“
„Ich versau mir aber damit das ganze Wochenende!“, murrte Jablonski beleidigt.
„Tja...“, war das Einzige, was der Spieß darauf antworten konnte.
Als Jablonski das Geschäftszimmer verließ, lief ihm gerade der Hauptgefreite
Specht über dem Weg. Er hielt ihn am Arm fest und fragte: „Warum hast du mit
Hechler getauscht?“
„Würdest du ein freies Wochenende ablehnen?“, stellte Specht die Gegenfrage.
Er wusste ja nicht, was Hechler im Schilde führte. Nickend gab Jablonski ihm
recht. Ihm war klar, dass er nichts mehr dagegen tun konnte, als seine Jacken auf
Vordermann zu bringen. Die letzten Stunden dieses Freitags brauchte Jablonski,
um sich die nötigen Knöpfe zu besorgen. Auf dem dienstlichen Versorgungsweg
war in der kurzen Zeitspanne nichts mehr zu machen und so schnorrte er seine
überwiegend knopflosen Kameraden an.
Kaum eine seiner Jacken hatte alle Knöpfe beisammen. Die Dienstjacke zum
Beispiel wurde nur noch von einem einzigen Knopf gehalten. Die restlichen
Knöpfe waren mittels eines Streichholzes direkt am Knopfloch befestigt. Eine
Windböe zur rechten Zeit hätte ohnehin alles verraten.
Als er endlich alles besorgt hatte, machte er sich an die Arbeit. Der Spott seiner
Stubenkameraden und die beiden Stiche in seinem Daumen nahmen ihm
jeglichen Willen. Er war sicher, dass sich seine Freundin besser damit
beschäftigen konnte. Kurzerhand nahm er sich eine Jacke, stopfte die übrigen
hinein und knotete sie zu einem Ballen zusammen. Dann machte er sich auf den
Weg nach Hause.
Jablonski wohnte bei seinen Eltern in einem kleinen Haus in Ahrensburg. Von
der Kaserne waren es knapp sechs Kilometer und bei trockenem Wetter fuhr er
diese Strecke mit dem Rad. Zu Hause sprach er selten über den Bundeswehralltag.
Noch weniger über die negativen Seiten. Seine Mutter mahnte ihn stets zum
ordentlichen Benehmen, vor allem Offizieren gegenüber. Sie vertrat die
Auffassung, dass Offiziere nun einmal ein hohes Ansehen hatten und
dementsprechend mit Respekt geachtet werden mussten. Mit seinem Vater sprach
er ebenfalls ungern darüber, da dieser ein recht konservativer Jahrgang war, der
seine eigenen Erfahrungen in Stalingrad gesammelt hatte. Ihr einziger Sohn
genoss so annähernd alle Freiheiten, sofern es kein schlechtes Licht auf die
Familie warf. Er hatte sein eigenes Zimmer, durfte kommen und gehen wann er
wollte. Nur weiblichen Besuch hatte er seinen Eltern vorzustellen. Um die
Wäsche kümmerte sich seine Mutter, weil es ihm bei der Bundeswehr zu
umständlich war. Außerdem versuchte er jeden überflüssigen Kontakt zum VU
zu vermeiden.
Obwohl er nicht rauchte und relativ selten trank, reichte sein Wehrsold allenfalls
bis zur Monatsmitte, so das seine Mutter ihm dann heimlich etwas zusteckte.
„Brauchst du Papa nicht erzählen, du weißt ja, wie er ist“, pflegte sie stets zu
sagen.
„Steck mal weg, muss sie ja nicht unbedingt wissen“, verabschiedete sein Vater
ihn dann an der Gartenpforte und ließ beim Händeschütteln einen Geldschein
wechseln. „Wenn es der Sache nützlich ist“, dachte sich Jablonski und zog dann
zufrieden ab.
Britta Scherenberg, seit mehreren Monaten Jablonskis Freundin, saß mit
gekreuzten Beinen auf seinem Bett und nähte die Knöpfe an. Vom Plattenspieler
tönte Mary Ross` „Arizona man“.
Brittas freundliches Gesicht sah diesmal eher düster aus, denn sie fühlte sich
irgendwie geleimt, weil er es mal wieder mit viel Überredung und Charme
geschafft hatte, ihr die Arbeit zu überlassen. Unermüdlich nähte sie einen Knopf
nach dem anderen an, während er mit einem Fleckenwasser seinen Parka zu
Leibe rückte. Britta studierte Architektur in Marburg und so hatten sie nur am
Wochenende Gelegenheit, sich zu sehen.
Gerade an diesem Wochenende lag ihr besonders viel an einer intensiven
Zweisamkeit. Denn für die nächsten sechs Wochen stand eine Studienreise bevor.
Aus unerklärlichen Gründen hatte sie es ihm noch nicht erzählt, und während sie
so vor sich hin nähte, formten sich in ihrem Kopf passende und zugleich
schonende Worte, um es ihm beizubringen.
Jablonski war ihr erster richtiger Freund. Die sechswöchige Trennung und die
Angst, ihn zu verlieren, bereiteten ihr großes Kopfzerbrechen.
„Du, ich muss dir etwas sagen“, begann sie zögernd. Jablonski blickte zu ihr auf,
brummte eine Art Bestätigung und machte weiter.
„Ich, ich verreise nächste Woche...“, kam es zögernd aus ihr heraus. Jablonski
sah kurz zu ihr und fragte: „Und wie lange?“
„Sechs Wochen. Weißt du, wir machen eine Studienreise nach Israel.“
Ihm fiel die Kinnlade herunter und es dauerte eine ganze Weile, bis er das
geschluckt hatte.
„Muss das sein?“, fragte er fast vorwurfsvoll. Britta legte die Jacke beiseite und
sah ihn entschuldigend und traurig zugleich an.
„Ich kann mich nicht davon ausschließen.“
„Und das fällt dir erst jetzt ein?“, fragte er vorwurfsvoll.
„Eigentlich weiß ich das schon seit vier Wochen, aber ich...“
„Ich wette, dass euer Hund es früher wusste als ich!“, unterbrach er sie beleidigt,
als hätte sie zu ihrem Hund mehr Zutrauen.
„Die Reise ist für mein Studium sehr wichtig“, verteidigte sie sich und sah ihn
mitfühlend an. Jablonski schüttelte nur verständnislos den Kopf. Ausgerechnet an
diesem Wochenende musste er seine Sachen dem UvD vorführen. Mit beleidigten
Mundwinkeln machte er sich wieder an seinem Parka zu schaffen. Britta sah ihm
schweigend zu. Sie fühlte sehr wohl, wie wütend er war und sie musste ihm
ehrlicherweise recht geben. Sie hüpfte vom Bett herunter und setzte sich auf
seinen Schoß. Sanft schmiegte sie sich an ihn und flüsterte ihm ins Ohr: „Es war
doch immer so schön, deshalb wollte ich dir nicht die Laune verderben. Das
verstehst du doch, oder?“
Jablonski küsste ihren Hals und brummte zustimmend. Wahrscheinlich wären die
vorangegangenen Treffen nicht so harmonisch verlaufen, wenn der Tag der
Abreise immer näher rückte.
„Ich fliege nächsten Samstag früh. Aber ich kann schon am Freitagmorgen hier
sein“, sagte sie mit euphorischer Vorfreude.
„Dann bin ich in der Kaserne“, warf Jablonski ein. Doch da erinnerte er sich an
den Fünfundzwanziger und den eventuellen Tag Sonderurlaub. Sein Gesicht
wurde durch die kleine Hoffnung wieder freundlicher und er erzählte seiner
Freundin davon.
„Glaubst du wirklich, dass du es schaffst?“, fragte sie misstrauisch.
„Ich marschiere ganz gut. War fast immer einer der Ersten“, beruhigte er sie und
auch sich.
„Muss nur meinen Oberfeld fragen, ob ich den Tag Freitag schon kriegen kann.“
„Kannst du dir nicht so einen Tag freinehmen?“, fragte Britta. Sie wollte nicht,
dass er solche Strapazen auf sich nimmt.
„Ich bin Soldat und kein Angestellter“, lachte Jablonski, „Vierzigstundenwoche
und Betriebsrat gibt es bei uns nicht!“
Britta sah ihn mitleidig an und sagte: „Ihr Soldaten seid wirklich arme Schweine.
Jeder popelige Lehrling hat mehr Rechte als ihr. Bei euch kommt doch sowieso
nichts Produktives zustande und Soldaten sind genug vorhanden, da können sie
dir doch mal einen Tag geben.“
Sie hatte nie viel Verständnis für die Bundeswehr.
„Achtundachtzig“, flüsterte ihr Jablonski küssend zu, was sie ebenso gefühlvoll
erwiderte.
„Ich möchte nicht, dass du dich deswegen kaputt machst“, sagte sie besorgt und
drückte ihre Stirn gegen seine.
„Gemessen an der Belohnung, die ich von dir bekomme, ist der
Fünfundzwanziger ´ne Lachpille!“ lachte Jablonski und drückte sie fest an sich.
Fast unbemerkt wurden die grauen und olivgrünen Jacken beiseitegeschoben und
sie befassten sich mit der Anatomie ihrer Körper. Die gefühlvolle Hingabe war
kein Vergleich zum stumpfsinnigen Annähen der Knöpfe. Die Schallplatte war
längst zu Ende und kratzte unbeachtet vor sich hin.
Den Samstag über half Britta Frau Jablonski im Garten, während ihr Freund sich
um ihren altersschwachen VW-Käfer kümmerte. Sein Vater saß zeitungslesend
auf einer Holzbank, die unter einem Apfelbaum stand. Ab und zu sah er zu den
beiden Frauen, wobei er wohl eher Brittas wohlgeformtes Hinterteil betrachtete,
der den Stoff ihrer Jeans spannte. Er mochte sie sehr gern und hoffte natürlich
dass sie eines Tages seine Schwiegertochter werden würde. Frau Jablonskis
Garten war bis auf den letzten Quadratmeter mit Gemüse bepflanzt und liebevoll
hergerichtet. Britta zeigte großes Interesse, da sie als reiner Stadtmensch das
Gemüse nur aus den Auslagen eines Supermarktes kannte. Für Frau Jablonski
war das die beste Gelegenheit ihr jede Pflanze vorzustellen und deren Pflege zu
erklären. Ihrem Sohn dagegen hatte sie jede Tätigkeit im Garten untersagt,
nachdem er einmal statt Unkraut die Setzlinge beseitigt hatte.
Auch diese Nacht hatte sie bei ihm verbracht. Frau Jablonski hatte Britta, getreu
ihrer moralischen Vorstellung, ein Bett in der Wohnstube zurechtgemacht. Dass
es nur zum Zubettgehen und Aufstehen benutzt wurde, dafür sorgte schon ihr
Sohn. Um seiner Mutter die Illusion vom braven, wohlerzogenem Mädchen zu
erhalten, durfte es Britta nicht verpassen, frühzeitig aus seinem Bett zu flüchten,
damit seine Mutter sie auch wirklich im Wohnzimmer antraf.
Am Sonntagmorgen machten sich beide auf den Weg zur Kaserne. Die Sonne
schien und es kamen ihnen die ersten Sonntagsausflügler entgegen, die es in die
freie Natur trieb. Mit verschränkten Armen und etwas missmutig saß Jablonski
auf dem Beifahrersitz und sah ins Leere.
Auf der Bundesstraße 75 fing der Wagen ein paar Mal an zu stottern, als nehme
man das Gas weg. Jedes Mal, wenn es ruckte, sahen sie sich kurz, aber
schweigend an. Die Abstände wurden immer kürzer. „Du fährst heute so
stümperhaft. Reiß dich doch mal zusammen!“, schimpfte Jablonski gereizt. Dabei
blickte er kontrollierend zur Tankanzeige, die aber noch über Halbvoll anzeigte.
„Das bin ich nicht“, verteidigte sie sich. „das macht er, seit du daran herumgewerkelt
hast.“
„Blödsinn, ich hab' nur die Kerzen ausgewechselt“, wehrte er ab.
„Vielleicht hast du eine verkehrt herum eingesetzt?“, überlegte Britta laut.
„Verkehrt herum“, wiederholte er spöttisch. „Mensch, lass das bloß keinen
hören.“ Lachend schüttelte er den Kopf. Vom Motor hatte sie wahrlich nicht die
geringste Ahnung. Daher kümmerte er sich um die kleinen Macken ihres
altersschwachen Wagens. Ersatzteile besorgte er sich auf dem Schrottplatz und das
Wissen von einigen Kameraden der Instandsetzung, die vor ihrer Einberufung
schon als Automechaniker tätig waren. Da in der Golz Kaserne auch ein VW
Käfer stationiert war, fiel auch mal für Brittas Wagen etwas ab. Für zwanzig
Vitamintabletten bekam Jablonski ohne Weiteres ein Paar Wischergummis und
für vier elastische Binden vier Zündkerzen. So wusch eine Hand die andere.
Das Rucken wurde schlimmer, der Motor stotterte und spuckte unaufhörlich.
Britta trat unbekümmert das Gaspedal herunter. Jablonski ließ sie anhalten. Mit
leisen Flüchen stieg er aus und ging nach hinten zum Motor.
„Aber du kommst zu spät!“, rief Britta ihm hinterher.
„Die können mich an die Füße fassen!“, schrie er zurück und öffnete die Motorhaube.
Britta blieb sitzen und wartete ungeduldig. Drinnen hörte sie sein
Gemecker und das klappernde Hantieren am Motor. Zwischendurch musste sie
starten, aber ohne Erfolg. Nervös spielte sie am Lenkrad herum und schaute dabei
ständig auf die Uhr. Die Zeit lief zu seinem Nachteil.
„Mach doch zu!“, rief sie ungeduldig, obwohl sie genau wusste, dass alle Eile
nichts mehr brachte. Zu spät kamen sie ohnehin.
„So, starte mal!“, rief Jablonski. Der Motor sprang auf Anhieb an und lief rund
und gleichmäßig. Britta pustete erleichtert auf, und er ging nach vorn, hob den
Kofferdeckel hoch und zog sich einen Lappen heraus. Während er sich die Finger
abwischte, setzte er sich wieder ins Auto. Britta sah erstaunt auf den Lappen, der
sich langsam immer dunkler färbte.
„Sag mal, bist du noch zu retten?“, fragte sie empört und riss ihn jenes Tuch aus
der Hand.
„Das ist mein T-Shirt!“
Jablonski entschuldigte sich kleinlaut, musste aber doch über Brittas Gesichtsausdruck
lachen. Ihre Erregung übertrug sich natürlich auf ihre ganze Fahrweise und
es kostete ihn einige Entschuldigungsbeteuerungen, bis sie sich wieder beruhigte.
Ihre Stimmung blieb trotzdem gereizt und sie sprach, wenn überhaupt, nur das
Nötigste. Daher ließ er das T-Shirt unauffällig hinter dem Sitz verschwinden, um
sie nicht unnötig daran zu erinnern.
Mit einer viertelstündigen Verspätung erreichten sie das Kasernentor.
„Bin gleich wieder da!“, verabschiedete Jablonski sich hastig, schnappte sich sein
Jackenbündel und lief durch das Kasernentor zur Kompanie. Abschätzend
musterte der Wachposten Jablonskis Freundin, die im Wagen sitzen blieb und
wartete. Sie brachte ein wenig Abwechslung in die langweilige Umgebung seines
Postens.