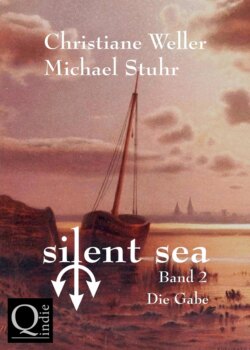Читать книгу DIE GABE - Michael Stuhr - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
06 HERCULE
ОглавлениеIm neuen Jahrtausend war es weltweit schwieriger geworden, sich eine andere, glaubhafte Identität zuzulegen. Das bedeutete aber nur, dass man über die neueste Technologie verfügen musste, um die Behördencomputer zu überlisten. Wie immer und überall ebnete auch hier Geld den Weg, und so war die Familie Montenaux, die in San Francisco ankam, eine andere als die, die aus Marseille abgereist war.
Ein ewiges Problem bei den Darksidern war, dass sie sich jung erhalten konnten, und die meisten von ihnen das auch taten. Diego wusste nicht, wie alt seine Eltern wirklich waren. Sie sprachen von der spanischen Inquisition, als seien sie selbst dabei gewesen, aber sie wirkten wie ein Ehepaar Mitte dreißig. Um vor den normalen Menschen zu verbergen, dass sie nicht alterten, war es immer wieder nötig gewesen, das Land oder sogar den Kontinent zu wechseln, und jetzt war es wieder mal so weit.
Diego war herangewachsen, und langsam wurde es unwahrscheinlich, dass so junge Eltern einen Sohn um die Zwanzig hatten. – Zeit, die Dinge mal wieder ein wenig gerade zu rücken, wie Diegos Vater es ausdrückte; also hatten sie auf hoher See alle alten Ausweispapiere vernichtet. Synchron dazu waren Dutzende von Amtscomputern manipuliert worden, um die Daten der Familie an die neuen Identitäten anzupassen. Aus den neuen Pässen konnte man jetzt herauslesen, dass René Felipe Montenaux aus Bretonville, Kanada, fünfzehn Jahre älter war, als sein Bruder Diego. In Zukunft würde Diego sich also als der Bruder seines Vaters ausgeben müssen, seine Mutter war offiziell zu seiner Schwägerin geworden, und er selbst war nun ein in Montreal geborener Franco-Kanadier. Nun, ja, er würde sich daran gewöhnen.
Als die Manhattan unter Führung eines Lotsen in die San-Fancisco-Bay einlief, war es später Abend. Die Golden-Gate-Bridge war erleuchtet und die Kuppel aus Streulicht über der Stadt schimmerte im Wasser, genau wie die Lichter der Stadt selbst. Langsam steuerte die große Yacht auf den Tiefwasserhafen zu und machte an einem abgelegenen Kai bei dem Montenaux-Containerterminal fest. Der Lotse ging von Bord und wurde von einer Barkasse abgeholt.
Diego entschloss sich, die letzte Nacht an Bord im Salzwasserpool zu verbringen. Die nächsten Tage würden anstrengend werden. Die Prüfungen würden Einiges an Kraft kosten, und es war ungewiss, wann er wieder Zeit finden würde, im Meer zu schwimmen.
Irgendwann mitten in der Nacht drang ein Poltern an Diegos Ohr und er öffnete kurz die Augen. Die Nachtschicht der Hafenarbeiter holte wohl gerade sein Fahrzeug aus dem Frachtdeck. Er schloss die Augen wieder, ließ sich weiter in dem angenehm temperierten Wasser treiben, während sich sein Körper durch die Haut mit den wichtigen Salzen und Nährstoffen aus dem Meer auflud. Er kümmerte sich nicht weiter um das leise Gerumpel, das hin und wieder durch den Schiffskörper bis in den Pool drang. In einem dämmrigen Halbschlaf drifteten seine Gedanken weit in die Vergangenheit zurück:
Die Manhattan war mehr als ein Jahrzehnt lang fast so etwas wie Diegos Gefängnis gewesen, nachdem er als Fünfjähriger das Mädchen aus Versehen getötet hatte. Seine Eltern waren mit ihm auf dieser Yacht um die ganze Erde gereist. Sie hatten versucht, auf diese Weise der Vergangenheit zu entkommen und neues Unheil zu verhindern.
Diego kannte hier jeden Winkel und für lange Zeit waren Erwachsene die einzigen Personen gewesen, mit denen er hatte reden können. Es hatte da einen strengen Privatlehrer namens Ferris gegeben und ab und zu war auch ein Geistlicher aus Diegos Volk an Bord gekommen und hatte mit ihm über die Alte Schuld gesprochen, die der Junge seiner Ansicht nach viel zu früh auf sich geladen hatte.
Das alles war aber verblasst durch Diegos eigene Erinnerung an den unseligen Nachmittag, an dem das Mädchen in seinen Armen gestorben war. Immer wieder war die Kleine in seinen Träumen aufgetaucht. Diego hatte sich als Verlorenen gesehen, der es nie wieder wagen konnte, einen Menschen innig zu berühren. Dieses Gefühl hatte bis jetzt immer im Vordergrund gestanden. Mehr als einmal hatte er mit dem Schicksal gespielt und sein Leben mutwillig aufs Spiel gesetzt, bis er eines Tages in einem Strandlokal Lana gesehen hatte.
Von diesem Tag an war alles anders geworden. Er hatte es gewagt, Lana anzusprechen, und sie war der Inbegriff von allem, was Diego sich wünschte. Alles hätte gut werden können, aber dann hatte Dolores, seine Cousine, sich nicht beherrschen können und Lanas Freundin so viel Lebenskraft genommen, dass sie über Nacht zu einer verwirrten, alten Frau geworden war.
Lana hatte die Sache aufklären wollen, und er hatte ihr gestehen müssen, dass er in gewisser Weise darin verwickelt war. Sie hatten sich gestritten und er hatte dafür gesorgt, dass Dolores für dreißig Jahre nach Sweetwater, in das Gefängnis der Darksider, geschickt worden war.
Lana hatte das alles verstanden. Sie wusste, dass er einer anderen Rasse angehörte, dass sein Volk nach eigenen Regeln lebte, und sie hatte das akzeptiert. – Und nun waren sie wieder getrennt. Sie lebte in Paris, tief im Binnenland, mitten in Europa, und er würde sich für die nächsten Jahre an der Westküste Nordamerikas aufhalten müssen.
Diego wollte daran glauben, dass sie auf ihn warten würde. Er wünschte es sich so sehr, aber wenn er die Sache richtig überdachte, war es nahezu hoffnungslos.
Um die Mittagszeit saß Diego allein auf dem Oberdeck, las ein wenig in einem amerikanischen Magazin und genoss die Sonne. Er sah kurz auf, als sein Porsche mit dem typisch heiseren Motorgeräusch aus der Stadt zurückkam. Einer der Angestellten des Containerterminals war mit dem Wagen bei der Umweltschutzprüfung und auf der Zulassungsstelle gewesen. Alles war problemlos gelaufen und die brandneuen, kalifornischen Nummernschilder funkelten in der Mittagssonne.
„Schönes Auto!“, sagte der Mann, nachdem er an Bord gekommen war und Diego die Schlüssel überreicht hatte. Offensichtlich hatte der Job ihm Spaß gemacht.
Diego bedankte sich und machte sich bereit, die Manhattan zu verlassen. Zwei Reisetaschen und sein Laptop, das war alles, was er brauchte. Die Fachbücher würde ihm ein Kurierdienst direkt nach Berkeley bringen. Diego hatte einfach keine Lust, die etwa fünfzig Kilo schwere Kiste in seinen Porsche zu wuchten. Sie hätte auch gar nicht in den Kofferraum gepasst. Das ging per Lieferwagen nun wirklich besser.
Er verabschiedete sich mit einer kurzen Umarmung von seinen Eltern, oder besser: von Bruder und Schwägerin, und verließ die Manhattan, die schon am Abend wieder in Richtung New York auslaufen würde.
„D43M0N“ leuchtete es Diego dunkelblau vom weißen Nummernschild entgegen. Da hatte der Angestellte ihm offenbar ohne besonderen Auftrag ein Namensnummernschild besorgt. Die Buchstabenkombination sollte wohl für Diego Montenaux stehen, erinnerte ihn aber viel eher an das Wort „DAEMON“. – Irgendwie erwischt einen das Schicksal doch immer, und wenn es bloß mit solchen Nebensächlichkeiten ist.
Der neue Pass tat seinen Dienst und weder die Einwanderungsbehörde noch der Zoll machten Schwierigkeiten. Die Hackerzentrale der Darksider hatte mal wieder ganze Arbeit geleistet und Diegos neue Identität hielt natürlich jeder Überprüfung stand. Keine zehn Minuten nachdem er den Porsche vor dem Bürogebäude gestoppt hatte, konnte er schon weiterfahren.
San Francisco hatte auf Diego schon immer den Eindruck eines versteinerten Meeres mit mächtigen Wogen gemacht. Er verzichtete darauf, auf den nächsten Freeway einzubiegen und fuhr nur so zum Spaß ein wenig durch die Stadt. Tief schnitten sich die Straßen ihren Weg durch die Häuserschluchten. Schnurgerade zogen sie sich steile Hügel hinauf. Sie schienen direkt in den Himmel zu führen, um dann unvermittelt so plötzlich in das nächste Tal abzukippen, dass Diego unwillkürlich das Lenkrad fester umfasste. Das waren die Kreuzungen, wo leichtsinnige Fahrer, die nicht auf die Schilder achteten, mit ihren Stretchlimousinen und Reisebussen schon mal auf dem Asphalt aufsetzten. Hier mussten fast täglich Fahrzeuge freigeschleppt werden, weil die Räder den Bodenkontakt verloren hatten.
Die Gegend wurde flacher. Trotz der Nacht im Pool fühlte Diego sich ein wenig abgespannt. An einer günstigen Stelle stoppte er vor einem Starbucks und gönnte sich einen Kaffee und eine kleine Flasche Wasser. Das würde reichen, ihn bis zum Abend fit zu halten.
Zeit, in Richtung Wohnheim aufzubrechen. In dieser Gegend war Diego noch nie gewesen. Er hatte sich eindeutig verfahren, aber die Atmosphäre der Stadt gefiel ihm, und er hielt es nicht für nötig, das Navi zu aktivieren. Irgendwann erreichte er wieder bekanntes Gelände. Hier in der 14th Street gab es irgendwo eine Frachtagentur, mit der sein Vater zusammenarbeitete.
Er bog in die Mission-Street ein und suchte ein Hinweisschild, das in Richtung Bolinas wies, wo das Wohnheim lag. Nun wurde es doch Zeit, sich vom Navigationsgerät helfen zu lassen. Diego benutzte die Spracheingabe und nannte die Adresse des Wohnheims. Danach rief er bei der Hausverwaltung an, damit jemand mit dem Zimmerschlüssel dorthin kam, um ihn einzuweisen. Vierzig Minuten später war er da.
Das altehrwürdige Wohnheim lag in der Nähe des Stinson Beach innerhalb eines großen Areals. Schon vor Generationen hatten die Darksider hier etliche Hektar Land direkt an der Küste gekauft und nach und nach bebaut. Das Gelände wirkte wie eine gut gepflegte Ansammlung von Vorstadtvillen und Luxusapartmenthäusern. Auch die Fahrzeuge der Bewohner ließen erahnen, dass es nicht gerade die ärmsten Leute waren, die hier wohnten. Die zentrale Poststelle und die Entsorgungseinrichtungen an der Zufahrt des Geländes deuteten darauf hin, dass selbst Briefträger und Müllmänner keinen Zugang zu den Wohnhäusern hatten.
Auf einen Zaun um das Gelände herum hatte man verzichtet. Nur ein großes Schild an der Zufahrtsstraße wies unübersehbar in mehreren Sprachen darauf hin, dass alle Besucher sich zuerst in der Poststelle zu melden hatten.
Diego fühlte sich nicht als Besucher, und die Schranke war oben, also fuhr er unbehelligt auf das Gelände und parkte den Porsche direkt am Wohnheim neben einem Maserati-Cabrio. Er verzichtete darauf das Verdeck des Wagens zu schließen, nahm sein Gepäck und ging auf den Haupteingang zu. Nach knapp zwanzig Schritten stoppte der Van eines privaten Wachdienstes neben ihm. „Leichte Jagd, Sir“, sprach der Beifahrer ihn mit dem Gruß der Darksider an.
Diego blieb stehen. „Langes Leben! Ich wohne hier“, sagte er. „Erstsemester, äh - Freshman.“
„Willkommen in Berkeley, Sir.“ Der Beifahrer stieg aus. „Dürfte ich Ihre Papiere sehen?“
„Sicher.“ Diego stellte die Taschen ab und reichte dem Mann seinen Pass und die Bestätigung der Hausverwaltung für Zimmer 512 zum heutigen Tag.
„Danke, Sir.“ Der Mann kletterte wieder auf den Beifahrersitz und glich die Daten auf einem Notebook ab, das auf dem Armaturenbrett angebracht war. Er brauchte dafür nur wenige Sekunden, da er bloß die Barcodes auf den Dokumenten auslesen musste.
„Alles in Ordnung Sir.“ Der Mann reichte Diego seine Papiere zurück. „Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Aufenthalt.“
„Danke.“ Diego nahm die Taschen wieder auf und ging ins Haus.
Die Verwaltung hatte zur Schlüsselübergabe eine dunkelhaarige junge Frau geschickt, die in der Eingangshalle auf ihn wartete. Ohne jeden Zweifel eine Darksiderin. Sie trug eine Kennkarte an ihrer Kostümjacke und verzichtete darauf, seine Papiere zu prüfen, als er sich mit kurzen Worten vorstellte. Wahrscheinlich hatte sie durch die Glastüren hindurch gesehen, dass der Mann von der Security das schon erledigt hatte. „Leichte Jagd!“, grüßte sie.
„Langes Leben!“, wünschte Diego mit einem unverbindlichen Lächeln.
„Ich bin Alicia Moss von der Hausverwaltung. Willkommen in Berkeley. Das Beste wird sein, wenn wir zunächst zu deinem Zimmer gehen, damit du das Gepäck abstellen kannst.“
„Gerne.“ Diego folgte ihr zu den Aufzügen. „Ist mein Mitbewohner eigentlich schon da?“
„Oh, ich fürchte, das weiß ich nicht“, sagte Alicia mit einem bezaubernden Lächeln, „aber ich könnte nachfragen.“ Sie griff nach ihrem Handy.
„Nicht nötig, danke“, wehrte Diego ab. In spätestens zwei Minuten würde er ja sowieso wissen, ob Hercule den Weg hierher auch schon gefunden hatte.
Hatte er nicht, also konnte sich Diego ganz in Ruhe die Einrichtungen des Hauses zeigen lassen und seine Seite des Zimmers einräumen. Gerade schloss er das Stromkabel seines Notebooks an, als es vor der Tür rumorte. Schabende und schleifende Geräusche drangen durch das Holz, gefolgt von einem Poltern und einem leisen Fluch. Statt anzuklopfen trat jemand von außen gegen die Tür. Den Geräuschen nach musste das die Lieferung mit der schweren Bücherkiste sein. Diego ging eilig zur Tür und öffnete sie.
„Hallo, Diego!“ Es war Hercule, der sich gleich drei prallvolle Reisetaschen umgehängt hatte. Auf dem Weg hierher waren die Gurte ihm allerdings von den Schultern gerutscht, hingen jetzt in den Armbeugen und behinderten ihn bis zur Bewegungslosigkeit. Ändern konnte er daran nichts, denn vor sich trug er einen Flachbildschirm von enormen Ausmaßen, auf dessen Sichtfläche alles mögliche Zeug gestapelt war. Diego erkannte eine Notebook-Tasche, eine X-Box mit den nötigen Controllern und DVDs, eine Mini-Stereoanlage mit Lautsprecherboxen und einige unidentifizierbare Geräte, die aber bestimmt alle auch gewaltig viel Krach machen konnten. Ganz obenauf thronte ein Plastik-Totenschädel mit einem Elektrokabel daran.
„Mein Nachtlicht“, erklärte Hercule, der Diegos Blick bemerkt hatte. „Der leuchtet. Klasse, was? Ich kann im Dunklen doch nicht schlafen. Er kann auch singen. Drei Lieder. Zeig ich dir. Ich schließ ihn gleich an.“
„Hallo, Hercule.“ Diego spähte in den Flur. „Ist niemand von der Hausverwaltung da?“
„Nein.“ Hercule schüttelte den Kopf. „Dieser Hausmeistertyp ist mit dem Taxifahrer gleich zurück zum Tor. Ich hab gehört, dass du schon da bist, da hab ich dem gesagt, dass du mir alles hier zeigst.“
„Ah, ja. Na, komm rein.“ Diego trat zur Seite. „Soll ich dir was abnehmen?“
„Nicht nötig!“, wehrte Hercule ab. „Ich hab’s im Griff.“ Ungestüm drängte er voran und prompt verkantete sich der Bildschirm im Türrahmen. Der bekam einen gehörigen Kratzer, was Hercule aber nicht weiter störte. Mit noch ein wenig mehr Druck ging es dann doch. Lacksplitter rieselten zu Boden und Hercule war im Zimmer. Allerdings verhakte er sich mit dem Tragegurt einer weit abstehenden Tasche am Türknauf und wäre durch die plötzliche Bremsung fast gestürzt. Statt nun aber einen Schritt zurückzugehen, um die Spannung aus dem Gurt zu nehmen, trampelte er hilflos auf der Stelle, bis Diego ihn befreite.
„Welche Seite ist meine?“ Hercule schwankte gefährlich unter seiner Last.
„Du schläfst links“
„Okay!“ Hercule steuerte nach rechts und baute sich vor dem Bett auf, das dort stand.
„Nein, nein, da schlafe ich“, protestierte Diego.
„Ich weiß“, strahlte Hercule ihn an, und ließ den Stapel von seinen Armen auf die Bettdecke rutschen. „Aber ich muss doch noch einräumen. Da kann ich doch nicht meine eigene Seite blockieren. Da wär’ ich ja blöd!“ Schwungvoll klatschte er die erste seiner drei Umhängetaschen zu dem übrigen Zeug auf Diegos Bett.
„Pass auf, Hercule!“ Diego hielt ihn am Arm fest und schaute ihn ernst an. „Wenn du das hier überleben willst, dann musst du lernen, zuzuhören. Also pass auf: Dein Bett steht links, also steht auch dein Schrank links, genau wie dein Schreibtisch und dein Stuhl. Und dieser Müllhaufen auf meinem Bett verschwindet jetzt auch nach links, und zwar zügig, sonst fliegt das Zeug im hohen Bogen runter!“
„Nach links“, vermutete Hercule mit eingezogenem Kopf.
„Auf deine Seite!“, bestätigte Diego. „Denn das hier ist die rechte Seite - meine Seite, kapiert?“
„Jetzt sei doch nicht gleich so“, maulte Hercule, ging aber mit den restlichen beiden Taschen auf seine Seite des Zimmers, stellte sie dort auf den Boden und begann Diegos Bett abzuräumen. Zuletzt nahm er den Totenkopf, schloss ihn an eine Steckdose an und stellte ihn am Kopfende seines Betts auf die Fensterbank. Es war noch zu hell im Zimmer, sodass der Effekt nicht richtig zur Wirkung kam; das Teil sah aber so schon abscheulich genug aus.
„Jetzt pass auf!“ Hercule schlug dem trübe glimmenden Ding auf die Schädeldecke, das sofort anfing mit knarzender Stimme Somwhere over the rainbow zu plärren. Der Kiefer öffnete und schloss sich im Takt und untermalte die Vorstellung mit knackenden Geräuschen.
„Götter der Tiefsee!“, fluchte Diego. „Stell das ab!“
„Geht nicht“, grinste Hercule. „Der singt immer zu Ende, aber ich kann den Song wechseln.“ Wieder ließ er seine Hand auf den Schädel klatschen, der sofort zu Always look on the bright side of live wechselte.
Blitzschnell war Diego bei Hercules Bett und zog den Stecker aus der Wand. Sofort brach das Lied ab und der Kiefer des Plastikschädels blieb weit geöffnet stehen, was dem Ding ein erstauntes Aussehen verlieh.
„Aber du hast das dritte Lied doch noch gar nicht gehört“, protestierte Hercule.
„Später!“ Es war Diego völlig klar, dass er es in allzu naher Zukunft wirklich hören würde. Das war unvermeidlich und im Moment tat es ihm mächtig Leid, dass er seinen Eltern das Versprechen gegeben hatte, sich um Hercule zu kümmern.
Etwas beleidigt stöpselte Hercule den Stecker wieder ein, verzichtete aber darauf, Diego das dritte Lied sofort vorzuspielen. Stattdessen legte er sich auf sein Bett, verschränkte die Hände im Nacken und schloss die Augen.
Als Diego ein paar Minuten lang nichts von ihm hörte, begann er zu hoffen, dass sein ungeliebter Zimmergenosse eingeschlafen sei. Leise setzte er sich vor sein Notebook und versuchte ein wenig zu arbeiten, als es schon wieder an der Tür klopfte.
Mit einem Seufzer stand Diego auf und öffnete. Diesmal war es wirklich der Kurier mit den Büchern. Hinter ihm stand ein Mann von der Security. Der Kurier rollte die Kiste mit einem kleinen Transportwägelchen in das Zimmer und stellte sie mit einem deutlichen Schnaufer der Erleichterung auf den Boden.
„Steht sie auch weit genug auf der rechten Seite?“, ließ Hercule sich von seinem Bett aus hören.
Diego drückte dem Mann eine Fünfdollarnote in die Hand, bedankte sich und begann, die Kiste zu öffnen.
„Was haste da? Was ist das?“ Sofort nachdem der Fremde zusammen mit dem Sicherheitsmann gegangen war, sprang Hercule auf und stellte sich neben Diego, der betont langsam den Deckel öffnete.
„Och, Bücher!“ Hercule war enttäuscht.
„Ja, Bücher!“, bestätigte Diego. „Wo sind deine eigentlich?“
„Hab keine. Erst mal abwarten. Die sagen mir schon was ich brauche, dann hol ich’s mir. Außerdem hast du ja jede Menge von dem Zeug dabei. Kann ich mir ja leihen.“
„Äh, du machst Philosophie und ich Medizin.“
„Na und?“, meinte Hercule. „Wird schon irgendwas dabei sein. Buch ist Buch!“
„Das ist jetzt nicht dein Ernst, oder?“ Diego war sich nicht ganz sicher.
„Spaß muss sein, sonst kommt keiner zur Hinrichtung!“, grinste Hercule. „Verstehste?“
Diego verstand nicht und wandte sich mit einem leichten Kopfschütteln wieder seiner Bücherkiste zu.
„Bäh, immer noch der alte Stockfisch!“, beschwerte Hercule sich. „Das war ´n Spaß, Mann. Jetzt lach doch mal. Mach dich locker, Mann!“
Als Diego nicht reagierte und weiter in der Kiste herumkramte, hob Hercule kurz die Schultern und wechselte das Thema: „Übermorgen hole ich mir übrigens meine Desert Eagle ab“, trompetete er los. „Hab ich mir heute bestellt. Sofort mitnehmen ging nicht. Zweiundsiebzig Stunden Wartezeit.“
„Desert Eagle, was ist das? Ein Geländemotorrad?“ Diego stellte den ersten Packen Bücher in sein Regal.
„Quatsch!“, lachte Hercule. „Das ist ne .45er. Soo ne Wumme!“ Mit den Händen zeigte er eine Länge von knapp einem halben Meter an. „Damit kannst du durch Ziegelwände schießen.“
Diego drehte sich zu ihm hin, und die noch nicht abgestützte Bücherreihe fiel mit einem leisen Klatschen um. „Du hast dir eine Pistole gekauft?“
„Sofort nach dem Abschiedsküsschen von meiner Mutter. Das ist schließlich ein freies Land hier – nicht so langweilig wie Frankreich – und immerhin bin ich seit Neuestem Amerikaner. Da habe ich das Recht ...“
„Das glaub ich jetzt nicht. Was willst du mit dem Ding?“
„Nur so.“ Hercule hob die Schultern. „Man weiß ja nie. Besser man hat eine und braucht sie nicht, als man braucht eine und hat sie nicht.“
„Ah, ja.“ Diego wandte sich wieder seinen Bücherstapeln zu.
„Da gibt es so einen Schießclub draußen vor der Stadt. Der Verkäufer im Waffenladen hat gesagt ich wär willkommen“, redete Hercule weiter. „Da kannst du rumballern, solange du willst. Klasse, was?“
„Ah, ja.“ Schießplatz hörte sich gut an, aber vor seinem inneren Auge sah Diego trotzdem seinen Zimmergenossen mitten in der Nacht im Bett mit der geladenen Pistole herumspielen, während der erleuchtete Totenschädel dazu sang.