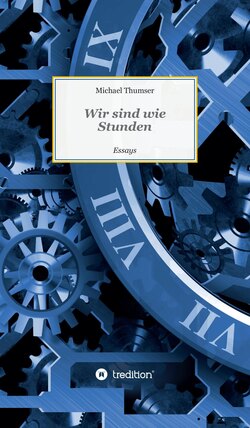Читать книгу Wir sind wie Stunden - Michael Thumser - Страница 11
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеDas Phantom, Ruhm genannt
Zwischen Grazien und Grenadieren: König Friedrich II. von Preußen
1
Viel lesen wollte er in Rheinsberg, schreiben wollte er und Flöte spielen. Für den Königssohn war die Jugend traumatisierend hart verlaufen. Dann, als Ehemann und designierter Herrscher, durfte der preußische Kronprinz Friedrich auf dem Schloss, zwanzig Kilometer nördlich des brandenburgischen Neuruppin gelegen, wirklich ein paar glücklichere Jahre verleben: ein Wartestand voller Lektüre, Musik … und durchgeistigt vom regen Briefverkehr mit François Marie Arouet alias Voltaire, dem lichtvollen Franzosen. Jenem Philosophen (der später, im „sorgenfreien“ Schloss Sanssouci bei Potsdam, langjährig Gast des royalen Freundes sein sollte) übersandte Friedrich seinen ANTIMACHIAVELL, ein Essay, das Voltaire redigierte und publizierte. Darin beschrieb der Prinz die Person des Regenten zwar als absoluten Herrscher, doch zugleich als Freund der Untertanen, als Förderer der Wissenschaft und Kunst, als Wahrer von Rechtsstaatlichkeit und Frieden. Als Friedrich selber 1740 König wurde, verfuhr er denn auch nach jenem Ideal. Ein paar Wochen lang.
Denn mit all dem wars vorbei, als in Wien Kaiser Karl VI. starb und seine Tochter Maria Theresia sich bereit machte, seinen Thron zu erben. Da kitzelte den Preußen dann doch die Streitlust, der Ehrgeiz des Eroberers. Ausersehen sah er sich, das bislang parvenühaft aufstrebende Preußen der Hohenzollern neben dem ein wenig müden, alt-blasierten Österreich der Habsburger als Spitzenkraft zu etablieren im Mächtekonzert des Heiligen Römischen Reichs.
2
Zum entscheidenden Feldzug wurde der Siebenjährige Krieg, der auch „dritter Schlesischer Krieg“ heißt; was impliziert, dass zwei ähnliche ihm vorausgegangen waren. Kürzer fielen sie aus, weniger blutig, für den König bei weitem nicht so schicksalhaft. Zwei Mal hatte er Maria Theresia überrollt: Gleich 1740 marschierte Friedrich erstmals in ihrem Schlesien ein – das Heer des Vaters hatte er, noch als Pazifist, schon mal um 10 000 Mann verstärkt. Zum zweiten Mal kämpfte er 1744/45 um die Provinz, um den bedrohten Raub zu sichern. Dann schien er satt.
Andernorts indes eskalierte ein weltumspannender Streitfall: Als Kolonialherren standen England und Frankreich einander in Nordamerika und Indien gegenüber. In Österreich ernannte Maria Theresia den Diplomaten Wenzel Anton Graf Kaunitz zum Außenminister: Die beiden vereinte der Hass auf Preußen, die Begier, Schlesien wiederzugewinnen, die Überzeugung, dass der neu entstandene fatale Dualismus entschieden werden müsse, und zwar für Wien.
Bald kreiste und schnürte ein Bündnis die Preußen ein: Zur „Großen Koalition“ hatten Österreich und Russland, Frankreich und Sachsen sich verbündet. Friedrich entschloss sich zum präventiven Erstschlag. Am 29. August 1756 fiel er ins Königreich Sachsen ein. Doch rasch wendete sich die Lage gegen ihn. Dem Anti-Preußen-Pakt trat Schweden bei, und das Reich beschloss den Reichskrieg gegen Friedrich. Zunehmend isoliert und defensiv, verbuchte er immer weniger Erfolge. Hatten seine Heere 1757 bei Leuthen in Schlesien den strahlendsten Sieg ihres Feldherrn erfochten, so markierte das Gemetzel bei Kunersdorf (nahe Frankfurt an der Oder) zwei Jahre später den Tiefpunkt – ein Totalzusammenbruch, der den längst maladen Monarchen hoffen ließ, ihn selber möge eine der „verwünschten Kugeln“ treffen. „Er trug Gift bei sich“, berichtet Thomas Mann, „für den äußersten Fall".
Doch aufs Debakel folgte das Mirakel: Wie ein Wunder half dem am Boden Zerstörten der Tod der russischen Zarin und Erzfeindin Elisabeth auf. Ihr nämlich folgte Peter III. nach, ein glühender Parteigänger des Preußen, der sich mit ihm sogleich auf einen Waffenstillstand einigte – Anlass für eine allgemeine Versöhnungsbereitschaft der samt und sonders ermatteten Kombattanten. Neben manch anderem legte der 1763 geschlossene Frieden von Hubertusburg fest, dass Schlesien bei Preußen blieb; zusätzlich heimste es 1772, bei der Ersten Polnischen Teilung, Westpreußen und weitere Territorien ein. Fortan firmierte das Königreich als Großmacht in Europa – und stand zu Österreich in unausgleichbarer Gegenposition. In Übersee und Indien erstarkte England zur Führungskraft und schickte sich an, Weltreich und -macht zu sein, auf Kosten Frankreichs: Das war ruiniert.
Und blieb es freilich nicht für immer. 1806 sollte der übermächtige Franzose Napoleon Bonaparte Preußen unter seine Stiefel treten. Doch bevor er die Hauptstadt betrat, hielt er in Potsdam. Denn nicht dem gegenwärtigen König Friedrich Wilhelm III. wünschte der Kaiser seine Aufwartung zu machen, sondern dessen totem Großonkel: Friedrich II., „der Große“, ruhte dort, übrigens gegen seinen Willen, in der Garnisonskirche. Zwanzig Jahre vor dem hohen Besuch war der „Alte Fritz“ am 17. August 1786, 74-jährig, auf Schloss Sanssouci verblichen. Vor dem Sarkophag soll Napoleon andächtig geäußert haben, er selber stünde nicht hier, würde Friedrich noch leben.
Für einen Großen hielt jener Bezwinger Europas sich selbst, nicht anders als der Protagonist einer mindestens ebenso zwielichtigen, dabei weitaus pompöseren Visite. Am 21. März 1933 trat Adolf Hitler im selben Gotteshaus auf, um sich am „Tag von Potsdam“ leibhaftig und mehr noch ideell neben dem verewigten Monarchen zu postieren. Hatte der sein Preußen zur europäischen Großmacht erhoben, so dachte der Diktator, die „Macht ergreifend“, über die halbe Welt zu herrschen.
3
Friedrich der Große war ein kleiner Mann, höchstens 1,60 Meter hoch, von zähem, doch eher dürftigem Bau. Auserwählt fühlte er sich dennoch, „das Große zu erniedrigen“, womit er das im Römisch-Deutschen Reich vorherrschende Habsburg meinte. Bevor er „groß“ wurde, drohte er mehrfach von entschlossenen Feinden bezwungen zu werden – ein Draufgänger, bei dessen Triumph das Glück kräftig nachhelfen musste. Vielleicht darum blieb er, was ihn selber betraf, vergleichsweise bescheiden. „Als Philosoph“, verfügte er, wolle er begraben werden, „ohne die geringsten Zeremonien, nachts, im kleinsten Gefolge, beim Schein einer Laterne.“
Friedrich war ein weiches Kind. „Recht fett und frisch“ kam er am 24. Januar 1712 im Berliner Stadtschloss zur Welt, als Sohn eines „Soldatenkönigs“: Der, Friedrich Wilhelm I., führte zwar nur ein Mal und nur kurz Krieg, frönte aber allem Militärischen bis zur Besessenheit. Dem sachten Knaben suchte er jeden Sinn fürs zweckfrei Schöne, die Lust an Dicht- und Tonkunst, auch die enge Bindung an die Schwester Wilhelmine, die spätere Markgräfin von Bayreuth, gründlich auszutreiben. Aufs Grausamste kujonierte er ihn darum und unterließ es nicht einmal, den Thronfolger vor Zeugen prügelnd zu demütigen. Ein Fluchtversuch missriet dem 18-Jährigen – das kostete ihn selbst beinah das Leben und seinen Freund und Helfer Hans Hermann von Katte den Kopf. Bei der Exekution hatte Friedrich von einem Fenster aus genauestens zuzusehen.
Endlich zu Kreuze kriechend, ließ sich Friedrich vom unerbittlichen Über-Vater eine Gemahlin verordnen: Mit jener Elisabeth Christine von Braunschweig-Wolfenbüttel-Bevern, um drei Jahre jünger als er und von ihm 1733 ohne Zuneigung geehelicht, verband ihn sein Leben lang nicht das Mindeste; wahrscheinlich war er, mehr oder weniger aktiv, homosexuell. Weitaus intensiveren Umgang als mit der Gemahlin pflegte er mit seinen Hunden. Immerhin betrachtete er die paar Rheinsberger Musenjahre an der Seite Elisabeths als seine schönste Zeit: voll von Poesie und Philosophie, Musik und wacher Plauderei.
Schon den Kronprinzen umschwärmte eine Aristokratin als „le grand Frédéric“. Und Voltaire, lebendes Monument der französischen Aufklärung, erkannte in „Frédéric le Grand“ einen „fürstlichen Philosophen“, umrahmt von „Grazien und Grenadieren“. Mit den Siegesfeiern nach dem zweiten der Schlesischen Kriege setzte sich sein Ehrentitel „der Große“ vollends durch. In offiziellen Urkunden allerdings erscheint er nie.
4
Friedrich war ein harter Mann. Unerwartet stark prägte ihn, der sich zunächst als Pazifist bekannte, das Erbgut des brutalen Erzeugers. Eingestandenermaßen stachelte den Geltungssüchtigen die Begierde an, vor der Mit- und Nachwelt zu glänzen: Ihn packte „die Glut der Leidenschaft, der Ruhmesdurst“. Im Blutbad scheute er kein Risiko. Als Hasardeur war er menschenverachtend bereit, auch auf eine schwache Karte alles zu setzen. „Racker, wollt ihr denn ewig leben?“, soll er einmal seinen fliehenden Kriegern nachgeschrien haben. Nachweislich bis zu 400 000 Soldaten und Zivilisten opferte er dem „Phantom, Ruhm genannt“.
„Gott ist immer mit den stärksten Bataillonen“, glaubte Friedrich, der aufgeklärt absolutistisch, mithin von Gottes Gnaden regierte, wiewohl er sich um den Himmel und dessen Herrn sonst wenig scherte. Dennoch galt gerade für ihn die Weisheit des biblischen Predigers Salomo, wonach „ein jedes seine Zeit“ habe: „Krieg hat seine Zeit, und Frieden hat seine Zeit.“ Bis zur Nüchternheit unfromm, verordnete er doch, dass in Preußen keine Religion „der anderen Abbruch tue, denn hier muss ein jeder nach seiner Façon selig werden“. Neben solche geistliche Toleranz stellte er eine publizistische: „Gazetten dürfen, so sie delektieren [unterhalten] sollen, nicht genieret [unter Druck gesetzt] werden“ - womit er die Pressezensur wenigstens zeitweilig lockerte. Schulwesen, Verwaltung und Justiz reformierte er gründlich und verbot die Folter, allerdings per Geheimbefehl: Paradoxerweise durfte sie den angstvollen Beschuldigten weiter angedroht werden.
Der Friedensbrecher als Friedensfürst – als „erster Diener des Staates“: Mit jener Formel beschrieb er selbst seine Rolle. Indem er Sumpfgebiete an Oder und Warthe, Netze und Dosse trockenlegen ließ, eroberte Friedrich „im Frieden eine neue Provinz, ohne einen Mann zu verlieren“. Für 60 000 Siedler entstanden neunhundert Dörfer. Um sie zu ernähren, förderte er den Anbau einer noch wenig verbreiteten, indes nahrhaften Knollenpflanze: Friedrich, der Kartoffelkönig.
Und: Friedrich, der Feingeist. Oder: Friedrich, der Banause? So lange seine Zähne hielten, pflegte er, neben dem Spiel mit den Hunden, das Spiel auf der Flöte. Letzteres hatte dem – auch in der Komposition – begabten Kronprinzen der als Bläser begnadete Johann Joachim Quantz beigebracht, den Friedrich 1741 mit der Stelle seines Hofkomponisten bestallte; als Einziger durfte er es sich erlauben, seinen Gebieter beim Musizieren zurechtzuweisen. Mit hellen Köpfen tauschte Friedrich sich aus, mit Voltaire zumal – bevor er ihn abschätzig wie den „Spaßmacher eines großen Herrn“ verabschiedete; nicht ohne Grund: Zuträger hatten den König wissen lassen, der funkensprühende Denker habe erklärt, er wolle den Gönner wie eine Zitrone auspressen und die trockene Schale auf den Müll werfen; überdies wäre Friedrichs eigene literarische Produktion nicht mehr wert als schmutzige Wäsche, wenn er, Voltaire, sich nicht der Mühe unterzöge, sie reinzuwaschen. Geister, nicht Menschen sammelte der König um sich; Frauen, die ihm angetraute zuallererst, waren ihm egal. Auch galt ihm, der beharrlich französisch parlierte, alles Deutsche wenig: Einheimische Dichtung verhöhnte er, das Genie Johann Sebastian Bachs, der sich ihm vorstellte, übersah er ganz.
Dabei lässt sich ihm Geschmack nicht absprechen. Dem feinen Berlin schenkte er ein Opernhaus. Und im leichten, lebens- und liebenswerten Schloss Sanssouci zu Potsdam spiegelte er, unterstützt vom Baumeister Georg von Knobelsdorff und, nach dessen verärgertem Rückzug, von Johann Boumann, die angenehmen Seiten seines janusköpfigen Charakters. Bei allem Hochkomfort dachte er sich hier, über einer weinbergartigen Terrassenanlage, ein prunkloses Privatissimum im Rokokostil als Rückzugsort einzurichten. Die fünf Räume des Ostflügels mit Bibliothek und Musikzimmer bewohnte er selbst; der dazu symmetrische Westtrakt diente Besuchern zur feudalen Unterkunft. Die Königin übrigens weilte hier nur ein einziges Mal als Gast und war nicht einmal zur Einweihung 1747 geladen worden. In der Gruft, die Friedrich sich vorausschauend vor den Fenstern seines Arbeitszimmers graben ließ, wollte er dereinst, wie er sagte, sans souci ausruhen, ohne Sorge. Jenem Diktum verdankt das „Lusthaus auf dem Weinberg“ seinen bis heute gültigen Namen.
Das Neue Palais hingegen, im selben Park protzend, hat mit Friedrichs Wesen nichts zu tun. In seiner stattlichen Kühle steht es resolut als Residenz da. Als „Fanfaronade“, pure Angeberei, galt das dreiflügelige, überkuppelte Prestigebauwerk aus Back- und Sandstein dem König selbst. Er liebte es nicht; am ehesten als Symbol ließ er die – gleichfalls von Knobelsdorff unter seiner eigenen maßgeblichen Mitwirkung entworfene – Repräsentationsarchitektur mit ihren über 200 kostspielig ausgestatteten Räumen gelten: Nach dem verlustreichen und auszehrenden Siebenjährigen Krieg sollte es aufzeigen, dass mehr als eine Beinahekatastrophe nötig sei, um Preußen das Genick zu brechen.
5
Zum „alten Fritz“ war Friedrich schon mit 51 Jahren ergraut: Eingeschrumpft, vertrocknet, krumm und schmuddelig hatten seine drei Schlesischen Kriege, erst recht der letzte, ihn zurückgelassen. Davon wollte die Nachwelt nicht viel wissen. Im 19. Jahrhundert setzten sich, besonders durch die eleganten Malereien und Grafiken Adolph von Menzels, gemütvollvolkstümliche Erinnerungen durch; und mehr noch eine heroisierende Überhöhung. Fürs zweite deutsche Kaiserreich legten Militär- und Historienmaler wie Wilhelm Camphausen und Georg Schöbel die Friedrich-Ikonografie maßgeblich fest: Der König als Held, scharfe Weitsicht in den hellwachen Zügen – so entwarfen sie Andachtsbilder, denen sie trutzige Losungen beigaben: „Ich, vom Schiffbruch rings umdroht, / Trotzen muss ich dem Verderben, / Muss als König denken, leben, sterben.“
Doch nicht erst jene nachgeborene Nationalprophetie, sondern schon er selbst hat begründet, was dem Namen Preußen heute seinen problematischen Klang verleiht: Vormachtstreben und Bereitschaft zu rücksichtsloser Besitzstandswahrung und -vermehrung; den Primat des Militärs und seiner Tugenden; die Feier der Ordnung als Unterordnung, des Dienstes als duldenden Gehorsam. Er selbst, der Frei- und Feingeist von einst, hielt sich während der zweiten, freudlosfleißigen Hälfte seiner Regentschaft daran. Indem er die Waffen ruhen ließ, schien der Ex-Kriegsherr verspätet das Friedensideal wahr machen zu wollen, das der Ex-Vertraute Voltaire vom guten König entwarf: „Ich nenne“, bekundete der, „große Männer alle, die sich durch Nützliches oder Angenehmes ausgezeichnet haben. Die Verwüster von Provinzen sind nur Helden.“
Die anspruchslose letzte Ruhestätte, die Friedrich sich ausgebeten hatte, wurde ihm 205 Jahre nach seinem Tod zuteil. Seinen Sarg, den es auf die hohenzollernsche Stammburg nach Hechingen verschlagen hatte, holte einer nach Sanssouci zurück, dem manche Beschreiber der jüngsten Geschichte gleichfalls „Größe“ zusprechen wollen: Helmut Kohl, der „Kanzler der Einheit“, veranlasste Friedrichs Umbettung immerhin halbwegs im Sinn des Königs. Zwar ließ das Staatsbegräbnis am 17. August 1991 mit seinem militärischen und medialen Aufwand nichts erkennen von „kleinstem Gefolge“ und dem „Schein einer Laterne“; doch liegt der König seither unter einer denkbar schlichten Platte, die nur seinen Namen und den Ehrentitel, kein Kreuz und kein Dekor sonst trägt, ganz in der Nähe seiner toten Hunde, die ihm zeitlebens näher standen als die Menschen.