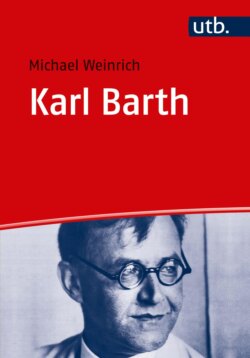Читать книгу Karl Barth - Michael Weinrich - Страница 6
ОглавлениеVorwort
„In der Kirche gibt es keine Vergangenheit,
darum auch nicht in der Theologie.“1
Die letzten hundert Jahre der Theologiegeschichte lassen sich ohne eine eingehende Wahrnehmung von Karl Barth (1886–1968) nicht angemessen verstehen. Seit seinem Vortrag „Der Christ in der Gesellschaft“ 1919 in Tambach (Thüringen) zog er den Fokus der theologischen Aufmerksamkeit auf sich. Es hat keine fünf Jahre benötigt, bis Barth, der inzwischen auf einer Stiftungsprofessur außerordentlicher Professor in Göttingen geworden war, im Bereich von Theologie und Kirche so ziemlich in aller Munde war. Seitdem befindet sich der theologische Diskurs nicht nur in der systematischen Theologie, wenn nicht in einer direkten, so doch in einer indirekten Auseinandersetzung mit Karl Barth. Gewiss kann man sich gegen ihn stellen und ihm auf der ganzen Linie widersprechen, aber wenn man auf der Höhe der Zeit sein will, wird es kaum möglich sein, seine Theologie einfach zu ignorieren. Deshalb ist es in jedem Falle geboten, eine möglichst ausgewiesene Vorstellung von den Motiven und Anliegen dieser Theologie zu haben. Darum geht es in diesem Buch.
Zur Präsentation eines so umfänglichen und auch höchst unterschiedlich wahrgenommenen Werkes wie das von Barth können verschiedene Formen der Annäherung und Darstellung gewählt werden. Für das vorliegende Buch wurde ein Mittelweg zwischen elementaren Grundinformationen und gelehrter Gesamtdarstellung eingeschlagen. Letztere wäre verfrüht und für den Rahmen eines Studienbuches zu ambitioniert. Erstere bliebe andererseits hinter den Ansprüchen eines soliden Studienbuches zurück, weil sie nicht tatsächlich dazu in der Lage sein kann, der Vielschichtigkeit der Theologie Barths gerecht zu werden, die sie erst zu dem macht, was sie ist. Es gibt eine Form der Unterschreitung ihrer Komplexität, die zwangsläufig dazu führt, dass die Pointen dieser Theologie von der für sie charakteristischen Bewegung isoliert werden. Damit wird sie aber genau um das Moment gebracht, dem Barth in immer neuen Anläufen den nötigen Nachdruck zu verleihen versuchte, weil nur so über die überkommenen Gewohnheiten der Theologie hinauszukommen ist.
Das Regulativ seiner Theologie besteht vor allem in einer Verhältnisbestimmung der Theologin bzw. des Theologen zu der Besonderheit des sie interessierenden und engagierenden lebendigen Gegenstandes. An all den verschiedenen Orten, die von der Theologie in Betracht gezogen werden, ist diese Verhältnisbestimmung immer wieder neu und durchaus auch jeweils anders wahrzunehmen, wenn das, was Theologinnen und Theologen ihrer Profession nach zu sagen aufgefordert sind, in der angemessenen Verantwortlichkeit zur Sprache gebracht werden soll. Barth wollte seine Leserinnen und Leser entschieden weniger von den Resultaten seiner theologischen Einlassungen überzeugen als vielmehr von der bestimmten Gestalt einer theologischen Existenz, in der er zu seinen Gedanken gefunden hat und in der schließlich auch jede und jeder zu den je neu zu formulierenden theologischen Gedanken finden muss, die es je heute zu sagen gilt. Wenn man so will, geht es um die Einübung einer bestimmten Blickrichtung, die dann auch dazu befähigen soll, selbst zu entscheiden, ob und wie weit es möglich ist, Barth auch in seinen Resultaten zu folgen, oder ob eine überzeugendere Perspektive ins Auge zu fassen ist, die dann ebenso zur Diskussion gestellt werden kann, wie es Barth mit der seinigen getan hat. Barth wünscht sich grundsätzlich freie Leserinnen und Leser, die leidenschaftlich und engagiert Theologie treiben.
Es sind bei Barth stets mehrere Fäden, die miteinander verwoben werden und somit auch jeweils zusammen beachtet werden wollen. Zum Verständnis kommt es entscheidend darauf an, die damit verbundene spezifische Dynamik in den Blick zu bekommen. Erst wenn die Hintergründigkeit der vordergründigen Einfachheit seiner Theologie mit in den Blick kommt, kann damit gerechnet werden, dass es tatsächlich Barth ist, von dem da die Rede ist und eben nicht nur eine theologiegeschichtliche Schublade, in der wir lediglich ein neues Arrangement der ansonsten bekannten, weil üblichen Bestandteile der überkommenen Theologie wiederfinden. Möglicherweise besteht die Hauptschwierigkeit, Barth angemessen zu verstehen, darin, dass er weit verständlicher daherkommt, als er es tatsächlich ist. Das würde auch erklären, warum er immer wieder missverstanden und karikiert wird.
Und dies kann genauso gut zugleich auch anders herum gesagt werden: Barths Theologie erscheint so überaus hintergründig und kompliziert, weil das im Grunde einigermaßen Einfache, was seine Theologie ausmacht, nicht mehr recht in die neuzeitliche theologische Landschaft zu passen scheint, so dass es entweder als vorneuzeitlich oder sogar als naiv im Sinne von distanzlos unkritisch verstanden werden kann. Das im Grunde recht Einfache seiner Theologie, das aber eben in der Theologie in dieser Ausdrücklichkeit keineswegs eine allgemeine Selbstverständliche ist, besteht darin, dass sie von vornherein ein lebendiges Einverständnis mit dem christlichen Glaubensbekenntnis voraussetzt: Theologie gibt es allein um des Glaubens an Jesus Christus willen, und in der Theologie wird nach einem angemessenen Verstehen dieses Glaubens gefragt. Sie hat nicht die Aufgabe, diesen Glauben zu begründen, ihn anzubahnen, für ihn zu werben oder ihn zu verteidigen. Damit wäre sie heillos überfordert. Wohl aber soll sie sich auf die ihm eignende Erschließungskraft und die mit ihr verbundenen Verstehenshorizonte konzentrieren und dabei nach einem ebenso ausgewiesenen wie belastbaren Verstehen fragen, dass sich kritisch über den Glauben Rechenschaft abzulegen versucht. Als diese Rechenschaft ist Theologie von Belang für die Gemeinschaft der Glaubenden, d. h. für die christliche Gemeinde bzw. die Kirche. Indem theologisches Nachdenken von Belang sein muss und will, ist es auf Nachvollziehbarkeit hin angelegt, d. h. es hat einen benennbaren Entdeckungshorizont und vollzieht sich in einem argumentativ nachvollziehbaren Begründungshorizont. Das ist es, was die Theologie zur Wissenschaft macht, dass sie sich um ein begründetes und auf Nachvollziehbarkeit hin angelegtes Verstehen des christlichen Glaubens als ihres Gegenstandes bemüht. Die Besonderheit ihres Gegenstandes besteht allerdings darin, dass seine Relevanz nicht von dem Resultat seiner kritischen Überprüfung abhängt, sondern allem Verstehen immer schon vorausläuft. – Hier zeigt sich bereits, dass es bei Barth unversehens voraussetzungsvoll und verwickelt wird, selbst dann, wenn nur versucht wird, die im Grunde ganz einfache Grundvoraussetzung seiner Theologie zu benennen. Dabei kann nicht einmal wirklich ausgemacht werden, ob Barth uns diese Schwierigkeiten bereitet oder ob wir es nicht eher selbst sind, die sich so schwertun. Die weitere Vertiefung sei den späteren Ausführungen überlassen.
Schließlich sollte noch ein weiterer Aspekt bereits hier angedeutet werden. Genau genommen geht es in der Theologie nicht allein um den Denkbedarf der Gemeinde bzw. der Kirche, sondern um eine bedachte und sich neu vergewissernde Orientierung der fundamentalen Beziehung, in der sie sich immer schon befindet. Die biblisch-theologische Referenz für diese dynamisch lebendige Beziehungswirklichkeit ist für Barth der Bund, der, von Gott initiiert, den Raum bezeichnet, in dem der Mensch als Partner Gottes seine Freiheit leben kann. Gott erweist sich als der Gott, der unser Gott sein will, und der Mensch ist dazu konstituiert, gemeinschaftlich in Beziehung zu ihm zu leben. Damit kommen wir zu der entscheidenden erkenntnistheoretischen Voraussetzung seiner Theologie: Gott wird nur in der unserer Wahrnehmung vorauslaufenden und sie überhaupt erst ermöglichenden Beziehung zum Menschen erkannt, so wie sich auch der Mensch erst dann recht verstehen kann, wenn er von dieser Beziehung Gottes zu ihm aus betrachtet wird. In diesem Sinne ist die Theologie gerade nicht nur Gotteserkenntnis, sondern es ist der bereits von Gott erkannte und darin Gott erkennende Mensch, den die Theologie in den Blick nimmt, um sich je aktuelle Rechenschaft über das wahrzunehmende Verhältnis Gottes zum Menschen abzulegen. Es macht grundsätzlich keinen Sinn, Gott an und für sich betrachten zu wollen. Nach Barth vollzieht sich Theologie im Horizont der Aktualität des von Gott gestifteten Bundes, in dem zu leben die Bestimmung des Menschen ist, so dass es danach zu fragen gilt, was es mit diesem Bund auf sich hat. Indem für Barth dieses Beziehungsverhältnis des Bundes das eigentliche Drama ist, dem die Theologie zu folgen hat, wird der Bund zu der für Barth charakteristischen Dimension seiner Theologie, die sie in allen ihren Teilen durchzieht. Daher gibt es in diesem Buch auch kein besonderes Kapitel zum Bundesverständnis bei Barth, sondern die Verbindung zu dem fundamentalen Bundesverhältnis begleitet uns durch die ganze Darstellung hindurch.
Damit sind wir bei den Regieanweisungen. Barth ist kein theologischer Schnellimbiss für Sofortverwerter, ebenso wenig ein vielgängiges Gourmetmenu für ästhetisch sensibilisierte Häppchengenießer. Ohne eine gewisse Geduld und eine interessierte Neugier mit einem konzentrierten Stehvermögen werden sich die Einlassungen Barths nicht recht erschließen. In ermäßigter Form gilt das auch für dieses Studienbuch, das um der erforderlichen Differenziertheit willen seinen Leserinnen und Lesern immer wieder auch kompliziertere Zusammenhänge zumutet, die sich nur mit Substanzverlust vereinfachen ließen. Die Grundlinie sollte sich allerdings auch erschließen, wenn sich nicht jede Einzelheit auftut.
Auch wird man sich von vornherein von der Vorstellung verabschieden müssen, hier eine neutrale, gleichsam objektive Barthdarstellung präsentiert zu bekommen. Diese kann es ebenso wenig geben wie eine neutrale und objektive Darstellung Luthers oder Calvins. In jedem Fall kann es immer nur um einen möglichst gut ausgewiesenen Blickwinkel gehen, der grundsätzlich andere Blickwinkel nicht ausschließt. Zudem soll ausdrücklich darauf hinzuwiesen werden, dass auch im Blick auf Barth ebenso wie auf Luther und Calvin Vollständigkeit kein realistisches Ideal sein kann; das gilt ebenso für die Fülle des vorliegenden Werkes als auch den nicht mehr übersehbaren Umfang der Sekundärliteratur. Für beide Bereiche bleibt ein gewisses Maß an Zufälligkeit einzuräumen, das nicht auf mangelnde Umsicht, sondern allein auf die Endlichkeit der Ressourcen zurückzuführen ist, die für die Erarbeitung eines solchen Buches mobilisiert werden können.
Gelegentlich kommt es zu Wiederholungen, die vor allem der Intention geschuldet sind, die einzelnen Kapitel je für sich verständlich zu halten. So lässt es sich beispielsweise nicht vermeiden, dass es in der Betrachtung der Biographie Barths (vgl. Kap. II) Begebenheiten zu berichten gibt, die auch im Blick auf seine Wirkungsgeschichte (vgl. Kap. V) bedeutsam sind. In solchen Fällen waren um der Lesbarkeit des jeweiligen Kapitels willen Doppelungen in einem begrenzten Maße hinzunehmen, aber auch im Blick auf systematische Fundamentalentscheidungen Barths, die eben auch bei Barth selbst in unterschiedlichen Zusammenhängen erneut angesprochen werden.
Schließlich gilt es, einen ganz besonderen Dank auszusprechen an Brigitte Schroven und Hartmut Lenhard, die sich einigermaßen kurzfristig der entsagungsvollen Mühe unterzogen haben, das umfangreiche Manuskript durchzusehen. Aus ihrem größeren Abstand zu den Einlassungen in diesem Buch haben sich zahlreiche Anregungen ergeben, die teilweise auch über die nun vorliegende Fassung hinausgehen und weiterwirken werden. Ebenso danke ich für die bereits bewährte professionelle Zusammenarbeit mit dem Verlag, insbesondere Jörg Persch, Elisabeth Hernitscheck und Carla Schmidt. Gewidmet sei dies Buch meiner Frau, Rosemarie Weinrich, die schon seit langem, mit durchaus unterschiedlichen Anmutungen und teilweise mit geduldigen Entsagungen dem offenkundig unerschöpflichen Mysterium Karl Barth Asyl in unserem Leben gewährt.
| Paderborn, Quasimodogeniti 2018 | Michael Weinrich |
1Barth, Die Protestantische Theologie im 19. Jahrhundert, 3.