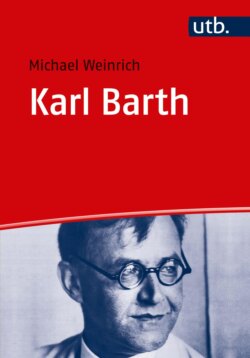Читать книгу Karl Barth - Michael Weinrich - Страница 7
ОглавлениеI. Warum Karl Barth? Eine erste Annäherung und zwölf Blitzlichter
Ohne Übertreibung kann gesagt werden, dass Karl Barth wohl der bedeutendste Theologe des 20. Jahrhunderts gewesen ist. Der Grund dafür liegt vor allem in seiner Neuentdeckung der besonderen Aufgabe der Theologie und der von ihm entschlossen vollzogenen kritischen Revision ihrer Tradition in ihrer ganzen Breite. Auch dort, wo Barths Impulse auf Skepsis oder auf unterschiedlich intensive Ablehnung stießen, nötigten sie dazu, die überkommenen theologischen Einsichten und die ihnen zugrunde liegenden methodischen und inhaltlichen Orientierungen kritisch zu sichten und erneut zu begründen. Indem Barth vor allem die liberale Theologie und den Kulturprotestantismus, die beide im 19. Jahrhundert bestimmend wurden, grundsätzlich in Frage stellte und zugleich sehr ambitionierte Anforderungen an eine den Bedingungen des 20. Jahrhunderts gerecht werdende Theologie stellte, war eine selbstverständliche Fortschreibung der herrschenden theologischen Konventionen nicht mehr möglich. Und so ist es vor allem seine Theologie gewesen, die den theologischen Kontroversen vor allem in der protestantischen Theologie direkt oder indirekt eine spezifische Prägung gegeben hat. Kein anderer theologischer Entwurf hat eine vergleichbar herausfordernde Beachtung gefunden.
Auch zu Beginn des 21. Jahrhunderts erweist sich Barths Theologie unter den sich rasant verändernden Umständen und Bedingungen in durchaus neuer Weise als ein keineswegs abgegoltener Entwurf mit teilweise überraschender Aktualität. Dabei hat ihre Wahrnehmung längst konfessionsübergreifenden Charakter gewonnen. Zunächst war es im 20. Jahrhundert die katholische Theologie, die ein bis in die Gegenwart anhaltendes Interesse an seiner Theologie zeigte. Heute kann festgestellt werden, dass sie sowohl in den dogmatischen als auch in den ethischen Auseinandersetzungen weltweit eine ökumenische Bedeutung erlangt hat, die nur sehr wenigen theologischen Entwürfen zuteilwird. Gewiss werden Barths Vorschläge sehr unterschiedlich wahrgenommen, aber es scheint sich eine Art Konsens über die von Barth angeregten theologischen Sensibilisierungen herauszubilden, der nicht zuletzt auf dem ökumenischen Potenzial seiner auf das Wort Gottes ausgerichteten biblisch orientierten Theologie basiert.
Eine ganz andere Frage bleibt, ob die Anliegen Barths immer in angemessener Weise wahrgenommen wurden. Häufig wurden seine Zuspitzungen in der Rezeption verharmlosenden Entschärfungen, teilweise entstellenden Akzentverschiebungen oder sogar eigenwilligen Verdrehungen unterworfen, und zwar nicht nur von denen, die sie skeptisch und ablehnend bewerteten. Das wohlwollende Missverständnis hat dem abweisenden durchaus nichts voraus. Die Auseinandersetzung darüber hält bis heute an. Bei theologischen Entwürfen eines solches Formats werden sie wohl auch so lange nicht an ein Ende kommen, solange ihnen noch eine orientierende Bedeutung zugetraut wird, durchaus vergleichbar mit der Diskussion so bedeutender Theologen wie Augustin, Thomas von Aquin, Martin Luther oder Johannes Calvin.
Historisch betrachtet hat Barth in eine Zeit hineingesprochen, in der es viele Anzeichen für eine erreichte Grenze bzw. eine einzugestehende fundamentale Krise gegeben hat. Sie betraf das aufklärerische Pathos der Neuzeit und das auf das menschliche Subjekt konzentrierte moralische Selbstbewusstsein des 19. Jahrhunderts, ebenso wie die Theologie, die sich nicht zuletzt in apologetischer Absicht diesem Selbstbewusstsein angepasst hat. Barth war nicht der erste, der diese Grenze im Grunde bereits überschritten sah, sondern er konnte sich u. a. auf Friedrich Nietzsche, Sören Kierkegaard, Franz Overbeck oder Fjodor Dostojewski berufen. Die Repräsentanten der Kirchen standen allerdings vornehmlich den staatstragenden gesellschaftlichen Kreisen nahe. Sie ließen sich in Deutschland beim Ausbruch des Ersten Weltkriegs beinahe restlos von der nationalistischen allgemeinen Kriegsbegeisterung anstecken, was sich nicht nur in den Waffensegnungen einen demonstrativen Ausdruck verschaffte, sondern auch die Predigten dieser Zeit prägte.1 Barth stand einigermaßen allein da, als er den Ausbruch des Ersten Weltkriegs als das katastrophale Scheitern einer besinnungslos selbstbezogenen Politik und illusionären Kultur anprangerte. Vor allem aber sah er den vorgängigen Weg der Kirche und eben auch der Theologie an ein definitives Ende gekommen. Es war nicht weniger als Gott selbst, der ihnen in ihrem Betrieb verlorengegangen war, ohne dass es noch die Möglichkeit gab, ihn nun einfach wieder an seinen alten Platz zu stellen.
Erst als die Erschütterungen und Abgründe im weiteren Verlauf des Krieges allseits sichtbar wurden, kam es angesichts des bis dahin beispiellosen Gemetzels auf den Schlachtfeldern und des katastrophalen Ausgangs des Krieges zu einer allgemeinen Wahrnehmung dieser Krise. Das bisher weithin geltende geschichtsphilosophische Credo – der idealistische Optimismus einer sich permanent selbst vervollkommnenden Selbstverwirklichung des Menschen – war zumindest zwischenzeitlich bis in seine Wurzeln erschüttert. Damit war nun auch in der Theologie ein Boden dafür bereitet, die bisherigen Symbiosen und Koalitionen in Frage zu stellen. Beinahe alle für verlässlich gehaltenen Orientierungen gerieten ins Wanken, und die prinzipiell skeptisch gestimmte Frage, was in dem, was wir Wirklichkeit nennen, überhaupt noch Verlässlichkeit beanspruchen kann, wurde verbreitet gestellt – in der Philosophie ebenso wie in der Theologie, aber auch in der Literatur, im Theater, in der Musik und der Kunst. Der Ausgang des Ersten Weltkrieges evozierte beinahe überall ein tief empfundenes Krisenbewusstsein, das – auch wenn es sich im Laufe der Jahre erstaunlich bald wieder weitgehend verflüchtigte – für das Verständnis des 20. Jahrhunderts insgesamt zumindest als Narbe bedeutsam bleibt.
Unbeschadet von Barths besonderer Wahrnehmung dieser Krise bildete dieses epochale Krisenbewusstsein den allgemeinen Resonanzboden für seine theologischen Interventionen, sowohl für seine Diagnose und Zustandsbeschreibung der Katastrophe als auch für seine radikale theologische Deutung. Es war dieser Resonanzboden, der zunächst einen nicht unerheblichen Teil seines enormen Erfolgs ausmachte, und zugleich ist er auch einer der Gründe für die zahlreichen Missverständnisse und problematischen Aneignungen, denen seine Theologie von Anfang an ausgesetzt gewesen ist. Einerseits eignete diesem Resonanzboden eine ungewöhnliche Reichweite und andererseits war er von einer unbeschreiblichen Diffusität geprägt, die es zwar ermöglichte, dass er von recht unterschiedlichen Seiten aus betreten werden konnte, aber zugleich verhinderte, dass sich ein klares Profil der Krise identifizieren ließ. Barth hat später selbst diese Situation im Blick auf die verbreitete Wahrnehmung seiner Interventionen als durchaus ambivalent bewertet (vgl. Kap. V.2).
Barths eigener Zugang war von vornherein ein entschlossen theologischer, auch wenn für ihn stets die historischen Umstände, unter denen sich etwas ereignete, von großem Interesse waren. Als Theologe empfand er es beim Ausbruch des Krieges als einen Skandal, in welcher Weise da Gott in das blindwütige Treiben hineingezogen wurde, so als lasse er sich für jede Schandtat in Anspruch nehmen, um sich das jeweilige Ansinnen von ihm absegnen lassen. Es könne nicht sein, dass sich mit Gott alles rechtfertigen lasse. Wenn es sich bei Gott nicht nur um einen Spuk handeln soll, könne es dem Menschen nicht einfach freigestellt sein, wie von ihm zu reden ist und in welcher Weise er jeweils in dem konkreten Zeitgeschehen in den Blick genommen wird. Und so könne es der Theologie auch nicht freigestellt sein, von wo aus sie die Welt betrachtet und in welcher Weise die Beziehung Gottes zum Menschen angemessen zur Sprache gebracht wird. Wenn sie eine sinnvolle Unternehmung sein soll, muss es für die Theologie eine verbindliche Orientierung geben, an der sich ihre Gottesrede und dann eben auch ihre Wirklichkeitsbetrachtung messen lassen müssen. Es kann nicht einfach eine Frage ihres freien Ermessens sein, von wo aus sie sich in den Verlegenheiten, in die sich der Mensch durch die Krise versetzt sieht, eine Orientierung erhofft. Allein, es bleibt die Frage, wie sie sich darin vergewissern kann, dass sie in der richtigen Richtung nach Orientierung Ausschau hält?
Es gehört zu dem besonderen Charakter seiner Intervention, dass Barth, wenn es um Gott geht, dem Menschen die Möglichkeit bestreitet, von sich aus auch nur in die richtige Richtung blicken zu können. Gott ist kein Gegenstand, auf den die menschliche Erkenntnis früher oder später durch eigene Anstrengungen geführt werden könnte. Und so ist die Theologie alles andere als eine selbstverständliche oder auch nur naheliegende Möglichkeit des Menschen. Wenn schon sonst gilt, dass alle Orientierungen, die sich der Mensch selbst zu geben vermag, unablässig auch wieder in Zweifel gezogen werden, wie viel mehr hat dies in der Theologie zu gelten, deren Gegenstand ihr noch viel weniger zur Verfügung steht als alle anderen Gegenstände menschlicher Erkenntnis! Es ist gerade nicht so, dass da, wo die menschliche Erkenntnis unweigerlich an ihre Grenze stößt, nun Gott in die Bresche springt. Ganz im Gegenteil kommt mit Gott eine per se weit grundsätzlichere Infragestellung unserer Erkenntnis auf den Plan, die sich auch nicht durch die Theologie auffangen lässt. Die Krise, die Barth vor Augen hatte, bietet von sich aus keinen Ausgang an, den der Mensch nun einfach aufsuchen könnte (vgl. Kap. II.3).
Barth hat aber der Theologie nicht nur ihre Zeit bestritten, sondern auch ihren Ort, denn sie könne längst nicht mehr beanspruchen, von allgemeinem Interesse zu sein. Und je mehr sie diesem faktisch annullierten Anschein dennoch hinterherzulaufen versuche, umso mehr werde sie auch den Rest an Interesse verspielen, der ihr noch von der Seite zukommt, die sich noch der christlichen Tradition verbunden weiß. Ihr Ort ist nicht einfach der Areopag (Apg 17), der allgemeine Marktplatz der Weltanschauungen, auf dem sie vor einer diffusen Öffentlichkeit einem unbekannten Gott ein Gesicht zu geben versucht, sondern sie hat ihren Ort zunächst und eben auch prägend in der Kirche, die sich mit ihrem Bekenntnis auf den in der christlichen Tradition vorausgesetzten Gott beruft. Der besondere Denkbedarf der Theologie entsteht darin, dass es in der Kirche nicht beliebig sein kann, in welcher Weise sie von Gott spricht. Es ist nicht das allgemeine Gegenwartsbewusstsein, an das sich Barth wendet, sondern er bescheidet sich auf den besonderen Horizont, für den erklärtermaßen die Rede von Gott nach christlichem Verständnis von vornherein eine existenzielle Dimension hat. Das ist die Kirche, und es gilt, vor allem die Kirche selbst daran zu erinnern. Diese Konzentration auf die Kirche und ihre Verkündigung zeigt an, dass es Barth nicht um einen allgemein zu führenden Diskurs etwa über die Sinnhaftigkeit der Gottesfrage oder gar um eine Bekämpfung des Atheismus geht. Nebenbei gesagt war ihm der Atheismus zeitlebens in vieler Hinsicht deutlich weniger suspekt als die vorfindliche Theologie und die Kirche mit ihrem überaus nachlässigen, weil im Grunde unernsten Umgang mit der Wirklichkeit Gottes. Stattdessen hat Barth die in der Gemeinde bzw. der Kirche immer wieder neu zu stellende Frage nach den Bedingungen und Konsequenzen einer angemessenen Rede von Gott aufgeworfen, die seiner lebendigen Selbsterschließung und nicht nur unseren Phantasien und Wünschen gerecht wird.
Wir stoßen bei Barth immer wieder auf Hinweise auf die prinzipielle Verlegenheit, in der sich die Theologie befindet, wenn sie die von ihrem Begriff und von ihrer konkreten Situation ausgehende Aufgabe tatsächlich ernst nimmt. Barth bleibt sich zeitlebens bewusst, dass der Anspruch der Theologie weit über das hinausgeht, was mit unseren begrenzten Möglichkeiten geleistet werden kann. Diesem sachlich bedeutsamen Aspekt seiner Theologie werden wir in unterschiedlichen Zusammenhängen immer wieder begegnen. Er steht für den dynamischen und unabschließbaren Charakter ihres unablässigen Ringens um ihren in seiner Lebendigkeit niemals erfassbaren Gegenstand, der uns jeweils dazu nötigt, uns ganz neu auf den Anfang zurückwerfen zu lassen. Barth vergleicht die Theologie mit dem unzulänglich bleibenden Versuch, einen „Vogel im Fluge“ zu beschreiben.2 Es könnte nur eine Verkennung einer recht verstandenen Theologie sein, wenn sie den Anschein erwecken würde, dass sie mit einem mehr oder weniger umfassenden Bündel wiederholbarer Lehren die Wirklichkeit Gottes erfassen könne.
Im Rahmen dieser ersten allgemeinen Annäherung sollen zunächst zwölf markante Aspekte als Blitzlichter markiert werden, die später an verschiedenen Stellen in den folgenden Kapiteln wieder aufgegriffen und weiter vertieft werden.
1.Die Gottesfrage
These
Gegenüber der gewohnheitsmäßigen selbstverständlichen Berufung auf Gott hebt Barth die Fremdheit und Andersartigkeit Gottes im Horizont des christlichen Bekenntnisses hervor. Gott erschließt sich allein aus seiner Besonderheit, durch das auch das Allgemeine in ein neues Licht gerät.
Es war die allseits ebenso selbstverständliche wie unspezifische Berufung auf Gott, die Barth angesichts des Ausbruchs des Ersten Weltkriegs als eine sich verborgen haltende Infragestellung Gottes empfand. Er sah die Kirche ebenso wie die Theologie dazu herausgefordert, sich ganz neu und grundlegend mit der Irritation zu beschäftigen, die er unweigerlich damit verbunden sah, wenn der Mensch es wagt, von Gott zu sprechen. Barth empfand es als eine Ungeheuerlichkeit, auf welche Weise man sich es sich mit Gott gleichsam bequem gemacht hatte. Es war ein für die eigene Weltsicht domestizierter Gott, der von der Kirche und der Theologie, aber auch von einem Teil der gesellschaftlich einflussreichen Verantwortungsträger gerne da im Spiel gesehen wurde, wo sich jeweils die eigenen geschichtlichen Sympathien und Optionen fanden. Barth erhob den Vorwurf, dass die Inanspruchnahme Gottes zu einer beinahe voraussetzungslos zur Verfügung stehenden Berufungsinstanz verschlissen sei, mit der diesem oder jenem Geschehen – je nach Bedürfnislage – eine entsprechende Dignität bzw. religiöse Weihe verliehen werden konnte. Der längst vor allem auf sich selbst gegründete neuzeitliche Mensch hatte inzwischen beinahe alle Bereiche seiner Wirklichkeit vollständig in die eigene Regie genommen und Gott dabei die Rolle zugewiesen, die vom Menschen sich selbst zugemessene Dignität mit einer besonderen religiösen Weihe zu umgeben. Wo der neuzeitliche Mensch Gott nicht längst als überflüssiges und hinderliches Relikt abgeschüttelt hatte, diente er – pointiert formuliert – vor allem der religiösen Selbstergötzung des stets zur Selbstvergewisserung auf weitere Selbstbestätigung ausgerichteten Subjekts. Es waren die weithin zusammengeschmolzenen Reste des schwindenden menschlichen Selbstzweifels, denen als willfähriges Ermutigungsangebot ein nützlich partikularisierter Gott in möglichst greifbarer Nähe gehalten werden sollte. Gott war zu einer in Anspruch zu nehmenden Möglichkeit des sich auf seine Möglichkeiten verlassenden modernen Menschen geworden.
Wenn Barth beklagte, dass die Rede von Gott nichts anderes im Schilde führe, „als in etwas erhöhtem Ton vom Menschen [zu] reden“,3 so wollte er darauf aufmerksam machen, dass eine solche Rede von Gott ihren spezifischen Inhalt verloren habe, durch den sie allein zu einer sinnvollen Anstrengung werden könnte. Gott sei gleichsam zu einem allgemeinen Ausstattungsgegenstand unseres Wirklichkeitsverständnisses verkommen. Gewiss mag man sich wohl noch hier und da recht gern seiner bedienen, aber von ihm gibt es nicht wirklich etwas Besonderes zu erwarten oder zu befürchten, weil er konsequent der Agenda des Menschen nachgeordnet wird, mit der er seine Geschichte in die eigenen Hände genommen hat. Abgedrängt in den Sonderbereich der Religion ist er zu einem wehrlosen Spiegel menschlicher Selbstgerechtigkeit verharmlost worden, der sich beinahe für alles in Anspruch nehmen lässt, was gerade für das Gute, Wahre und Schöne gehalten wird.
Gegenüber diesem weltanschaulich eingepassten Gott, der sich in allen Lebenslagen den eigenen Erwartungen gefügig hält, hebt nun Barth entschieden hervor, dass Gott „der ganz Andere“4 sei. Er will damit daran erinnern, dass Gott nicht einfach eine Allgemeinheit zukommt, die jederzeit und allseits zur Verfügung steht. Vielmehr ist er das schlechterdings Besondere, das sich weder aus den Bedingungen der Welt und unseren Erfahrungen ableiten lässt noch ihnen einfach zugeordnet werden kann. Im Blick auf Gott versagt die zu allgemeiner Geltung erhobene Erkenntnisregel, nach der jedes Besondere immer nur als eine Variante eines Allgemeinen erkannt werden kann. Soll ernsthaft von Gott die Rede sein, so müsse es um etwas Anderes gehen als um eine besondere Spezies aus einem angenommenen Genus des allgemein Göttlichen und den Vorstellungen, die wir uns davon machen. Wir wissen keineswegs schon von uns aus, was es heißen könnte, dass Gott in Erscheinung tritt und was von ihm dann zu erwarten wäre. Gott ist keine Variante einer uns bekannten allgemeinen Größe mit einem bestimmten Eigenschaftspotenzial. Vielmehr kann für Gott die allgemein geltende Erkenntnisregel grundsätzlich nur in ihrer Umdrehung gelten: Nur vom Besonderen aus lässt sich das Allgemeine erkennen, d. h. nur wenn und indem die unvergleichliche Besonderheit Gottes in Erscheinung tritt, wird es uns möglich, etwas über Gott zu sagen und – wie sich dann zeigen wird – nicht nur über Gott, sondern auch über den Menschen und unsere ganze Wirklichkeit, zu der Gott, wenn und wo er in Erscheinung tritt, immer schon in einer ganz bestimmten Beziehung steht.
Gott lässt sich nicht unseren Erkenntnisregeln unterwerfen so wie es nicht an uns ist, ihm den ihm zukommenden Platz zuzuweisen, sondern rechte Gotteserkenntnis kann nur aus der von ihm selbst eröffneten Beziehung zu uns kommen, in der uns dann auch unser eigener Platz erschlossen wird, über den ja ebenfalls keine selbstverständliche Klarheit zur Verfügung steht. Es ist diese Wiederentdeckung der Fremdheit, der Andersartigkeit und zugleich der sich selbst vergegenwärtigenden Gegenständlichkeit Gottes, die Barth den allseitigen und selbstverständlichen Berufungen auf Gott entgegenhält.
Wie bereits angedeutet, wendet sich Barth nicht an die Gottesleugner, nicht an diejenigen, die sich nicht mehr auf Gott berufen oder diesen gar mehr oder weniger offensiv bestreiten, um nun ihnen gegenüber Gott oder die Religion zu verteidigen, wie es Friedrich Schleiermacher in seinen berühmten Reden „Über die Religion“ im Blick auf „die Gebildeten unter ihren Verächtern“ getan hat. Er sieht sich vielmehr in erster Linie von dem desaströsen Zustand des Gottesverständnisses bei denjenigen provoziert, die sich ausdrücklich auf Gott berufen und vorgeben, als seine Protagonisten aufzutreten. Er wendet sich an diejenigen, die das Christentum für sich in Anspruch nehmen und sich auf den Gott der christlichen Tradition berufen. Ihnen wirft Barth vor, dass zum Schaden der Kirche und damit auch zugleich der ganzen Gesellschaft nicht mehr deutlich ist, was das Bestimmte und somit Orientierende dieses Gottes ist. Barth hält der Kirche und der Theologie entgegen, dass es sich verbiete, Gott in unsere jeweilige Weltanschauung einzubauen, weil es in seiner Konsequenz nur als absurd bezeichnet werden könne, wenn sich Gott je nach Lage unserem Ermessen unterwerfen ließe. Vielmehr stehe umgekehrt mit der Gottesfrage immer auch unsere ganze Weltanschauung zur Debatte. Mit der angemessenen Wahrnehmung der Gottesfrage steht zugleich die Kirche als Kirche auf dem Spiel. Barth mahnte zu einer grundlegenden Umkehr, ohne welche die Kirche ihrer spezifischen Freiheit verlustig gehe und somit ihre geschichtliche Legitimation verlöre. Es bleibt es eine durchaus anspruchsvolle und ambitionierte Angelegenheit, wenn der Mensch es wagt, im Blick auf sich und die von ihm erschließbare Wirklichkeit von Gott zu reden.
Weitere Entfaltung und Vertiefung dieses Aspektes in Kap. II.3; IV.1; V.2.
2.Die Wiederentdeckung der Bibel
These
Die grundlegende Orientierung für die Erkenntnis Gottes und seiner Geschichte mit dem Menschen findet die christliche Gemeinde im biblischen Zeugnis, das in dieser Funktion durch nichts anderes ersetzt werden kann.
Wenn Barth das gewohnheitsmäßige Christentum so energisch an die besondere Andersartigkeit Gottes erinnert, beruft er sich auf die Bibel und die charakteristische Art und Weise, in der in ihr von Gott und seinem Handeln die Rede ist. In den biblischen Texten finde sich das grundlegende Gotteszeugnis, an dem sich unser Gotteszeugnis von heute immer wieder neu auszurichten habe. Ohne Orientierung an der biblischen Perspektive der Gotteserkenntnis bleibt alle Gottesrede im Horizont des christlichen Glaubens willkürlich und unbegründet.
Wenn Barth von der „neuen Welt in der Bibel“ spricht, geht er davon aus, dass sie in der Substanz „eben gar nicht die rechten Menschengedanken über Gott, sondern die rechten Gottesgedanken über den Menschen“ mitteilt.5 Damit wird nicht in Abrede gestellt, dass wir in der Bibel durchgängig auf menschliche Gedanken treffen. Aber es kommt entscheidend darauf an, woraufhin wir dieses menschliche Gotteszeugnis lesen. Solange wir es so lesen, dass wir uns möglichst selbst darin wiedererkennen wollen, werden wir dort auch vor allem uns selbst begegnen. Wird die Bibel als ein Buch zur Orientierung einer moralischen Lebensführung gelesen, so wird sie uns hier eine Auskunft geben. Je nachdem, welche Fragen wir an sie richten, wird sie uns mit mehr oder weniger überzeugenden Antworten beschäftigen. Aber solange wir lediglich versuchen, unsere Lebensfragen in den Lebensorientierungen der antiken Verfasser der Bibel zu spiegeln, um uns dann diese oder jene Pointe bestätigen zu lassen, sind wir noch nicht auf das Besondere des biblischen Zeugnisses gestoßen. Solange wir uns allein an unseren eigenen Fragen orientieren, bleiben wir grundsätzlich in unserem eigenen menschlichen Möglichkeitshorizont und gingen damit an dem eigentlichen Anliegen des biblischen Zeugnisses und seinen Fragen an uns vorbei.
Barth hebt hervor, dass von den Verfassern der Bibel neben all dem Alten, was uns im Grunde immer schon irgendwie bekannt ist, vor allem eine neue Welt in den Blick gerückt wird, die nicht von unseren Möglichkeiten beherrscht wird, sondern in der sich die von uns aus unzugängliche Wirklichkeit Gottes in ihrer Beziehung zu unserer menschlichen Wirklichkeit zeigt. Es ist diese von unseren Möglichkeiten nicht erreichbare neue Welt, die im biblischen Zeugnis in unsere alte Welt hineinragt und um derer willen es als unvergleichliche Orientierungsquelle ernst zu nehmen bleibt. Nur wenn wir die Bibel mit der Erwartung lesen, in ihr mehr finden zu können, als wir uns selbst zu sagen vermögen, werden wir der Intention ihrer Verfasser gerecht, denn sie wollen uns auf diese neue Welt Gottes aufmerksam und auch neugierig machen.
Barth spricht vom ‚Ton vom Ostermorgen‘6, wie er im Grunde durch das ganze biblische Zeugnis hindurch zu vernehmen sei. Es spricht von dem Gott, der Christus vom Tode auferweckt hat und uns in den Verheißungshorizont dieser Auferstehung stellt. Es ist dieser Ton vom Ostermorgen, der wie nichts anderes für die neue Welt Gottes steht, die in unserer alten Welt längst wirksam ist und sich weiter Raum verschaffen will. Barth appelliert an den notwendigen Mut, diesen der alten Welt gegenüber grundlegend neuen Ton nicht in dem von uns veranstalteten Betrieb besinnungs- und heillos zu überhören.
Die Kirchen erweisen sich darin als Repräsentanten der alten Welt, dass auch sie sich immer wieder daran beteiligt haben, diesen in die Welt drängenden unvergleichlichen „Ton“ Gottes durch die Betriebsamkeit ihrer Frömmigkeitspraxis und ihre Gesinnungsappelle zu übertönen. In unseren anhaltenden Selbstrechtfertigungen übersehen wird Gottes Engagement für die Menschen. Die besondere Gerechtigkeit Gottes wird durch unsere menschlichen Gerechtigkeitsoptionen und ihre kategorialen Fixierungen gleichsam aus unserer Welt herausgehalten, weil wir nicht den Mut aufbringen, ihr eine wirkliche Bedeutung zuzumessen. Die Bibel haben wir mehr und mehr den Wahrnehmungsprämissen der verschiedenen menschlichen Gerechtigkeiten unterworfen, so dass die in ihr bezeugte andere Gerechtigkeit Gottes, wie sie im Ton vom Ostermorgen zum Klingen kommt, unbeachtet übergangen wird.
Soll Gott nicht nur der religiöse Spiegel menschlicher Selbstgerechtigkeiten sein, so gilt es, der Bibel mit dem Vertrauen zu begegnen, von ihr auf die Blickrichtung gewiesen zu werden, in der sich die Wirklichkeit Gottes in unserer Wirklichkeit erkennbar machen will.
Weitere Entfaltung und Vertiefung dieses Aspektes in Kap. III.3.
3.Die Bibel verstehen
These
Die Methoden zur Erschließung des rechten Verständnisses der Bibel dürfen diese nicht von außen an sie herangetragenen Vorstellungen oder Erwartungen unterwerfen, sondern sollen offen für ihre Selbstbezeugung sein.
Barths neue Konzentration auf die Bibel ist überaus voraussetzungsvoll und keineswegs als ein mehr oder weniger naiver Biblizismus zu verstehen. Das bedeutet aber nicht, dass Barth nun eine ganz spezifische Bibelhermeneutik vorträgt, mit der er einen Weg gebahnt sieht, auf dem diese erwähnte „neue Welt in der Bibel“ zuverlässig in Erscheinung treten kann. In dieser Hinsicht hält sich bei Barth ein durchaus fundamentaler Methodenskeptizismus durch. Ohne seinerseits einen Königsweg der Exegese zu propagieren, versucht er einerseits, in kritischer Auseinandersetzung mit der Praxis, in der er die zeitgenössische Theologie Exegese treiben sah, deren als kritisch stilisierte Übergriffigkeit und die daraus resultierenden Desiderate zu annoncieren, und andererseits – soweit es irgend geht –, der unterstellten inhaltlichen Solidität des Textes im Horizont des Gesamtzeugnisses der Bibel auf die Spur zu kommen.
Barth distanziert sich von Umgangsweisen mit den biblischen Texten, die sie den Verstehenskategorien des modernen historischen Bewusstseins unterwerfen. Hier werde bereits durch die Methode den biblischen Texten konsequent die essenzielle Chance abgeschnitten, etwas zur Sprache zu bringen, was wir uns nicht auch selber sagen könnten. Wenn grundsätzlich nur dasjenige gelten kann, wozu es aus gegenwärtigen Erfahrungen auch Entsprechungen gibt, so dass wir uns erlauben, es für historisch wahrscheinlich zu halten, wird von vornherein allem Einmaligen und Besonderen die gerade hier angesprochene besondere Aufmerksamkeit entzogen. Eine solche Lektüre der Bibel wird nicht von wirklicher Neugierde, sondern mehr von dem Interesse an Harmonie und Bestätigung bewegt. Sie gibt sich bereits damit zufrieden, dass aus dem Wald herauskommt, was man in ihn hineinruft. Ohne die erwartungsvolle Offenheit, im biblischen Zeugnis tatsächlich über unsere eigenen Möglichkeiten hinaus geführt zu werden, bleiben die Auslegungen im Horizont der eigenen Voraussetzungen gefangen und konsolidieren auf diese Weise den Ausleger gegenüber dem Text.
Von Anfang an hat Barth die Alternative von historisch-kritischer Exegese und theologischer Exegese nicht gelten lassen. Es kann nicht infrage gestellt werden, dass wir natürlich die Texte historisch-kritisch zu lesen haben, aber es kommt entscheidend darauf an, was damit gemeint ist. Auch bleibt entschieden einzuräumen, dass es sich bei der Bibel um ein mit allen Mängeln des Menschlichen behaftetes Zeugnis handelt. Es ist durchaus mit Ungenauigkeiten, Irrtümern und tendenziellen Zuspitzungen zu rechnen. Aber die Orientierung am biblischen Zeugnis verlöre jede substanzielle Bedeutung, wollte man annehmen, dass ihr Zeugnis von Gottes Handeln am Menschen so sehr von diesen Mängeln verdeckt sei, dass es nun darauf angewiesen ist, von uns erst hinter den biblischen Texten ausgegraben und zum Leuchten gebracht zu werden.
Die entscheidende Frage lautet: Ist die historische Kritik der Anwalt des Lesers gegenüber dem Text oder der Anwalt des Textes gegenüber dem Leser. In dieser Alternative kann es nach Barth nur so sein, dass dem Text ein Anwalt zugesprochen werden muss, weil der Leser durchaus sein eigner Anwalt ist. Barth macht darauf aufmerksam, dass ein Text noch nicht verstanden ist, wenn möglichst differenziert die Bedingungen ergründet werden, auf welche Weise er zustande gekommen ist. Es müsse vielmehr ebenso intensiv versucht werden, möglichst klar zu benennen, was er mitteilen will. Die Exegese kommt erst dann an ihr Ziel, wenn es ihr gelingt, mit eigenen Worten das zu sagen, was der jeweilige Autor uns mit seinem Zeugnis eröffnen wollte.
Dabei bleibt zu beachten, dass es nicht um den Besuch einer alten Pyramide geht, bei dem das aufzuspürende Neue prinzipiell immer nur eine längst versunkende Herrlichkeit der Vergangenheit sein kann. So sehr uns das biblische Zeugnis zweifellos in antiker Gestalt übermittelt ist, so sehr weist es zugleich über die spezifischen Bedingungen seiner Zeit hinaus. Indem es auf die Bezeugung der lebendigen Wirklichkeit des Handelns Gottes ausgerichtet ist, zielt es auf das unvergleichlich Besondere der Lebendigkeit Gottes, das auch heute nur dann angemessen wahrgenommen werden kommen kann, wenn wir uns vom biblischen Zeugnis orientieren lassen. Biblische Hermeneutik im Sinne von Barth ist schlicht und folgenreich die Anstrengung, bei der Auslegung der biblischen Texte möglichst genau in die Blickrichtung des jeweiligen Textes zu sehen in der Erwartung, von dort aus möglichst genau das zu hören zu bekommen, was die Verfasser zur Abfassung ihres Zeugnisses motiviert hat.
Weitere Entfaltung und Vertiefung dieses Aspektes im Exkurs in Kap. III.3.
4.Der Vorrang der Offenbarung
These
Gott kann nur dann angemessen zum Gegenstand der Erkenntnis werden, wenn er selbst zum Subjekt seiner Erkenntnis wird und unserer diesseitsverschlossenen Erkenntnis gleichsam auf die Sprünge hilft. In diesem Sinne steht die Offenbarung für die fundamentale Verwiesenheit des Menschen auf die Selbstvergegenwärtigung Gottes.
Der skizzierte Umgang mit dem biblischen Zeugnis bringt eine eigene Erkenntnistheorie mit sich, auf die Barth die Theologie verwiesen sieht, wenn sie sich aufmacht, nicht nur von sich, sondern tatsächlich auch von Gott zu reden. Gott kann kein von der Theologie aufzusuchender Gegenstand sein. Es kann nur anders herum funktionieren: Nur da ist sinnvoll von Gott zu reden, wo man sich selbst von Gott aufgesucht weiß. Der Erkenntnisaktivität des Menschen muss grundsätzlich eine Aktivität Gottes vorausgehen, wenn anders es nichts zu erkennen gibt. Die von der Bibel bezeugte Offenbarung ist nicht nur der Gegenstand der Erkenntnis, sondern eben auch ihr Subjekt. Das ist die grundlegende Voraussetzung und zugleich die entscheidende Verlegenheit jeder theologischen Unternehmung: Gott kann nur da erkannt werden, wo er sich selbst zu erkennen gibt. Rechte Erkenntnis des Offenbarungszeugnisses kann selbst nur ein Resultat von Offenbarung sein. Der Wirklichkeitserweis des Offenbarten kann allein durch die geoffenbarte Wirklichkeit selbst erfolgen und nicht durch die Instrumentarien der uns zur Verfügung stehenden Erkenntnismöglichkeiten.
Die damit angedeutete innere Differenzierung des Offenbarungsverständnisses wird von Barth trinitarisch konkretisiert. Gott ist das Subjekt der Offenbarung (der Vater), er ist das Objekt der Offenbarung (der Sohn) und er ist das Prädikat der Offenbarung, ihr Vollzug (der Heilige Geist) – er ist „in unzerstörter Einheit, aber auch in unzerstörter Verschiedenheit der Offenbarer, die Offenbarung und das Offenbarsein.“7 Hinsichtlich ihrer Gegenständlichkeit verweist die Offenbarung auf Jesus Christus als das Mensch gewordene Wort Gottes. Er ist der Schlüssel zu dem, was die Geschichte Gottes mit dem Menschen ausmacht und vom Menschen nun zu erkennen ist. Hier hat die für Barth charakteristische christologische Konzentration seiner Theologie ihren entscheidenden Grund.
Es reicht allerdings nicht aus darauf zu verweisen, dass sich Gott hier und da in der Vergangenheit offenbart habe, zumal sich die Erkenntnis, dass er sich hier und da offenbart habe, nicht an den in Anspruch genommenen Ereignissen evident machen lässt und somit auch nicht argumentativ demonstriert werden kann. Die Evidenz kann sich vielmehr nur durch die im biblischen Zeugnis angesprochene Wirklichkeit Gottes selbst erschließen. Mit der Betonung dieser konsequenten Verwiesenheit auf die freie Selbsterschließung Gottes erinnert Barth an die altkirchliche Einsicht: Gott wird nur durch Gott erkannt (Hilarius von Poitiers). Das sich in seinem Erkenntnisvermögen selbst spiegelnde und unablässig bestätigende neuzeitliche Subjekt wird in der Theologie mit seiner prinzipiellen Grenze konfrontiert. Der mit Hilfe des Denkens vollzogenen Selbstermächtigung des Menschen („Cogito ergo sum“ [„Ich denke, also bin ich“] – Descartes) tritt eine sich selbst behauptende Wirklichkeit entgegen, der gegenüber sich das Denken nur seine Unzulänglichkeit und Zufälligkeit eingestehen kann. Es wird sich hier herausstellen, dass all die für das Denken bemühte Kraft der Kritik vor allem in die Richtung auf die so wichtige Selbstkritik gründlich zu kurz greift. Wenn es um Gott geht, ist es nicht das menschliche Erkenntnisvermögen, das sich spekulativ einen Weg in die Transzendenz hinein verschafft, sondern es findet sich mit der Evidenz eines Wirklichkeitshorizontes konfrontiert, durch den die menschliche Erkenntnis in grundsätzlich andersartige Orientierungsbedingungen versetzt wird.
Indem durch die Selbstmitteilung Gottes die Wirklichkeit in ein neues Licht gestellt wird, geraten in gewisser Weise alle Erkenntnisse des Menschen in eine neue Perspektive, durch welche Licht und Schatten gegenüber der bisherigen Perspektive eine ganz neue und durchaus überraschende Verteilung erhalten. Die Passivität dieser Erkenntnis wird insbesondere darin deutlich, dass hier der Mensch nicht auswählt und auslegt, sondern sich ausgewählt und ausgelegt entdeckt und findet. Der neuzeitlichen Mentalität, nach welcher es der Mensch ist, der durch seinen Zweifel und sein Denken seinen Wahrnehmungen das zu entlocken versteht, was ihm dann als Wirklichkeit gilt, wird der Wirklichkeitsanspruch Gottes entgegengestellt. Dadurch wird der Mensch in einen Horizont versetzt, der ihn einerseits von den Zermürbungen der unablässigen Wirklichkeitskonstitution entlastet und ihn andererseits in eine Lebensperspektive versetzt, die ihn aus seiner Selbstgefangenschaft befreit und zu einem der lebendigen Zugewandtheit Gottes entsprechenden gemeinschaftlichen Leben ermutigt.
Das, was für die Reformation die Rechtfertigungslehre war, an der sich alles Weitere für die Theologie entscheidet, ist im 20. Jahrhundert für Barth die Frage nach der angemessenen Erkenntnis der Offenbarung, die er – wie es die Reformation mit der Rechtfertigung des Menschen getan hat – ganz auf die Seite Gottes rückt. Damit erteilt Barth der neuzeitlichen Apologetik der Theologie eine Absage und stellt die Theologie zunächst und betont in den Verantwortungshorizont der Kirche zur kritischen Rechenschaft über das von ihr zu erwartende Zeugnis in Wort und Tat. Mit dieser konsequenten Selbsternüchterung der Theologie und der offensiven Wahrnehmung ihrer tatsächlichen Partikularität ist Barth bis heute der Zeit immer noch voraus. Es geht ja nicht um einen Selbstrückzug der Theologie aus der akademischen Debatte, wohl aber um eine nüchterne und sachgemäße Präzisierung der Reichweite des von ihr einzubringenden Blickwinkels und der von ihr zu erwartenden Argumentationsebene.
Weitere Entfaltung und Vertiefung dieses Aspektes in Kap. IV.1.
5.Das Problem der „natürlichen Theologie“
These
Indem Gotteserkenntnis keine dem Menschen zur Verfügung stehende Möglichkeit ist, verbietet sich die Berufung auf geschichtliche oder psychologische Erfahrungen als einer Brücke zur Gottesfrage und somit auch als ein Entdeckungshorizont für fundamentaltheologische Orientierungen. Barths Abweisung der „natürlichen Theologie“ versucht diesem Umstand konsequent gerecht zu werden.
Indem Barth die Verwiesenheit der Theologie auf die allein in der Hand Gottes liegende Offenbarung hervorhebt, zieht er die aus seiner Sicht notwendige erkenntnistheoretische Konsequenz aus der reformatorischen Erkenntnis der Alleinwirksamkeit Gottes im Rechtfertigungsgeschehen. Was die Reformatoren für die Soteriologie exponiert haben, wird unter den veränderten Bedingungen der Neuzeit nun zu einer Voraussetzung der Möglichkeit von Theologie überhaupt. Das hat zur Folge, dass Barth sich konsequenter als die Reformatoren gegen alle Formen einer „natürlichen Theologie“ wendet.
Was ist damit gemeint? Mit „natürlicher Theologie“ wird eine Theologie bezeichnet, die ihren Ausgang und ihre Perspektive in dem Bereich unmittelbar zugänglicher menschlicher Erfahrungen sucht. Indem es in der Neuzeit insbesondere die Geschichte ist, durch deren Gestaltung der Mensch sich selbst sein Selbstbewusstsein als tätiges Subjekt bestätigt – er ist es, der Geschichte schreibt –, steht die natürliche Theologie vorrangig für die geschichtsphilosophischen Horizonte, die der Theologie vonseiten der menschlichen Selbsteinschätzung gleichsam als ihr „natürlicher“ Entfaltungsraum vorgegeben werden. In weitesten Sinne kann gesagt werden: Natürliche Theologie ist nach Barth die Theologisierung eines bereits gegebenen und als solches auch anerkannten Selbst- und Wirklichkeitsbewusstseins, das unabhängig von den Orientierungen der Offenbarung zustande gekommen ist. Barth kritisiert die Inanspruchnahme des jeweiligen Selbstverständnisses des Menschen als fundamentalen Anknüpfungspunkt für die aus der Offenbarung zu gewinnenden Einsichten. Die theologische Würdigung und damit Überbewertung des Vorverständnisses kanalisiert und selektiert die Verstehensweise der Offenbarung, so dass im Resultat wiederum nur eine vom Vorverständnis geprägte Variante herauskommen kann. Wohlgemerkt bestreitet Barth weder die Gegebenheit eines Vorverständnisses noch seine prägende Kraft, von der wir uns nicht einfach abwenden können, aber er wehrt sich gegen seine theologische Anerkennung als Referenzrahmen für die von der Theologie zu bedenkenden Orientierungshorizonte und Fragestellungen.
Barth weist damit grundsätzlich die Inanspruchnahme der Möglichkeit ab, dass die Beziehung zu Gott zu einem Moment der menschlichen Selbstbestimmung werden kann. Er spricht von einer christlichen Adaption der durch die Erkenntnis vollzogenen Weltbemächtigung im Gefolge von Descartes, d. h. von einem „christlichen Cartesianismus“ (KD I/1, 224), wenn der Glaube zu einer Möglichkeit des Menschen wird, die seiner Entscheidungsfähigkeit so oder so anheimgestellt wird. Pointiert könnte man sagen, dass im Horizont der natürlichen Theologie die Theologie als eine dem Menschen mögliche Möglichkeit ausgegeben wird. Sie ist sich dabei nicht der Unmöglichkeit bewusst, in der ihr allein die Chance erwächst, ihrem lebendigen Gegenstand tatsächlich zu begegnen (vgl. Kap. I.6).
Immer wieder unterliegt der Mensch der Versuchung der „Domestizierung der Offenbarung“ (KD II/1, 155), in der die Wirklichkeit Gottes zwar nicht abgewiesen, aber eben in den eigenen Betrieb genommen wird, was dann unterm Strich aber als eine besonders subtile und respektlose Form der Abweisung zu bewerten ist. Tatsächlich geht es um nicht weniger als um die Sicherung des Vorrangs des Menschen gegenüber Gott. Die Domestizierung Gottes für die eigene Weltwahrnehmung sichert der natürlichen Theologie ihren Boden, dem seit dem 18. Jahrhundert ein fundamentaltheologischer Rang zugemessen worden ist.
Die Karriere der natürlichen Theologie ist für Barth schlicht die Kehrseite davon, dass dem Selbstbewusstsein des neuzeitlichen Menschen das Faktum der Sünde so grundsätzlich suspekt geworden ist. Gewiss bleibt einzuräumen, dass die natürliche Theologie tatsächlich so unvermeidlich wie die Sünde ist, aber sie ist eben auch ebenso wenig zu wollen oder gar zu fordern wie diese. Dazu muss sie aber zunächst als ein Problem erkannt und vergegenwärtigt werden. Es wäre eine Illusion zu meinen, dass sich die natürliche Theologie eliminieren ließe, aber die Theologie sollte sich über die von ihr ausgehenden Gefährdungen und Versuchungen stets bewusst sein, um ihr nicht selbst noch ausdrücklich einen Weg zu bahnen.
Die Theologie wird nicht auf der Seite Gottes, sondern von ebenso fehlbaren wie auch der Sünde unterworfenen Menschen betrieben und hat deshalb keinen Anlass, mit irgendwelchen exponierten Ansprüchen aufzutreten. Sie wird von Barth immer wieder an die Demut erinnert, in der sie allein eine verheißungsvolle Anstrengung werden kann. Weil sie sich nicht selbst rechtfertigen kann, bleibt sie ebenso wie der einzelne Mensch, seine Religion oder auch die Kirche auf die göttliche Rechtfertigung angewiesen. Immer wieder verweist Barth auf die offenkundig kaum akzeptabel zu vermittelnde Verlegenheit der Kirche, dass sie allen an sie gestellten Erwartungen entgegen weder über die Wahrheit verfügt noch die ‚Welt‘ mit irgendwelchen von ihr zu verwaltenden, vermeintlich immerwährenden Werten zu belehren vermag. Sie kann nur schlicht auf Gott und seinen sich auch heute bestätigenden Selbsterweis hinweisen.
Weitere Entfaltung und Vertiefung dieses Aspektes in Kap. III.2
6.Dialektische Theologie
These
Indem die Theologie als menschliche Anstrengung ein prinzipiell vorbehaltliches Unterfangen bleibt, kann sie ihrem Wesen nach nur eine dialektische Theologie sein. Bei aller Entschlossenheit zu klaren und verlässlichen Einsichten gehört auch eine eigens zu pflegende Umsicht zur Wahrnehmung ihrer Aufgabe, sich immer wieder auch selbst ins Wort zu fallen, ebenso wie die fundamentale Offenheit, sich immer wieder von neuen biblisch begründeten Einsichten infrage stellen zu lassen.
Im Horizont der von Barth zeitlebens hervorgehobenen prinzipiellen Vorbehaltlichkeit der Theologie liegt auch der Grund für den dialektischen Charakter des theologischen Denkens und Argumentierens, wie es sich bei Barth durchgängig finden lässt. Auch wenn die Bezeichnung „dialektische Theologie“ insbesondere den Herausgebern der Zeitschrift „Zwischen den Zeiten“ und ihren Sympathisanten bereits im Herbst 1922 „von irgendeinem Zuschauer angehängt worden“ war8, so hat Barth doch das spezifische Wahrheitsmoment dieser Bezeichnung ausdrücklich gewürdigt.9 Als solche trifft der Begriff „dialektische Theologie“ zunächst einerseits eine vor allem von Barth angestoßene theologische Richtung und andererseits eine für Barths eigenes Denken begrenzte Entwicklungsphase seiner Theologie in den 1920er Jahren.
Heute wird darüber hinaus zudem davon ausgegangen, dass Barth auch später in modifizierter Weise eine grundlegende dialektische Dimension in seiner Theologie bewahrt hat. Damit bleibt anerkannt, dass sich durchaus deutliche Änderungen in der Perspektive und auch im Blick auf den Begründungshorizont seiner Theologie im Laufe der Zeit ausmachen lassen, und zugleich wird unterstrichen, dass Barths Theologie bis in ihre späte Gestalt eine Theologie geblieben ist, die um ihren prinzipiell vorläufigen und vorbehaltlichen Charakter wusste. So kann bestenfalls zwischen zwei Phasen im Umgang mit der Dialektik der Theologie unterschieden werden, aber genau genommen nicht zwischen einer dialektischen und einer an der Analogie orientierten Phase.10 Ausdrücklich heißt es: „‚Analogie‘ bedeutet im Unterschied zu Gleichheit und Ungleichheit: Ähnlichkeit d. h. teilweise und darum die Gleichheit und Ungleichheit begrenzende Entsprechung und Übereinstimmung zwischen zwei oder mehreren verschiedenen Größen.“ (KD II/1, 254) Der Begriff der Analogie im Sinne Barths wäre also zutiefst missverstanden, wenn nicht auch das in ihm liegende dialektische Moment essentiell gewürdigt wird, weil bei aller erreichbaren Entsprechung niemals die auch bleibende Differenz aus dem Blickfeld verschwinden darf.
Entgegen aller Entschiedenheit, die seine Theologie gewiss ausstrahlen mag, ist Barth ein Theologe geblieben, der sich auch immer wieder selbst ins Wort fallen konnte. Barth wusste um die mit der Theologie auf der einen Seite unausweichlich verbundene Überforderung, die mit dem auf der anderen Seite nicht zu vermeidenden Anspruch verbunden bleibt, in der Theologie die Angemessenheit unseres menschlichen Redens von Gott am Maßstab des biblischen Zeugnisses einer kritischen Prüfung zu unterziehen. Zwar wird Gott auch im biblischen Zeugnis nicht greifbar, aber es steht unter der Verheißung, ihn doch immerhin so distinkt erkennbar machen zu können, dass dem Orientierungsbedürfnis des Glaubens ausreichend Genüge getan werden kann.
Für Barth steht die Anerkennung der Selbstmitteilung Gottes im Zentrum. Sie erschließt sich in seinem in Jesus Christus Mensch gewordenen Wort, d. h. in seinem sich im Christusgeschehen vollziehenden Handeln. Sie ermöglicht es dem Menschen, in bestimmter Weise von Gott zu reden. Auch wenn diese Ermöglichung über sein Fassungsvermögen und somit auch über seine Sprach- und Verstehensmöglichkeiten hinausgeht, wie sich besonders an dem entscheidenden Schlüssel des Geschehens, nämlich der Auferweckung Jesu zeigt, ist damit eine unerschöpfliche Ermöglichung menschlicher Gottesrede gegeben. Es ist also nach Barth die Offenbarung selbst, die aus der Unmöglichkeit menschlicher Gottesrede eine mögliche macht, ohne dass sie irgendwann zu einem Gegenstand seiner Möglichkeiten werden könnte.
In diesem Gefälle wird die Theologie zu einer von Gott ermöglichten Möglichkeit, die als solche immer wieder auf die Ermöglichung durch Gott angewiesen bleibt. Wenn Gott keine Möglichkeit des Menschen ist, kann es nur Gott selbst sein, der ein Reden über ihn ermöglichen und diesem Reden dann auch die nötige Erschließungskraft verleihen kann. Von den Möglichkeiten des Menschen aus gesehen bleibt dies eine Unmöglichkeit. Indem aber dem Menschen genau das ermöglicht wird, was ihm von sich aus unmöglich bleibt, soll hier im Blick auf Barths Verständnis der Theologie als von einer möglichen Unmöglichkeit gesprochen werden. Wenn Barth in seiner Dogmatik dann von der Sünde als einer unmöglichen Möglichkeit sprechen wird, kommt exakt die eigenwillige Nichtentsprechung zu der von Gott eröffneten Möglichkeit zur Sprache (vgl. Kap. IV.5.4).
Es kommt entscheidend darauf an, das dialektische Moment der Theologie zu bewahren. Ihre Ermöglichung bleibt auf Gott verwiesen, um dann aber tatsächlich zu einer allerdings nicht auf Dauer zu stellenden menschlichen Möglichkeit zu werden. Und zugleich stößt sie als diese dem Menschen ermöglichte Möglichkeit stets auch an die Grenzen seiner Möglichkeiten und erinnert ihn damit daran, dass sie als ermöglichte Möglichkeit niemals zu einer seiner Möglichkeiten werden kann und insofern eine Unmöglichkeit bleibt – Theologie ist eine mögliche Unmöglichkeit und muss deshalb grundsätzlich eine vorbehaltliche und vorläufige und in diesem Sinne dialektische Theologie bleiben.
Weitere Entfaltung und Vertiefung dieses Aspektes in Kap. III.
7.Der Horizont des einen Bundes
These
Die von der Theologie zu bedenkende Geschichte Gottes mit dem Menschen wird durch den Bund Gottes mit Israel und seiner menschheitlichen Erfüllung in Christus orientiert. Er ist verankert in der ewigen Gnadenwahl Gottes, in der sich Gott in seiner Freiheit dazu bestimmt, des Menschen Gott zu sein. Als solcher ist der Bund bereits Gegenstand der Gotteslehre und damit zugleich ein fundamentales Element im Bedenken ihrer materialtheologischen Distinktionen in Schöpfungs-, Versöhnungs- und Erlösungslehre.
Die gesamte Theologie Barths bewegt sich in dem Horizont der Geschichte, die sich in dem Bund Gottes mit den Menschen vollzieht. Der Bund ist der Rahmen und die Bühne aller theologischen Einlassungen, auch wenn er nicht in jedem einzelnen Aspekt ausdrücklich hervorgehoben wird. Er ist ebenso Ausdruck des Wesens Gottes wie der Ökonomie seines Handelns. Im Begriff des Bundes „vollendet sich der Begriff Gottes selbst“ (KD II/2, 564). Er intoniert das zentrale Thema der Theologie Barths, indem er einerseits der besondere Ausdruck der freien Selbstbindung Gottes ist, die im ewigen Entschluss seiner Gnadenwahl wurzelt, und andererseits den freien Lebensraum bezeichnet, in dem der Mensch seine besondere Bestimmung als Beziehungspartner Gottes leben kann. Es gehört zu dem besonderen Profil der Theologie Barths, dass sie sich unter Berufung auf das biblische Zeugnis durchgängig auf den Leitfaden des Bundes bezieht.
Schon in seinen Frühschriften greift Barth gern den Gottesnamen ‚Immanuel‘ auf: ‚Gott mit uns‘. Wie kein anderer annonciert dieser Name das besondere Verhältnis Gottes zum Menschen. Es ist dieser ‚Immanuel‘, der in besonderer Weise für Gottes freie Selbstbestimmung zum Stifter, Begleiter und Vollender des mit dem Bund bezeichneten spezifischen Beziehungsverhältnisses zum Menschen steht. In diesem Namen versammelt sich gleichsam das ganze Verheißungspotential, das grundsätzlich mit jedem Inerscheinungtreten Gottes verbunden ist. Die Vorrangigkeit des Bundes zeigt sich in der Bestimmung der Schöpfung als Ermöglichungsgrund des Bundes ebenso wie in dem Verständnis der Versöhnung als die Erfüllung des Bundes. Sowohl noetisch als auch ontisch ist er ein zentrales inhaltliches Regulativ für die Beschreibung der Entdeckungszusammenhänge theologischer Fragestellungen, die in ihm ihr spezifisches Stehvermögen im Gesamtzusammenhang der Theologie bekommen. Das ‚Gott mit uns‘ gilt für Barth „als Kern der christlichen Botschaft“ (KD IV/1, 3). Die Selbstcharakterisierung Gottes wird nicht durch einen Begriff angezeigt, sondern durch seinen Namen. Er steht sowohl für die Erkennbarkeit als auch für die Unverfügbarkeit Gottes, der auch in seiner Offenbarung verborgen bleibt.
So gewiss die Bibel unterschiedliche Bünde bezeugt und die Unterscheidung von einem alten und einem neuen Bund kennt, so werden doch alle Unterscheidungen von dem einen Bundeswillen Gottes umfasst, dessen Wurzeln in der ewigen Erwählung zu suchen sind. Barth spricht pointiert vom „Bogen des einen Bundes“ (KD II/2, 220). Von der Bundestreue Gottes bleibt auch die Erwählung Israels umfasst, so dass Barth in symbolträchtiger Weise anlässlich seines Papstbesuches 1966 die Beziehung zum Judentum als die eigentlich zentrale ökumenische Herausforderung hervorgehoben hat – eine Herausforderung, deren Reichweite bisher nur von wenigen in Ansätzen geahnt wird.
Die geheimnisvolle Namensoffenbarung Gottes am brennenden Dornbusch (Ex 3) erschließt sich in ihrer Tiefe in dieser gesamtbiblischen bundestheologischen Perspektive, in der Gott nicht durch seine absolute Macht, sondern durch seinen konsequenten Beziehungswillen charakterisiert wird. Barth schreibt Gott keine abstrakte Allmacht zu, die sich in irgendwelchen Demonstrationen ihrer prinzipiellen Überlegenheit ergeht. Das Streben nach einer solchen Allmacht, die vor allem sich selbst will, ist vielmehr ein Attribut des Teufels, von dem Barth als einer Personifizierung des Bösen allerdings nur sehr vorbehaltlich Gebrauch macht. Es ist die potentia, die willkürlich jeden Weg nutzt, sich in Szene zu setzen, und deshalb nur zu fürchten ist. Die Allmacht Gottes benennt Barth dagegen mit potestas. Es ist die Macht, die Gott dazu befähigt, das, was er will – und Gott will etwas Bestimmtes und nicht einen abstrakten Machtbeweis –, auch zu verwirklichen und durchzusetzen (KD II/1, 591 f). Gott will entschieden nicht unerreichbare Macht sein, der gegenüber dem Menschen nichts anderes bliebe, als sich zu fürchten, sondern sein freier Wille weist auf den Bund und den erwählten Partner des Bundes, auf die Beziehung zu dem von ihm darin ihm selbst ähnlich geschaffenen Menschen (Gen 1,26 f), dass er beziehungsfähig ist und nun seinerseits auf die Zuwendung Gottes eine eigene freie Antwort geben kann. Es ist diese gewiss asymmetrische und dennoch ganz und gar gegenseitige Beziehung, auf die der Wille Gottes zielt und für die Gott dann auch alles macht (Allmacht), die sowohl die Bestimmung als auch die Geschichte des Bundes ausmacht.
Damit ist die prägende Perspektive benannt, in der sich die Geschichte vollzieht. Auf Grund der permanenten Nichtentsprechung des Menschen zu der ihm von Gott verliehenen herausgehobenen Würde ist diese Geschichte allerdings de facto von einer Dramatik gekennzeichnet, in der unentwegt die Orientierungen durcheinandergehen. Diese Geschichte des Bundes und das sich in ihm vollziehende Geschehen, in dem sich der Mensch immer bereits so oder so befindet, ist der Horizont, der von der Theologie in den Blick zu nehmen ist. Eine unbeteiligte Betrachtung kann hier nicht in Frage kommen, sondern sie wird sich stets dazu herausgefordert sehen, sich in diesem Geschehen zu positionieren. Auch dort, wo sie dies in Verkennung ihrer Aufgabe unterlässt, positioniert sie sich unwillkürlich, dann allerdings in problematischer Weise.
Als durchlaufendes Thema kommt der Bund in allen inhaltlichen Perspektiven immer wieder vor; vgl. Kap. IV.3, IV.4 und IV.5.11
8.Die Menschlichkeit Gottes
These
So wie die freie Selbstbestimmung Gottes zu seiner unverbrüchlichen Menschlichkeit in seiner ewigen Gnadenwahl als die Summe des Evangeliums zu betrachten ist, so steht in der Mitte des Evangeliums die Versöhnung des Menschen mit Gott und damit die Wiederherstellung der ein erfülltes Leben ausmachenden Beziehung des Menschen zu Gott und zu seinen Mitmenschen.
Wenn Barth bisweilen vorgeworfen wird, er habe sich in seiner Theologie vor allem um Gott gekümmert und dabei den Menschen vergessen, wird vor allem anderen, was es dazu noch zu sagen gäbe, übersehen, dass er wie kein anderer die unerschütterliche Menschlichkeit Gottes im Zentrum des christlichen Gottesverständnisses verankert sieht. Es gibt keine Wahrnehmung Gottes ohne die Wahrnehmung seiner Menschlichkeit und damit seiner auf Antwort ausgerichteten Beziehung zum Menschen. Der von Gott aus betrachtete Mensch erscheint dabei nicht nur als Adressat der Zuwendung Gottes, sondern als das freie Gegenüber Gottes, durch das die von Gott angestrebte und ermöglichte Beziehung erst tatsächlich zustande kommen kann. Barth kann pointiert vom Menschen als Partner Gottes sprechen (KD III/2, 207 u. ö.). Die Entschlossenheit und Konsequenz des Eintretens Gottes für den Menschen wird nicht nur als die Mitte der Geschichte seiner Beziehung zum Menschen thematisiert, sondern insofern auch als die „Summe des Evangeliums“ (KD II/2,1) bezeichnet, als diese Mitte auch ganz und gar der freien Selbstbestimmung Gottes in seiner ewigen Gnadenwahl entspricht. Man geht kaum zu weit, wenn man sagt, dass Gott sich selbst gleichsam durch seine Menschlichkeit definiert wissen will.
Barth distanziert sich mit diesem Akzent allerdings deutlich von allen theologischen Konzepten, die mehr oder weniger vollständig von der Frage geprägt sind, welchen Nutzen der Mensch aus der Wahrnehmung Gottes für sich verbuchen kann. Natürlich wird niemand diese Frage so direkt stellen, aber es ist doch überaus verbreitet, dass die Theologie und auch die Kirche vorrangig damit beschäftigt sind, den Gewinn herauszustreichen, der dem Menschen aus der Wahrnehmung Gottes für sich verbuchen kann. Bis hinein in die neueren Kirchenlieder wird Gott ständig und einigermaßen hemmungslos von den unterstellten Bedürfnisprofilen des mehr oder weniger um seine Frömmigkeit kreisenden Menschen aus in den Blick genommen. Und so erscheint Gott in der kirchlichen Spiritualität unentwegt als eine nach allen Seiten offenstehende Ressource für die Aufrichtung und Stärkung des ansonsten im Grunde recht selbstgewissen Menschen, der um dieser göttlichen Unterstützung willen bereit ist, seine Bedürftigkeit einzuräumen.
Natürlich kann die Luther zugeschriebene Frage „Wie bekomme ich einen gnädigen Gott?“ eine berechtigte Frage sein, aber da, wo sie den Ausgangspunkt und dann auch noch den ganzen Orientierungshorizont der Theologie beansprucht, wird wohl von einer problematischen Reduktion der Theologie auf die Soteriologie zu reden sein, die nicht nur der Religionskritik eine kaum abzuweisende Einladung anbietet, sondern auch auf kaum mehr als einen heilsegoistisch gerupften Gott verweisen kann. Wenn Barth diese utilitaristisch-anthropologische Dressur Gottes nicht mitmacht, heißt dies noch lange nicht, dass es in seiner Theologie nichts Bedenkenswertes über den Menschen zu lesen gäbe. Eher ist das Gegenteil der Fall, denn Barth verlässt konsequent die wehleidige oder stolze Ebene der permanenten Selbstthematisierung des Menschen, in dem dann auch Gott hier und da eine entsprechende Betätigungsmöglichkeit eingeräumt wird. Stattdessen konzentriert er sich auf die freie Zuwendung Gottes zum Menschen, die für diesen vor allem als eine Befreiung aus der Gefangenschaft in den stets nur wenig belastbaren und de facto flatterhaften Selbstdefinitionen zu verstehen ist.
Die Radikalität, in der Barth über die Soteriologie hinaus die Menschlichkeit Gottes und von da aus dann auch die Menschlichkeit des Menschen betrachtet, zeigt sich in nichts deutlicher als darin, dass er sie in dem ewigen Gnadenratschluss Gottes verankert sieht. Seine Neufassung der Prädestinationslehre bzw. der Erwählungslehre betritt gegenüber der bisherigen Tradition vollkommen neues Gelände. Er schert aus der Linie aus, nach welcher der Erwählung eines Teils der Menschen die Verwerfung des anderen entspricht, und hebt die ausnahmslose Erwählung des Menschen hervor, deren Risiko Gott ganz und gar auf seine Seite übernommen hat. Es ist Gott selbst, der in seiner barmherzigen Gerechtigkeit die Verwerfung, die seiner Erwählung entspricht, ganz und gar seinem eigenen trinitarischen Leben anlastet. Im Blick auf den Menschen ist konsequent allein von seiner Erwählung zu sprechen. Damit steht die Soteriologie bei Barth zwar nicht einfach in einer zwingenden Konsequenz zu den erwählungstheologischen Pointen seiner Gotteslehre, wohl aber in einem sachlichen Orientierungshorizont, der ihr auch den letzten Rest eines kontingent schicksalshaften Beigeschmacks nimmt. Bei Barth ist die Menschlichkeit Gottes so sehr mit seinem Wesen verknüpft, dass sie nur durch die Verleugnung Gottes in Abrede gestellt werden kann. Und umgekehrt heißt das: wo von Gott die Rede ist, wird die Angemessenheit dieser Rede daran zu bemessen sein, in welcher Weise sie von der Menschlichkeit geprägt ist, in der es Gott gefallen hat, sich in seiner Beziehung zum Menschen vorzustellen.
Gott ist so wesenhaft mit seiner Menschlichkeit verbunden, dass sie für Barth eine Absage an einen „Deus absconditus“ – an einen „verborgenen Gott“ mit einer möglicherweise dunklen Seite Gottes – insofern überflüssig macht, als eine solche Absage, wie sie etwa von Luther ausgesprochen wird (vgl. dazu KD II/1, 608 ff), nur dann sinnvoll ist, wenn mit einer solchen anderen Seite des verborgenen Gott irgendwie gerechnet wird. Aber hinter der Offenbarung Gottes bleibt „kein verborgener Gott, kein Deus absconditus […] zurück, mit dessen Existenz und Wirksamkeit wir dann über sein Wort und seinen Geist hinaus gelegentlich auch noch zu rechnen, den wir hinter seiner Offenbarung auch noch zu fürchten und zu verehren hätten.“ (236 f)
Weitere Entfaltung und Vertiefung dieses Aspektes in vgl. Kap. IV.3.2 u. IV.4.3.
9.Das Nichtige und die Sünde
These
Wenn in gebotener Weise eine dualistische Weltwahrnehmung vermieden werden soll, kann das Übel ebensowenig wie die Sünde als eine Gegenmacht Gottes verstanden werden. Zugleich muss ausgeschlossen bleiben, dass sie unmittelbar als Ausdruck des Willens Gottes verstanden werden. Sie bleiben in ihrem Ursprung unableitbar und führen hinsichtlich des Willens Gottes das vor Augen, was Gott nicht will, so dass sie nur mit ihrer Überwindung zu rechnen haben.
Die soeben betonte Abweisung eines Deus absconditus bleibt auch dann zu betonen, wenn theologisch einzuräumen bleibt, dass wir nicht darum herumkommen, selbst das Böse in irgendeiner Beziehung zu Gott zu verstehen, wenn anders es unvermeidlich in ein Gegenüber zu Gott gerät, wo es dann als eine Art Gegenspieler anzuerkennen wäre. Auch wenn sich hier und da versprengte dualistische Motive in der biblischen Tradition ausmachen lassen, kann es keinem Zweifel unterstehen, dass es gerade ein Kennzeichen der überlegenen Souveränität des hier bezeugten Gottes ist, dass er keiner Bewährung in einem antagonistischen Dualismus von Gut und Böse ausgesetzt ist. Er ist darin der Souverän, dass es keinen wirklich zu befürchtenden Gegenspieler zu erwarten gibt, so wie er sich darin als der Schöpfer erweist, dass er die Welt aus dem Chaos der Urflut hervorruft und damit die von ihm ausgehende Bedrohung zurückdrängt, um dem Leben den benötigten verlässlichen Entfaltungsraum zu bereiten (Gen 1). Und es ist genau diese von Gott zu bekennende Souveränität, die unweigerlich seinem Verstehen das Problem einträgt, dass es nun außer Gott selbst keine haftpflichtige Zuschreibungsmöglichkeit mehr gibt, der nun die Übel und das Böse zugewiesen werden könnten. Auch als das Zurückgewiesene, das nicht zum Werk der Schöpfung gehört, bleiben sie mit einem nicht ableitbaren Bedrohungspotenzial präsent, so dass unweigerlich auf die Souveränität Gottes ein Schatten zu fallen scheint.
In der Neuzeit ist aus diesem Umstand die sogenannte Theodizeefrage erwachsen, die sich nicht mehr mit der (Gottes-)Antwort des Hiobbuches zufriedengibt (Hi 38–40) und für die Rechtfertigung Gottes eine stringent nachvollziehbare Antwort einfordert. Alle philosophischen Versuche, eine plausible Lösung für dieses Dilemma zu finden, können als gescheitert gelten.12 Die Theologie sollte nicht versuchen, mit den philosophischen Konzepten konkurrieren zu wollen. Für Barth kann nur eine Perspektive in Frage kommen, die einerseits dem Konflikt nicht seine Ernsthaftigkeit nimmt und sich andererseits von dem Problem auch nicht übermäßig beeindrucken lässt, weil damit dann zugleich auch demjenigen das Wort abgeschnitten würde, der als Einziger den hier nötigen Widerspruch einlegen könnte. Wenn Barth damit argumentiert, dass durch das von Gott nicht Gewollte noch einmal ein besonderes Licht auf das von ihm Gewollte fällt, so darf dies nicht als eine intellektuelle Notlösung missverstanden werden. Vielmehr will Barth mit dieser Zuspitzung einmal mehr unterstreichen, dass es theologisch nicht aussichtsreich sein kann, jenseits des Bekenntnisses zu der Unerschütterlichkeit der Menschlichkeit Gottes nach einer Lösung Ausschau zu halten, weil sich das Böse einer rationalen Erklärung entzieht. Er spricht hier von dem Nichtigen, das gleichsam die unbegreifliche Seinsform (!) des Nichtseins in das Sein einträgt – ein durchaus mehrschichtiges Konzept.13 Damit soll keineswegs – wie ihm immer wieder unterstellt wird – die Brisanz der Herausforderung ermäßigt, wohl aber das Gewicht des im Glauben zu sprechenden Bekenntnisses noch einmal klar unterstrichen werden.
Es ist ein eigenes Thema, wenn es in diesem Zusammenhang auch von der Sünde zu sprechen gilt. Während die Neuzeit dem Bösen eine bis dahin beispiellose Reverenz erweist und sich durchaus einigermaßen leichtsinnig bereit zeigt, ihm gleichsam Gott zu opfern, spielt sie auf der anderen Seite die Bedeutung der Sünde des Menschen zu dem Eingeständnis seiner – zumindest vorläufig noch – einzuräumenden Unvollkommenheit herunter. Der neuzeitliche Mensch verlässt sich zunehmend rückhaltlos auf die ihm vermeintlich schöpfungsmäßig garantierte Gottebenbildlichkeit,14 in der er zwar überaus selbstbewusst meint, Gott mehr oder weniger alle Arbeit abnehmen zu können, ohne aber auch noch bemerken zu wollen, dass er ihm gerade damit – im Grunde immer schon – ganz besonders zu schaffen macht. Der sich mit seinen vermeintlichen Stärken Gott gegenüber behauptende Mensch, der sich der Welt nun seinerseits als Schöpfer zu präsentieren bemüht, präsentiert in nichts anderem unverschämter sein Sündersein als genau in seiner Leugnung der Sünde und der Zurückweisung der Gnade Gottes, in der er eine unnötige göttliche Überversorgung unterstellt. Die Sündenvergessenheit verhindert die Wahrnehmung der tatsächlichen Heillosigkeit sowohl der vom Menschen in seine Regie genommenen Welt als auch der eigenen Situation und lässt damit den hoffnungslosen circulus vitiosus unentdeckt, in den sich der Mensch immer tiefer verstrickt.
Die Sünde bezeichnet kein moralisches Versagen, sondern den Unglauben bzw. das Misstrauen Gott gegenüber. Besonders hinter dem Pathos der Moral kann sich eine resistente Erscheinungsweise der Sünde verbergen, gerade dann, wenn sich die Einhaltung der Moral als gottgefällig und hoffnungsvoll präsentiert. Barth unterscheidet drei Gestalten der Sünde, die er genau als die Gegenbewegungen zu den Bewegungen versteht, welche die heilsame Zuwendung Gottes zum Menschen ausmachen. Zum einen ist dies der Hochmut, in dem sich der Mensch gegen die Selbsterniedrigung Gottes in seiner bis in die Tiefe des Leidens und Sterbens reichende Menschwerdung stemmt. Der hochmütige Mensch zelebriert den ebenso unermüdlichen wie tatsächlich erfolglosen Beweis, mit dem er vorgibt, sich dadurch rechtfertigen zu können, dass er alles für sich Notwendige und für die Welt Erforderliche aus eigener Kraft zu bewerkstelligen vermag. Er versucht zu demonstrieren, dass es ausreicht, wenn er selbst für sich eintritt. Und so ist er tatsächlich für sich selbst, ohne aber zu realisieren, dass dies nur funktionieren kann, wenn er auch für die Anderen ist. Obwohl die Folgen davon offensichtlich sind, beklagt er vor allem die Uneinsichtigkeit der Anderen, ohne zu bemerken, dass die zerstörerische Dynamik des aufgeführten Risikospiels in der zum Prinzip erhobenen Vorrangigkeit der Selbstsorge seine Wurzeln hat. Zum zweiten hat die Sünde die Gestalt der Trägheit, mit der sich der Mensch gegen seine mit dem Kreuz Christi vollzogene Aufrichtung stellt. Er duckt sich immer genau dann weg, wenn es darum geht, aufgrund des erkannten Elends das Ruder in eine bessere Richtung auszurichten. Und so taumelt das unheilvolle Geschehen beinahe an allen sich anbietenden Auswegen achtlos vorbei, weil der Mensch sich ausgerechnet da und dann auf seine Ohnmacht besinnt, wo und wenn er gefragt wird, die ihm zur Verfügung stehenden Möglichkeiten wirksam zum Einsatz kommen zu lassen. Schließlich ist die dritte Gestalt der Sünde die Unaufrichtigkeit, in der sich der Mensch seine Lage schönredet und für jede neue Schandtat rationale Legitimationen erdenkt, mit denen er möglichst unbehelligt seiner Eigenwilligkeit den Weg weiterhin freizuhalten versucht. Die perfekte Lüge verkleidet sich immer mit dem Anschein einer Wahrheit, so dass sie auf ihren kurzen Beinen in der Regel doch recht weit zu kommen scheint, wenn auch nicht tatsächlich. Barth nennt diese dritte Gestalt der Sünde die spezifisch christliche Gestalt der Sünde, weil ihr Skandal nur da in die Augen sticht, wo sich bereits die Wahrheit der Rettung und der Hoffnung vernehmbar gemacht hat und macht, wie es eben in der christlichen Gemeinde der Fall ist. Indem die Kirche aber, anstatt die lebendige Selbstbezeugung Jesu zu verkünden, dieses Zeugnis nach ihren eigenen Bedarfslagen oder den unterstellten Bedarfslagen der von ihr zu adressierenden Welt domestiziert, kehrt sie ihrer Berufung und damit auch sich selbst den Rücken zu.
Weitere Entfaltung und Vertiefung dieses Aspektes in Kap. IV.4.4.4 u. IV.5.4.
10. Theologie der Freiheit
These
So wie der Mensch durch die Abkehr von Gott wie der Zauberlehrling nicht aus der Gefangenschaft der von ihm nun gerufenen Geister entkommen kann, wird ihm durch Kreuz und Auferstehung Christi genau die Freiheit restituiert, die er durch die Hybris seiner Selbsterhebung verspielt hat, nämlich die Freiheit, sein Leben aus dem Vertrauen zu Gott zu empfangen und als Antwort auf seine Zuwendung gestalten zu können. In diesem Sinne ist Freiheit der Begründungshorizont christlicher Existenz.
Auch wenn sich Barth dagegen gewehrt hat, die Freiheit zum einzigen Leitbegriff des christlichen Lebens zu erheben,15 bleibt sie doch die entscheidende Bestimmung zu seiner Begründung. Auch wenn es für die konkrete Gestaltung des christlichen Lebens nicht ausreicht, sich unablässig auf seine Freiheit zu berufen, bleibt sie doch die Grundbestimmung, aus der dann auch weitere Bestimmungen zu seiner Gestaltung erwachsen können, die sich dann immer auch als Ausdruckformen der grundlegenden Freiheit verstehen lassen. Es wird allerdings entscheidend darauf ankommen, was unter dieser Freiheit verstanden wird.
Eine Möglichkeit des Verstehens kann von vornherein ausgeschlossen werden. Die Freiheit würde sich unversehens gegen sich selbst kehren, wollte man sie als Beliebigkeit oder gar als Willkür verstehen. Wenn sie nicht zu einer wirklichkeitsfremden Illusion verkümmern will, gilt es ein Augenmaß dafür zu entwickeln, in welche Richtung sie gedeihen kann und aus welcher Richtung ihr Gefahren oder gar ihre Stilllegung erwachsen können. Indem sie im Bund Gottes mit dem Menschen begründet ist, wird der Raum dieses Bundes als ihr Betätigungshorizont zu erkennen sein, in dem ihrer Ermöglichung auch eine Bestimmung zugewiesen wird. Der Bund steht für den Wirklichkeitshorizont, in dem sich das Leben durch die Freiheit beflügeln lassen darf und somit lebendig halten kann. Es lässt sich auch so ausdrücken: Die Beziehungen, in denen das Leben zu seiner Bedeutung durchfindet, müssen nicht erst gefunden und zum Leben erweckt oder gar überhaupt erst erfunden werden, sondern sie sind bereits vital, sprechen uns immer schon an und müssen nur wahrgenommen und aufgegriffen werden, damit sie auch in unserem Leben ihre lebendige Bedeutung entfalten können. Das gilt ebenso für die Beziehung zu Gott als auch für diejenige zu den Mitmenschen, denen der Mensch in seiner Freiheit, in der er vor allem von der Sorge um sich selbst befreit, tatsächlich Mitmensch sein kann. Freiheit kann sich hier konsequent als selbständiges Antworten, als eigenständige Reaktion und kreative Mitgestaltung verstehen. Das Entscheidende ist, dass weder Gott noch der Mitmensch als Begrenzung meiner Freiheit verstanden werden, weil sich meine Freiheit nicht als die Freiheit der Selbstverwirklichung in Konkurrenz zu ihrer Freiheit versteht, sondern Gott und Mitmensch geben ihr eine Bestimmung, durch die sie erst recht zum Leben erweckt wird und die ihr damit eine eigene Erfüllung verheißen.
Barth spricht von dem „Geschenk der Freiheit“16 und stellt sie damit jeder Vorstellung von Freiheit gegenüber, zu der erst durch einen Akt der Selbstbefreiung zu gelangen ist. In theologischem Verständnis ist Freiheit weder das Resultat einer bestimmten Aktion des Menschen oder eine in Aussicht gestellte Möglichkeit, die ganze bestimmte Bedingungen formuliert, wie zu ihr zu gelangen ist. Schon gar nicht ist sie ein Postulat der praktischen Vernunft, das zwingend erforderlich ist, um den ethischen Charakter der moralischen Pflicht nicht preisgeben zu müssen,17 sondern eine essenzielle Bestimmung des Menschen, der als Geschöpf Gottes zu einer lebendigen Beziehung mit seinem Schöpfer und seinem Mitmenschen erschaffen ist. Streng genommen kann nur eine geschenkte Freiheit tatsächlich Freiheit sein, weil sich jede andere durch die Nötigung, zu ihrer Ermöglichung erst bestimmte Bedingungen erfüllen zu müssen, von vornherein in einem nicht auflösbaren Widerspruch zu sich selbst befindet. Nur eine geschenkte Freiheit befreit von den Zwängen der Selbstbefreiung und entlässt aus der Nötigung unablässiger Selbstverteidigung.18 Sie konstituiert sich bereits in der Wahrnehmung ihrer Zueignung und wird bewahrt im Vollzug der mit ihr einhergehenden Ermöglichungen, so wie sie in der Abkehr von der sie aufrichtenden Quelle unversehens zum Erliegen kommt, weil sie in den Horizont eines Zwecks gezwängt wird, der nicht mehr sie selbst ist. Ein wenig paradox gewendet kann im Sinne Barths gesagt werden, dass die Freiheit nur da der Knechtschaft irgendwelcher Gesetze entnommen ist, wo das Evangelium das Gesetz der Freiheit ist.
Die hier angesprochene Selbstzwecklichkeit der Freiheit wäre allerdings missverstanden, wenn sie einen richtungslosen und somit leeren Freiheitsbegriff im Visier hätte, denn dieser gerät früher oder später ebenfalls genau in den benannten Widerspruch. Wenn Barth von einer durch Gott qualifizierten Freiheit spricht, grenzt er sich deutlich von einer Wahlfreiheit ab, in welcher der Mensch immer wieder wie Herkules am Scheideweg vor eine sein Schicksal entscheidende Wahl gestellt wird (KD III/1, 301). Ebenso ist es auch keine Freiheit, die uns gleichsam zur Wahl gestellt wird. Wo sich der Mensch vor die Frage gestellt sieht, sich für sie oder gegen sie entscheiden zu sollen, so als könne es auch eine andere jenseits von ihr geben, hat er sich bereits gegen sie gestellt (KD IV/1, 834), weil sie nicht als eine seiner Möglichkeiten in Erscheinung tritt, sondern als die wirkliche Wahrheit und die wahre Wirklichkeit Gottes, der nur in befreiter Anerkennung entsprochen werden kann (oder besser gesagt: der schlicht in befreiter Anerkennung entsprochen werden darf). Das macht ja erst die positive Qualifikation dieses Freiheitsverständnisses aus, dass mit der Freiheit nicht mehr das Schicksal des Menschen auf dem Spiel steht, was doch nur zeigen würde, dass sie nicht tatsächlich frei ist. Die Wahl ist nicht die entscheidende Signatur der Freiheit, zumal auch dem unfreien Menschen nicht einfach abgesprochen werden kann, dass er wählen könne.
Es lässt sich kaum sinnvoll als ein Ausdruck echter Freiheit ausgeben, dass sich der Mensch in seinem Eigensinn auch immer wieder vor die ihn gefährdende Möglichkeit gestellt sieht, dem Raum der von Gott eröffneten Freiheit den Rücken zu kehren in der doch so unbesonnenen Hoffnung, sich am Ende als Schmied des eigenen Glückes feiern zu können. Die Sünde ist nicht, wie es etwa vom emanzipatorischen Idealismus im 19. Jahrhundert gerne angenommen wurde, Ausdruck der Freiheit eines nun endlich zu sich findenden Menschen, sondern die ebenso misstrauische wie wohl auch ahnungslose Stilllegung der Freiheit, durch die er unweigerlich den Gesetzen der Selbstkonstitution verfällt, die ihm früher oder später seine tatsächliche Gefangenschaft vor Augen führen werden (KD IV/2, 559 f). Wenn die Freiheit im von Gott ermöglichten Vertrauen in seinen Bund begründet ist, kann sie nicht zugleich ausgerechnet auch noch für das gegen Gott gerichtete Misstrauen in Anspruch genommen werden. So wie sie in der Treue Gottes ihren Grund hat, kann sie auch nur in der darauf antwortenden Treue des Menschen gelebt werden; Barth spricht dann gern und regelmäßig vom freien Gehorsam, was sich heute nicht mehr ohne weiteres verständlich machen lässt, aber er hat dabei eben diese vertrauensvolle Treue zu Gott im Blick.
Weitere Entfaltung und Vertiefung dieses Aspektes in Kap. IV.4.5.
11. Dogmatik und Ethik
These
Wie schon bei Calvin ist auch bei Barth die Perspektive der Theologie nicht nur auf die Rechtfertigung des Menschen und seines Lebens, sondern konsequent noch einen Schritt weiter auf deren Heiligung ausgerichtet. So wie es das ethische Versagen von Theologie und Kirche angesichts des Ersten Weltkriegs war, von dem sich Barth zu einer grundsätzlichen Neubesinnung der Theologie genötigt sah, so zielt seine theologische Arbeit stets auf die konkrete Gestalt des christlichen Lebens, d. h. Dogmatik und Ethik gehören für ihn immer unauflöslich zusammen.
Die genuine Verquickung von Dogmatik und Ethik gehört zu den Charakteristika seiner Theologie. Damit wird eine Fundamentalentscheidung seiner Theologie angesprochen, die unterschiedliche Orientierungsebenen hat, welche aber nicht auseinandergerissen werden dürfen.
Für das Verständnis der Dogmatik gilt, dass sie als kritisches Reflexionsorgan kirchlicher Praxis nicht nur ihre Aufgabenstellung aus dem Leben der Kirche bezieht, sondern auch mit ihren Resultaten und Perspektiven auf das Leben der Kirche im Horizont ihrer jeweiligen Lebensumstände und den aus ihnen resultierenden Versuchungen zielt. Indem das Leben der Kirche insbesondere in seiner verkündigenden Gestalt die Notwendigkeit einer kritischen Theologie herausfordert, bleibt es auch das christliche Leben, auf das sie mit ihren Bemühungen ausgerichtet ist. Die von Barth betonte Kontextualität der Theologie als die von ihr zu fordernde Pünktlichkeit („Bibel und Zeitung“) drängt sie einerseits zu einer erkennbaren Konkretheit, wie sie andererseits zugleich vor unangemessenen Generalisierungen warnt, die in der Regel mit unverbindlichen Abstraktionen verbunden sind. Wenn Barth entschlossen den bekennenden Aspekt der Kirche ins Zentrum rückt, wird dieser Lebens- und Verantwortungsaspekt unterstrichen.
Es ist vor allem die sachliche Umkehrung der lutherischen Grundunterscheidung von Gesetz und Evangelium, welche die pointierte Stoßrichtung Barths deutlich erkennbar macht. An die Stelle des lutherischen Gegensatzpaares tritt die als Komplementärfigur zu verstehende Horizontbestimmung der Theologie als Evangelium und Gesetz (Gebot). Dabei hebt Barth die Komplementarität von Inhalt und Form hervor, die wohl unterschieden, aber niemals voneinander getrennt werden können. So wie das Evangelium der Inhalt des Gesetzes ist, bleibt das Gesetz die Form des Evangeliums.19
Es kann deshalb auch nicht verwundern, wenn die Grundlegung der Ethik bereits in der für Barth besonders bedeutungsvollen Erwählungslehre reflektiert wird (KD II/2). Die Lebensrelevanz der Theologie zeigt sich darin, dass es in ihr keinen Inhalt gibt, dessen hinreichende Erfassung nicht auch in irgendeiner Weise den Bereich tangiert, der mit dem Begriff Ethik allerdings nur sehr unzureichend etikettiert wird. Barth übernimmt nicht einfach ein Konzept der Ethik, das er dann in seine Kirchliche Dogmatik implementiert, sondern er versieht seine dogmatischen Überlegungen von vornherein mit einer Reichweite, die bis in die Gestaltung des christlichen Lebens hineinreicht. Da es in allem, was die Theologie zu reflektieren hat, um Beziehungsverhältnisse Gottes zum Menschen geht, betrifft es auch immer zugleich die Beziehung des Menschen zu Gott ebenso wie die Beziehung zum Mitmenschen. Es geht also nicht um eine zweite Fragestellung, sondern allein um das Ausziehen der dogmatischen Reflexion bis hinein in das christliche Leben, wofür Barth dann die traditionelle Bezeichnung Ethik verwendet.
Von dieser fundamentaltheologischen Ebene bleibt die praktisch-theologische Ebene zu unterscheiden, wo es dann auch zu konkreten Entscheidungen und Stellungnahmen kommt, die für Barth auch stets eine wichtige Bedeutung gehabt haben.20 Viele seiner öffentlichen Stellungnahmen sind äußerst kontrovers aufgenommen worden. Gewiss sind sie ebenso wenig unfehlbar wie auch alle anderen Überlegungen und Zuspitzungen Barths, aber es bleibt wahrzunehmen, dass Barth nicht ohne Nachdruck darauf hingewiesen hat, dass er auch diese Äußerungen stets in einer unmittelbaren Beziehung zu dem verstanden wissen wollte, was ihn sonst in der Theologie bewegt und orientiert hat. Gewiss bleibt zwischen den theologischen Zuspitzungen und den politischen Konkretionen immer auch Hiatus, der schon durch die jeweils zu Rate gezogenen unterschiedlichen Informationsstände offenkundig wird. Insofern kann hier in den meisten Fällen nicht nur eine Option als die einzig richtige angesehen werden. Es bleibt aber zu beachten, dass Barth auch den politischen Bereich nicht als einen eigengesetzlichen Bereich gesehen hat, in dem dann auch andere Dynamiken zu akzeptieren seien. Vielmehr kann es in allen konkreten Lebensfragen keine anders orientierte Freiheit als die Freiheit des Glaubens mit ihren besonderen Orientierungen geben. Es kann schließlich nicht überraschend sein, dass es Barth in seinen Positionierungen in der Regel weniger um die Anwendung von bereits ausgefeilten ethischen Überlegungen, sondern um die Konsequenzen aus als fundamental apostrophierten dogmatischen Einsichten gegangen ist. Es war vor allem das Ernstnehmen der Auferstehung und damit der lebendigen Gegenwart Christi, auf die sich Barth nicht nur in seinen Ermutigungen zu einem entschlossenen Kampf gegen den Nationalsozialismus als unabweislichen Grund dafür berief, dass die Kirche nicht einfach unbeteiligt dem sich vor ihren Augen abspielenden Drama zusehen könne.
Weitere Entfaltung und Vertiefung dieses Aspektes in Kap. II.7, IV.4.3, IV.5.7, V.3 u. V.6.
12. Ökumene und weltweite Solidarität
These
Auch wenn Barth die sich in seiner Zeit formierende ökumenische Bewegung mit nur kurzer Unterbrechung vor allem skeptisch beurteilte, kann nach seinem Verständnis rechte Theologie immer nur ökumenische Theologie, d. h. eine auf die ganze Gemeinde ausgerichtete Theologie sein. Barths Theologie ist dann auch insofern zu einem ökumenischen Ereignis geworden, als sie zu den wenigen Theologien gerechnet werden kann, die bis heute eine ökumenische Beachtung gefunden haben.
Aus dem reformatorischen Umfeld verfügt kaum eine andere Theologie des 20. Jahrhunderts über eine vergleichsweise hohe ökumenische Wahrnehmung und Anschlussfähigkeit wie die von Karl Barth. Vermutlich ist es allein Dietrich Bonhoeffer, dem eine vergleichbare Beachtung und Wirkung zugeschrieben werden kann. Das gilt auch hinsichtlich der unterschiedlichen Dimensionen, die mit dem Begriff der Ökumene verbunden sind. Grob gesprochen steht die Ökumene einerseits für die unterschiedlichen Ebenen zwischenkirchlicher und interkonfessioneller Verständigung und andererseits für die mit ihrer weltweiten Ausbreitung verbundene Verantwortung der Kirche. Zwar hat sich Barth nur sehr zurückhaltend zu der ökumenischen Bewegung verhalten und das Thema der Ökumene explizit nur wenig bearbeitet, aber faktisch kommt ihr sowohl im Blick auf die Dialog-Ökumene als auch die Verantwortungsökumene eine überaus große Bedeutung zu.21
Ein Grund für die hohe Akzeptanz, die Barths Theologie in der Ökumene genießt, mag gerade darin liegen, dass sie sich weder einem ökumenischen Programm verschreibt noch eine bestimmte ökumenische Vision verfolgt und sich damit weder in einer umstrittenen Gemengelage auf eine der gegeneinander stehenden Seiten schlägt noch einer bestimmten ökumenischen Stimmungslage zu entsprechen versucht. Es hat sich gezeigt, wie schnell sich in der Ökumene Stimmungslagen und damit ökumenische Bewertungen verändern können, so dass theologische Konzepte, die sich eng an die konkrete historische Bewegung der Ökumene anlehnen, eben auch ihrem Akzeptanzverlauf unterworfen sind.
Es hat sich gezeigt, dass die Theologien, die ausdrücklich ökumenisch sein wollen, wie etwa die von Jürgen Moltmann, oder die darüber hinaus sogar interreligiös perspektiviert sind, wie die von Hans-Martin Barth, vor allem das Gespräch in der eigenen Konfession anregen und bestenfalls noch diejenigen in den anderen Konfessionen erreichen, die aus der Perspektive ihrer jeweiligen eigenen Tradition heraus ebenfalls eine auf die Ökumene zentrierte Theologie vertreten. Jürgen Moltmann gehört zweifellos zu den weltweit am meisten wahrgenommenen Theologen, aber es sind vor allem die weit gestreuten verschiedenen reformatorischen theologischen Traditionen, die sich von ihm zu einer von ihrer eigenen Tradition ausgehenden ökumenischen Vision anregen lassen. Darin liegt zweifellos eine große ökumenische Kraft, von der aber abzuwarten bleibt, wieweit sie auch über die Verständigungsgewohnheiten der eigenen Konfessionsfamilie hinaus anregend sein kann. Erfahrungen aus Dialogen mit römisch-katholischen oder orthodoxen Theologen stimmen da eher skeptisch.
Die ökumenische Anschlussfähigkeit der Theologie Barths hat ihren Grund weder in einer kongenialen noch einer gesuchten Nähe zu den ökumenischen Aufbrüchen im 20. Jahrhundert. Vielmehr stand er unbeschadet verschiedener Einlassungen in das sich formierende Engagement des Ökumenischen Rates der Kirchen sowohl dem hier gewählten Ausgangspunkt als auch dem ins Auge gefassten Weg eher skeptisch bis ablehnend gegenüber. Ökumene kann nach seinem Verständnis nur das Resultat eines nach vorn blickenden Bekenntnisses, das die Kirche als Ausdruck der Antwort formuliert, zu der sich die Kirche in den Nöten der Gegenwart unter strikter Wahrung bzw. Wahrnehmung ihrer theologisch belastbar auszuweisenden Verantwortung vor Gott gedrängt sieht. Ein solches Bekenntnis stand Barth in der Barmer Theologischen Erklärung von 1934 vor Augen. Alle seine Versuche, den ökumenischen Rat zu einer Unterstützung der mit diesem Bekenntnis annoncierten Positionierung der Kirche gegenüber der vom Nationalsozialismus ausgehenden Bedrohung zu bewegen, blieben weithin unerhört.
Auch wenn ihm eine unmittelbare ökumenische Resonanz zu dieser ihn zutiefst bewegenden Herausforderung versagt geblieben ist, so wurde doch die theologische Grundsätzlichkeit des hier bearbeiteten Konflikts auch außerhalb der unmittelbar beteiligten Kirchen bald anerkannt. Zudem wird Barth auch außerhalb der reformatorischen Tradition als ein Theologe wahrgenommen und dann auch akzeptiert, der sich im Horizont der gegenwärtig an die Theologie gestellten Anforderungen auf einer soliden Basis mit den großen Themen der Theologie beschäftigt, welche die Kirche in ihrer Geschichte immer wieder bewegt haben. Indem sich Barth kenntnisreich und achtsam auch mit den vorreformatorischen Auseinandersetzungen und Entscheidungen der Theologie auseinandersetzt, ergibt sich für das Gespräch mit der katholischen und der orthodoxen Tradition ein selten großer gemeinsamer Orientierungshorizont und Diskussionsraum. Da auch die anderen Traditionen nicht einfach wiederholen, was die Alte oder mittelalterliche Kirche gesagt hat, ist es in der Regel kein Problem, wenn Barth dann zu durchaus abweichenden eigenen Antworten kommt, die seine reformatorische Prägung erkennen lassen. Aber es wird offenkundig registriert, dass Barth nicht nur behauptet, sich an den gleichen Fragen abzuarbeiten, wie die Theologien anderer Konfessionen, sondern dies mit den Orientierungen und der Denkarbeit seiner Theologie auch unter Beweis stellt und damit zur Auseinandersetzung einlädt. In dieser Hinsicht ist das Ökumenische seiner Theologie die konstruktive und belastbare Aufmerksamkeit auf die ganze Tradition der Kirche. Theologie ist in dieser Wahrnehmung ökumenisch, wenn sie sich ebenso schlicht wie argumentationsbereit auf die der Kirche gemeinsame Tradition einlässt und nicht nur die eigene Tradition möglichst ökumenefähig zu machen versucht.
Wenn Barths Theologie zudem auch für die von der Ökumene wahrzunehmende Weltverantwortung eine hohe Anschlussfähigkeit mitbringt, so hat dies vor allem zwei Gründe. Einerseits liegt sie in der theologisch ausgewiesenen Widerstandsfähigkeit seiner Theologie gegenüber den Ansprüchen des Nationalsozialismus begründet, wie sie sich in besonderer Weise in der Barmer Theologischen Erklärung von 1934 niedergeschlagen hat. Neben der dann leider erst später erfolgenden weltweiten Rezeption des Barmer Bekenntnisses ist es vor allem der von Barth hervorgehobene konfessorische Charakter der theologischen Existenz, der die Beachtung gilt: Theologie muss ihrem Wesen nach in dem Sinne bekennende Theologie sein, dass sie auf das heute zu sprechende Bekenntnis in Wort und Tat ausgerichtet ist. Und damit hebt Barth in seiner Theologie zugleich mit besonderem Akzent die vorbehaltlose Solidarität der Christen mit einer nüchtern wahrgenommenen Welt hervor. Diese Solidarität orientiert sich unabhängig von allen unterschiedlichen weltanschaulichen und ideologischen Prägungen an den Nöten der Menschen. In diesen Zusammenhang gehört nicht zuletzt die überraschende Rezeption, welche die Theologie Barths in der katholischen Theologie der Befreiung in Lateinamerika erfahren hat.
Bis heute allein geblieben ist Barth allerdings mit seinen bereits angedeuteten israeltheologischen Herausforderungen, vor die er die Kirche vor allem um Gottes willen gestellt sieht, nicht nur in ihrem Selbstverständnis als Volk Gottes, sondern auch hinsichtlich der über die Kirche hinausreichenden Treue Gottes zu seiner Erwählung. Wenn Barth die eine Gemeinde Jesu Christi als die aus Israel und Kirche bestehende Gemeinde versteht (KD II/2, § 34.1), bewegt er sich auf einer Ebene, von der aus alle bisherigen ökumenischen Orientierungen grundlegend neu zu orientieren wären.22
Weitere Entfaltung und Vertiefung dieses Aspektes in Kap. II.6; IV.3.3.2
*
Auch wenn sich mühelos weitere Akzente der Theologie Barths benennen ließen, mag es im Zusammenhang dieser Einführung zunächst mit diesen zwölf Blitzlichtern sein Bewenden haben. Sowohl der Entdeckungshorizont als auch der Begründungshorizont für eine gründliche und selbstkritische Revision der gesamten Theologie sind ebenso erkennbar geworden wie die spezifischen erkenntnistheoretischen Prämissen, denen Barth eine die Selbstreferenz ihres Gegenstandes respektierende Theologie unterworfen sah. Theologie ist alles andere als eine selbstverständliche und routinisierbare Angelegenheit zur Reinerhaltung der christlichen Tradition. Vielmehr steht sie in der Verantwortung, immer wieder neu darüber Rechenschaft abzulegen, wie angemessenen zu antworten ist auf die heute ergehende Anrede Gottes, wie sie sich im je gegenwärtigen Hören auf das vom Zeugnis der Bibel bezeugte Wort Gottes vernehmbar macht. Wenn Barths Theologie als eine Theologie des Wortes Gottes bezeichnet wird, gilt die Aufmerksamkeit weder einem als besonders wichtig erkannten Bedarf des Menschen noch einer für den Erhalt der Kirche als förderlich oder gar rettend ausgewiesenen Perspektive, sondern sie verweist alle begründbaren Hoffnungen des Menschen und die zu lebenden Perspektiven der Kirche auf das lebendige Wort Gottes, in dem, wenn es ernsthaft als solches vernommen wird, auch für die Bedarfe des Menschen und die Perspektiven der Kirche ausreichend gesorgt ist.
Da sich die Theologie grundsätzlich mit ihren Einsichten weder am Ziel noch auch nur im vorläufigen Besitz der Wahrheit wissen kann, geht nichts mehr an Barth vorbei als der Vorwurf einer von ihm angestoßenen Neo-Orthodoxie. Vielmehr lässt sich umgekehrt die Wahrnehmung gut begründen, dass seine Theologie den meisten Problemwahrnehmungen der gegenwärtigen theologischen Diskurse durchaus noch voraus ist. Zweifellos ist uns der unmittelbare Zugang inzwischen erschwert, so dass wir ohne eine gewisse Historisierung nicht mehr auskommen. Das sind wir schon der von Barth selbst betonten Kontextualität seiner Theologie schuldig. Eine nähere Beschäftigung mit Barth wird dann aber auch schnell zeigen, dass das theologische Potenzial, das in dieser Theologie steckt, sich nicht in seiner historischen Bedeutung erschöpft, sondern in vielen der gegenwärtigen Problemkonstellationen immer noch eine erschließende und dann auch weiterführende sachliche Anregung bereitstellen könnte.23 Es ist bemerkenswerterweise vor allem die neuere theologische Diskussion in den Vereinigten Staaten von Amerika, die uns in dieser Entdeckung heute voranzugehen scheint.24
1Vgl. Pressel, Die Kriegspredigt 1914–1918; Missalla, „Gott mit uns“.
2Barth, Der Christ in der Gesellschaft, 565.
3Barth, Das Wort Gottes als Aufgabe der Theologie [1922], 158.
4Diese Formulierung ist charakteristisch für Barth, Römerbrief (Zweite Fassung), 47, 59, 66, 76, 223, 435, 498, 522.
5Barth, Die neue Welt in der Bibel [1917], 335.
6Vgl. ebd., 322.
7Barth, Die Kirchliche Dogmatik [KD], Bd. I/1, 311 (Im Folgenden erscheinen die Belege aus der KD mit Band- und Seitenangabe im Text).
8Barth, Abschied, 497.
9Vgl. dazu seine Ausführungen über den dialektischen Weg in: Barth, Das Wort Gottes als Aufgabe der Theologie, 166–172.
10Diese nur teilweise berechtigte Unterscheidung wurde einführt von v. Balthasar, Karl Barth, 93 ff.
11Vgl. dazu auch kompakt Weinrich, Bund.
12Vgl. dazu Link, Theodizee.
13Vgl. dazu Wüthrich, Gott und das Nichtige.
14Vgl. dazu klassisch Pico della Mirandola, De hominis dignitate.
15Vgl. dazu Barth, Das christliche Leben, 56 f.
16Barth, Das Geschenk der Freiheit.
17Zu den Postulaten der reinen praktischen Vernunft vgl. Kant, Kritik der praktischen Vernunft, 140– 153 (= Originalausgabe 1797, 223–241).
18Vgl. dazu Weinrich, (Ver-) Bindungen der Freiheit.
19Vgl. Barth, Evangelium und Gesetz.
20Vgl. Barth, Offene Briefe (drei Bände).
21Vgl. Weinrich, Karl Barth und die Ökumene.
22Vgl. dazu Weinrich, Ökumene am Ende?, 149 ff.
23Vgl. dazu u. a. Fazakas/Árpád (Hg.), Ist die Theologie Karl Barths noch aktuell?
24Vgl. dazu Gockel, Jede Stunde neu anfangen.