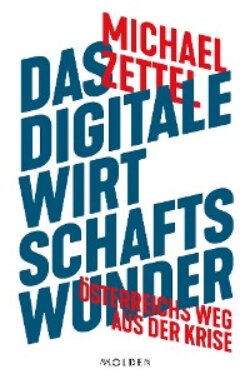Читать книгу Das digitale Wirtschaftswunder - Michael Zettel - Страница 10
DATENSCHUTZ ALS WACHSTUMSKILLER?
ОглавлениеDaten sind das „neue Gold“ oder das „neue Erdöl“ – diese und ähnliche Vergleiche haben eines gemeinsam: Sie hinken. Denn Daten sind nicht nur als Rohstoff zu sehen. Jener Teil, der persönliche Daten sind, ist Teil von uns beziehungsweise unserer technologischen Identität. Das macht sie besonders wertvoll und das bedeutet für jene, die sie nutzen, Verantwortung zu übernehmen.
Die Technologie-Skepsis kommt bei der Datenschutz-Thematik besonders zu tragen. Österreich hat eine besondere Beziehung zum Datenschutz. Der weltweit führende Datenschützer, Max Schrems, ist Österreicher. Seine Arbeit wird gern als Kampf Davids gegen Goliath Mark Zuckerberg gefeiert. Nicht, dass man alles gutheißen muss, was Mark Zuckerberg tut, aber die zutiefst skeptische rückschrittliche Einstellung der Datennutzung gegenüber wird uns nicht voranbringen und kann uns in unserer Entwicklung in vielerlei Hinsicht hemmen. Datennutzung ist Realität. Sie wird in den nächsten Jahren und Jahrzehnten zunehmen – um das zu wissen, muss man kein Prophet sein. Sie blind zu bekämpfen ist kontraproduktiv, sinnlos und unserer Wirtschaft, dem Wohlstand sowie der Gesellschaft und damit den Menschen gegenüber verantwortungslos. Es gilt sie vielmehr verantwortungsbewusst zu nutzen.
Datenschutz wird in Europa vornehmlich aus der Konsumenten-Perspektive wahrgenommen. Der Grundgedanke der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO), dem Kunden die Hoheit über die Daten zu geben, ist dabei grundsätzlich lobenswert und durchaus nachvollziehbar. Wenn aber Unternehmen ernsthaft überlegen müssen, ob sie E-Mail als Kommunikationskanal zum Kunden nicht sperren müssten, weil es den Datenschutz verletzt, dann ist die Umsetzung eine ernsthaft zu hinterfragende Katastrophe. Das Geburtstags-E-Mail darf nicht von der Marketing-Abteilung verschickt werden; und die absurdeste Diskussion in der Datenschutz-Euphorie war wohl jene, in der es darum ging, ob die Sprechanlagen bei den Wiener Gemeindebauten die Namen tragen dürfen oder nur nummeriert werden sollen.
Die große Problematik der Datenschutz-Grundverordnung ist allerdings die Rechtsunsicherheit. Es geht nicht klar hervor, was erlaubt ist und was nicht. Unternehmen müssen sich entscheiden, ob sie im Graubereich agieren oder viel Zeit und Geld investieren, um besonders vorsichtig zu sein und jedes neue IT-Projekt auf den Datenschutz hin rechtlich zu prüfen. Diese unklare Situation und der starke Datenschutz sind ein Wettbewerbsnachteil, den sich Europa den USA gegenüber freiwillig auf Jahrzehnte einhandelt. Wir errichten damit neue Grenzen und erschweren Wirtschaftswachstum und Innovationskraft. Wir dürfen aus dem Datenschutz keinen Wachstumskiller machen. Die nationalen Regeln, Gesetze und Vorschriften sind oft gut gemeint, aber das kann auch – wie so oft – zum Gegenteil von gut werden. Mehr als 100 Länder weltweit haben in den letzten 20 Jahren nationale Datenschutzgesetze erlassen. Aber unsere Wirtschaft, die digitale Wirtschaft der Zukunft, basiert auf der Nutzung von Daten. Diese Gesetze behindern den freien Fluss von Daten, von IT-Produkten, IT-Dienstleistungen und den bei uns dringend benötigten IT-Fachkräften. Wir brauchen eine Balance zwischen notwendiger Regulierung und erforderlicher Freiheit – keine Schieflage.
Konkret bedarf es einer harmonisierten Gesetzgebung in der EU, denn jedes Land interpretiert die europäische Grundlage in Details unterschiedlich. Vor allem benötigt es auch Verordnungen, die aufbauend auf einer europäischen und nationalen Datenstrategie explizit rechtssicheren Raum schaffen und zum Beispiel die Frage der Datennutzung in Europa klären.
Generell muss unser Zugang zu Daten sich am Nutzen orientieren: Was bringt die Datenverwendung, was kann ich damit erreichen? Und dann natürlich die Abwägung der Risiken und Gefahren, die dem entgegenstehen. Leider betrachten wir im Moment fast ausschließlich die Risiko-Perspektive, und viel zu selten wird der Nutzen in den Vordergrund gestellt und bewertet.
Die elektronische Gesundheitsakte ist ein gutes Beispiel: Daten können in der Medizin Leben retten, beispielsweise bei Wechselwirkungen von Medikamenten. In Norwegen etwa hat man dies erkannt und die nationale Gesundheitsakte eben genau damit beworben, dass Daten Leben retten können. In Österreich wird die Diskussion absurderweise ausschließlich über die Frage der Haftung für Mediziner geführt, die vielleicht etwas übersehen könnten, wenn ihnen die Daten elektronisch zur Verfügung stehen.