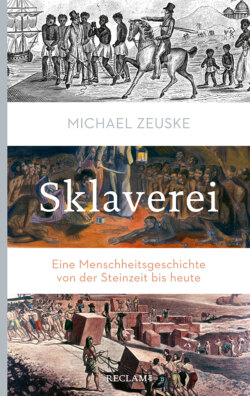Читать книгу Sklaverei - Michael Zeuske - Страница 4
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Vorwort zur Neuausgabe
ОглавлениеDas Interesse an Sklaverei allgemein und ihren Folgen bis heute hat seit der Erstveröffentlichung des vorliegenden Buches 2018 stark zugenommen. Diese Zunahme ist neuen Forschungen, aber auch der memory-Bewegung, den Diskussionen darüber und den Dekolonisierungsdebatten geschuldet. Die breitere Öffentlichkeit wird mit diesem Diskurs etwa durch den Streit um Straßennamen, Denkmäler und Museen konfrontiert. Das Interesse an Sklaverei ist historisch, memory sowie Dekolonisation sind politische Phänomene.
Zunächst zum Historischen. Seit ich 1987 als Assistent in Leipzig Vorlesungen des kanadischen Historikers Clarence J. Munford hörte, beschäftige ich mich, zunächst eher neben globalhistorischen Forschungen zur Revolutionsführung im nördlichen Südamerika (Simón Bolívar im Rahmen des Zentrums für Vergleichende Revolutions-/Transformations-Forschung unter den Universalhistorikern Walter Markov und Manfred Kossok), mit Sklaverei und Sklavenhandel in der Karibik. Nach dem Zusammenbruch des Staats-Marxismus und der Umstrukturierung der Universitäten in der ehemaligen DDR begann ich 1993 mit Forschungen, die sich nach eher strukturellen Ansätzen (die Idee bestand darin, den Klassenbegriff auf schwarze Versklavte in Kuba anzuwenden) auf die »Stimmen der Versklavten« konzentrierten. Aus einer Regionalgeschichte des 1860–1886 weltweit modernsten Massensklaverei-Industriegebiets um Cienfuegos im mittleren Süden Kubas wurde sehr schnell postkoloniale Mikrogeschichte, und ich befasste mich mit Lebensgeschichten ehemaliger Versklavter und ihrer Nachkommen.
Dieser Ansatz führte mich immer tiefer in Provinzarchive der Region, in denen Tausende Notariatsprotokolle über Kauf und Verkauf menschlicher Körper, Testamente ehemaliger Sklavinnen und Sklaven sowie Akten zu Gerichtsverhandlungen unter Beteiligung von Versklavten und ihren Nachkommen zu finden waren. Ich analysierte ellenlange Namenslisten ehemaliger Sklaven und ihrer Nachkommen (Wahllisten, Armeelisten). Dazu kamen Narrative ehemals Versklavter, sogenannte testimonios (unter anderen das berühmte Buch Der Cimarrón von Miguel Barnet über den geflohenen Sklaven Esteban Montejo) und zeitgenössische Beobachtungen sowie Analysen von Sklaverei – wie die Alexander von Humboldts in seinem Buch Politischer Essay über die Insel Kuba (frz. 1826, span. 1827, dt. 1889).
Nach zehn Jahren intensivster Studien und Feldforschungen (u. a. auf ehemaligen Sklavenplantagen, die zu großen Zucker-Agrarindustriezentren geworden waren, in Sklavenhäfen und an Küsten, an denen geschmuggelte Versklavte aus Afrika illegal angelandet worden waren) hatte ich unzählige Käufe und Verkäufe von Versklavten auf Kuba (Abolition 1886) sowie Namen von Nachkommen ehemals Versklavter recherchiert. Ich verfügte über eine umfassende Datenbasis zu einer konkreten Sklaverei (die übrigens die wirtschaftlich profitabelste des 19. Jahrhunderts war). Das Aufschlussreichste war aber ein Negativ-Ergebnis: Ich habe nur extrem wenige »Stimmen« in Selbst-Repräsentation von Versklavten in der Sklaverei (nicht danach!) gefunden. Zwar hatte ich dank des mikrohistorischen Ansatzes und der extrem vielen Dokumente und Beobachtungen vor Ort ›Grund berührt‹. Aber ich traute mich gerade wegen dieses Ansatzes kaum noch, Aussagen zur Nachbarprovinz auf Kuba, zu anderen Sklavereikolonien der Karibik (wie Jamaika oder Martinique) oder gar weltweit zu machen, weil es dort ähnlich viel Material gab und gibt.
Da kam es mir sehr gelegen, dass 2005 im Nationalarchiv Kubas in Havanna Interna aus dem Leben eines Sklavenschiffskapitäns namens Ramón Ferrer, des Kapitäns und Besitzers des filmnotorischen Schoners Amistad, auftauchten. Ich machte mich atlantikweit auf die Suche nach den Schiffen dieses Kapitäns. Auch, weil Sklavenschiffskapitäne, Offiziere, Ärzte, Mannschaften, Matrosen und Köche (wenn man so will, die direkten Versklaver), sehr nahe an den Versklavten ›dran‹ waren (im Englischen heißt das face-to-face). Die Zeugnisse und Darstellungen der direkten Versklaver, von denen es sehr viel mehr als von Versklavten gibt, konnten mir verlässliche Informationen über die Lebensbedingungen der Versklavten geben. Der Grundansatz aller meiner Bücher und Texte zur Sklavereigeschichte ist immer das Interesse am Leben versklavter Menschen gewesen. Das gilt auch für die Zukunft und für das vorliegende Buch.
Aus dieser Suche ging alles hervor, was ich zu atlantischem Sklavenhandel und illegalem Menschenschmuggel (den ich mit dem Konzept des Hidden Atlantic erfasse) geschrieben habe. 2006 erhielt ich das Angebot, eine 600-seitige Weltgeschichte der Sklaverei zu verfassen. Ich wandte mich wieder der Globalgeschichte zu, erinnerte mich meiner welthistorischen Ausbildung bei Markov und Kossok in Leipzig 1976–1990 und behielt zugleich die mikrohistorische Herangehensweise bei. Schnell stellte ich fest, dass sich fast alle Sklaverei-Gesamtgeschichten auf die traditionelle Linie dessen konzentrieren, was ich »hegemonische Sklavereien« (nach dem Muster der »Sklavengesellschaften« von Moses I. Finley) aus europäischer oder nordamerikanischer Sicht nenne: Sie behandeln die Antike (meist Griechenland und Rom), das Mittelalter eher nicht und von den neuzeitlichen Sklavereien vor allem den Süden der USA und meist noch ›etwas Karibik‹ – in der Regel die britische. Eine gewisse Ausnahme stellt José Antonio Saco mit seiner Historia de la esclavitud vom Ende des 19. Jahrhunderts dar (den ich im vorliegenden Buch öfter zitiere). Davon deutlich getrennt gab es mehr und mehr soziologische, politikwissenschaftliche oder anthropologische Studien zur sogenannten »modernen Sklaverei«. Ich wusste aber aus meiner mikrohistorischen Arbeit, dass es extrem viele konkrete Sklavereiregimes sowie Sklavereien mit ihren Folgen und Konsequenzen für das Leben von Versklavten und ihrer Nachkommen gab und bis heute gibt. Und dass diese historische Dimension auch für heutige Sklavereien eine extrem wichtige Rolle spielt.
Ich begann bei der Recherche über Versklavte mit ihren jeweiligen Bezeichnungen, Sklavereien und Sklavereiregimes weltweit, in der Geschichte aller Gemeinschaften, Gesellschaften und Territorien. Ich stellte schnell fest, dass, wenn man wirklich genau hinschaut und die Fixierungen auf »hegemonische Sklavereien« aufgibt, überall Versklavte und Sklavereien zum Vorschein kommen, von der Prähistorie bis heute. Auch in Gesellschaften, deren Mitglieder, Historiker oder Intellektuelle, aus welchen Gründen auch immer, behaupten, dass es bei ihnen gar keine Sklaverei »wie in Rom« oder »wie im Sklavenhandel von Afrika in die USA« gegeben habe. Und schwarze Sklaven schon gar nicht. Und auch kein Wort für »Sklaven« oder »Sklaverei«. Auch die Zeitleiste wurde länger und länger: Im Grunde gab es schon in der Prähistorie Menschen, deren Status der dem eines Sklaven oder einer Sklavin »ohne institutionelle Sklaverei« gleichkam, und überall existieren Sklavereiregimes ohne eine Definition von privatem Eigentum (wie im sogenannten »römischen« Recht).
2009 hatte ich ein 700-seitiges Manuskript fertig, aber noch nicht einmal die östliche Hemisphäre um den Indischen Ozean, Südostasien oder China bearbeitet. In jeder Gesellschaft, die ich untersucht hatte, passierte mehr oder weniger das Gleiche – es gab sehr zeitig Kriegsgefangene, Verschleppte, Frauen und Mädchen auf der Suche nach Schutz, Waisen oder Verurteilte und Schuldner. Überall entstanden Eliten mithilfe solcher Menschen, die, je mächtiger die Eliten wurden, desto deutlicher in einen Status von Versklavten kamen, und es bildeten sich mehr und mehr expansive Imperien mit definierten Sklavereien, in die Menschen kamen und oft über Generationen in ihnen blieben. Ohne Sklavereien gäbe es keine Imperien. Hätte ich dieses Manuskript weiter in einer historisch-chronologischen Unterteilung nach Gruppen, Häuptlingstümern, Staaten/Monarchien und Imperien geschrieben, wären wahrscheinlich zehn Bände mit jeweils 600 Seiten herausgekommen.
Ich strukturierte das Manuskript nach historisch-anthropologischen Gesichtspunkten und großen Weltregionen um (Ozeanen/Meeren, Hemisphären und Kontinenten). Das Buch erschien 2013 und 2019 als Handbuch Geschichte der Sklaverei. Eine Globalgeschichte von den Anfängen bis zur Gegenwart. Die Globalgeschichte ist ein typisches Grundlagenforschungsbuch und steht in vielen National- und Universitätsbibliotheken. Es ist aber kein Publikumsbuch. Ein Buch zu diesem Thema mit wissenschaftlichem Anspruch, aber eben kurz und lesbar, blieb ein Desiderat. Eine Kollegin hatte in einer Rezension gefordert, ich möge doch einmal in lesbarer Form erklären, was die Hauptergebnisse meiner Grundlagenforschung seien. Also schrieb ich eine kurze und lesbare Synthese. Das Ergebnis war die erste Auflage des vorliegenden Buches.
Dieser Band ist eine Geschichte der Sklavereien, die sich wie eine dichtgewebte Bindungsstruktur extremster asymmetrischer Abhängigkeiten durch die Welt- und Globalgeschichte von den Anfängen bis heute und in allen Gesellschaften ziehen. Werden Wirtschaft, Produktion, Handel, Hierarchien oderHerrschaftsverhältnisse betrachtet, finden sich bei genauer Analyse fast immer Versklavte, Sklavereien und Sklavereiregimes (und ihre Folgen). In vielen Büchern zu Kultur-, Wissens- und Geistesgeschichte, auch in Nationalgeschichten, werden sie oft nicht behandelt - sie werden verschwiegen oder interessieren schlicht nicht. Auf den nachfolgenden Seiten stehen sie im Zentrum. Das vorliegende Buch ist keines über »Freiheit«, Menschenrechte, Widerstand oder Abolitionen (obwohl es ein Kapitel dazu gibt), sondern über Sklavereien, Versklavte und ihren ›Wert‹ sowie ihre Preise in den jeweiligen Sklavereien und Sklavereiregimes. Die Hauptaussage lautet, dass Sklavereien in der Welt- und Globalgeschichte bis heute ubiquitär und in gewissem Sinne alltäglich sind, samt ihren strukturellen Folgen und Nachwirkungen sowie heutigen Wirkungen. Nur merken wir das oftmals gar nicht. Um das handhabbar (und lesbar) zu machen, habe ich die historisch-anthropologische Differenzierung nach Sklaverei-Plateaus (insgesamt sechs für die Geschichte der Menschheit) bei der Gliederung des Bandes angewandt. Das sind keine »Formationen« oder stages (wie es heute in Neudeutsch heißt). Sie beginnen alle an einem gewissen Punkt der Weltgeschichte, hören aber nicht auf, mit relativer Ausnahme des dritten Plateaus zur atlantischen Sklaverei um 1400–1900.
In der Zeit zwischen der Erstpublikation 2018 und der Neuauflage 2021 ist die Sklavereiforschung (weniger die Forschung zu Versklavten) exponentiell gewachsen. Und es gibt Sklavereiforschungszentren, die wichtiges neues empirisches Material vorgelegt haben. Allein schon Deutschland hat sich vom ›Zaungast‹ der Sklavereiforschung mit Fixierung auf die USA-Academia zu einem neuen Zentrum der Sklavereiforschung mit den wichtigsten Standorten Bremen, Frankfurt an der Oder (Vergleichende Europäische Wirtschafts- und Sozialgeschichte), Hannover und Bonn (Bonn Center for Dependency and Slavery Studies, kurz BCDSS) entwickelt. Neben den sehr vielen Einzelergebnissen und Tagungen des BCDSS ist vielleicht das wichtigste bisher erreichte Resultat, dass eine der globalhistorischen Fehlrezeptionen in Deutschland und Mitteleuropa dabei ist, sich aufzulösen – nun ist klar, dass Brasilien das Land mit der umfassendsten Sklavereigeschichte und -forschung weltweit ist.
Deutschland und Mitteleuropa (es gibt auch in der Schweiz starke Forschungen) galten bisher als Hinterland oder Peripherie der dynamischen Wirtschaften der Sklaverei- und Sklavenhandelsnationen (Portugal, Spanien, Großbritannien, Frankreich, Niederlande, Dänemark, Schweden samt ihren Kolonien; mit Abstrichen auch Brandenburg/Preußen). Inzwischen aber wird deutlich, dass diese Regionen daran durchaus beteiligt waren – entweder durch einzelne Unternehmer, Firmen oder durch Teilnehmer am afrikanischen und atlantischen Sklavenhandel sowie Plantagenbesitzer oder in sklavereinahen Jobs wie Mediziner/Arzt, Handwerker, Aufseher/Manager in der Sklaverei, in Sklavereiregimes und -wirtschaften oder durch Besitz und Handel mit Versklavten im deutschen Alten Reich, in der Schweiz oder in italischen Staaten. Dies war vor allem im 18. Jahrhundert und den Zeiten des Biedermeierkapitalismus bis zur eigentlichen Industrialisierung in Mitteleuropa (um 1870) der Fall.
Was einzelne Forschungsergebnisse betrifft, will ich nur auf die aus meiner Sicht wichtigsten verweisen, zumal auf solche, die gerade Gegenstand der Debatte sind: Die Erbauer der Pyramiden waren keineswegs stolz darauf, an einem »Weltwunder« mitgearbeitet zu haben – im Alten Ägypten gab es richtige Sklaven (ein Forschungsergebnis mit Signalwirkung für materielle Kultur und Sozialgeschichte der frühen Staatlichkeit expansiver Imperien). Neue Erkenntnisse gibt es aber auch zu verschiedensten Sklavereien in der Geschichte Chinas sowie Asiens überhaupt, zur globalgeschichtlichen Neujustierung antiker Sklavereien, zur Globalgeschichte (inklusive der Geschichte »vormoderner Sklavereien« sowie other slaveries, d. h. formeller und informeller Sklavereien von Indigenen und unter Indigenen); zu Russland, russischer Geschichte und russischem Reich; zu Afrika als Zentrum der Sklavereigeschichte und der Beteiligung afrikanischer Eliten an der atlantischen Sklaverei; zu den Debatten um Sklaverei als Kapitalismus vor allem in den USA bis 1860, Surinam bis 1863, Puerto Rico bis 1873, Kuba bis 1886 und Brasilien bis 1888 (Second Slavery, New Economic History – vor allem in den USA – und Slavery as Capitalism), zu Sklavereien und Sklaverei-/Sklavenhandels-Regimes am und auf dem Indischen Ozean sowie Randmeeren des Pazifiks und in Südostasien.
Zum Schluss noch ein Blick aufs Politische: memory. Die Erinnerungskultur der Sklaverei bzw. des Sklavenhandels, der Sklavereiregimes und des Lebens von Versklavten und ihrer Folgen (sowie des materiellen Erbes in Städten, Bauten, Institutionen, Banken, Museen – heritage) ist zugleich die Politik von Aktivisten (meist bis heute nationale oder lokal-urbane Politik). Aber memory, sofern es sich nicht um geschichtsblinden Aktivismus handelt, ist auf historische, soziologische und anthropologische Sklavereiforschung angewiesen, speziell auf Forschungen zu Versklavten und Versklavern (Sklavenhändlern, Sklavenhalterinnen und Sklavenhaltern sowie Funktionskräften – also Reedern, Schiffsausrüstern, Versicherern, Investoren, Ärzten, Managern, Administratoren, Notaren, Priestern, auch Kapitänen und Schiffsoffizieren oder Köchen, die die Massen von Versklavten ernährten – und Hilfskräften, also Wachen, Übersetzern, Ruderern, Matrosen, Karawanenträgern etc.
Dekolonisierungs-, Umbenennungs- und Anti-Rassismus-Debatten laufen schon einige Zeit (auch in Bezug auf Museen); wichtige neuere memory-Aktivitäten in der Politik gab es im Nachgang des Todes von George Floyd (25. Mai 2020 in Minneapolis) vonseiten der Black-Lives-Matter-Bewegung. Alle drei Debatten werden uns auch in Zukunft begleiten. Die vorliegende Sklavereigeschichte soll nicht zuletzt dafür eine Basis bilden.
Leipzig, im Februar 2021