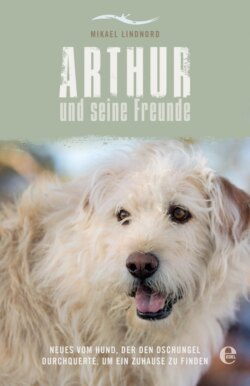Читать книгу Arthur und seine Freunde - Mikael Lindnord - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Brasilianischer Regenwald, November 2015
ОглавлениеDie Weltmeisterschaft in Brasilien war wie immer eine große Herausforderung und ein bedeutendes Rennen für uns als Team. Es sah ganz danach aus, als könnten wir unseren Platz unter den besten Fünf der Welt verteidigen, wenn wir so gut abschnitten, wie wir hofften, und als eines der sechs besten Teams ins Ziel kamen. Wir wussten, dass wir das schaffen konnten, und hatten wie immer monatelang trainiert, um uns auf das Highlight des Jahres vorzubereiten. Wie damals vor der Reise nach Ecuador hatten wir wieder und wieder unser Equipment überprüft und unsere Strategie besprochen und wir waren ausgeruht und fit durch unser intensives Training – zu Hause wie im Trainingscamp in der Türkei.
Wie die Planer der Strecke angekündigt hatten, sollte das Rennen durch das Feuchtgebiet Pantanal in Westbrasilien so anspruchsvoll wie unvergesslich werden. Sie hatten mit beidem nicht übertrieben.
Ich bin in meiner Karriere als Adventure-Racer an vielen ungemütlichen und gefährlichen Orten gewesen, aber dieser brach wahrscheinlich alle Rekorde. Wir wurden vor Jaguaren, Wildschweinen, Krokodilen und Schlangen gewarnt, von Tropischen Riesenameisen, Vogelspinnen und Moskitos ganz zu schweigen. Näher kommt man an Indiana Jones nicht heran.
Außerdem stellten die Organisatoren weder Schlaf- oder Ruhevorschriften auf, noch gab es vorgeschriebene Dark Zones, die nur bei Tageslicht bestritten werden durften – es zählte allein, wer als Erster durchs Ziel kam. Die Karten waren bestenfalls skizzenhaft, das Terrain war so sumpfig und schwierig, wie wir es nur in den schlimmsten Fällen erlebt hatten, und dazu kamen Temperaturen über vierzig Grad Celsius.
Unser Team war anders zusammengesetzt als noch in Ecuador: Zu Staffan und mir kamen Marika und Jonas. Doch wir waren gut eingespielt und ich freute mich, dass wir im Sommer bei den „Chile Series“ Zweite geworden waren. Es würde ein hartes Rennen werden, doch darauf waren wir ausreichend vorbereitet, glaubte ich.
Eine Racerin aus einem anderen Team hatte am Morgen vor dem Start eine Grundschulklasse besucht, mit den Kindern gesprochen und gemeinsam gelesen. Sie wurde gefragt, ob sie sich vor Jaguaren fürchte. Als sie zurückfragte, ob sie denn Angst haben müsse, nickten alle lange und ernst. Wie sich herausstellte, hatte jedes der Kinder bereits einen Jaguar gesehen. Ich war mir nicht sicher, ob die Tatsache, dass alle das Zusammentreffen überlebt hatten, mir Mut machen sollte oder ob ich mir Sorgen machen musste, dass wir nicht so viel Glück haben würden.
Am Anfang des Rennens stand eine Kajaketappe flussaufwärts. So schön, wie sich das anhört, war nur die erste Stunde. Schon bald wurde es drückend heiß, eins unserer Boote leckte und Wolken ausgehungerter Moskitos fielen über uns her. Da das Warten auf ein neues Boot wertvolle Zeit verschlungen hatte, versuchten wir auf der folgenden Trekkingetappe so schnell wie möglich durch den Wald zu gelangen. Vielleicht zu schnell, doch noch fühlten wir uns für ein zügiges Tempo frisch genug und joggten, so oft es möglich war.
Den Kopf gesenkt und ganz auf den Pfad konzentriert registrierte ich kaum die Spuren der Dschungelbewohner, die vor uns hier gewesen waren. Doch als ich den Untergrund genauer betrachtete, bemerkte ich riesige Pfotenabdrücke. Durch unsere Laufgeräusche hörte ich zuerst nicht das bedrohliche Rascheln ein paar Meter weiter rechts. Da ich den anderen gerade ein Stück voraus war, hielt ich an, um zu lauschen, ob ich mir das nicht nur einbildete. Nein – da raschelte es wieder und ich könnte schwören, dass auch ein Kauen zu hören war. So laut, wie dieses Geräusch war, konnte es nur von dem großen Tier stammen, zu dem auch die Spuren passten. Von einer Großkatze. Einem Jaguar.
Ich spürte, wie sich alle Muskeln anspannten, und hatte wieder die Bilder im Kopf, die ich von Jaguaren auf der Jagd gesehen hatte. Aber dann musste ich an Arthur denken, den leidenschaftlichsten Katzenjäger der Welt. Was würde er jetzt tun? Roch ich womöglich nach Hund, und war das gerade gut oder eher schlecht? Dann aber ließ mich der Gedanke an Arthur mit seiner ruhigen Ausstrahlung, der in einem ebenso gefährlichen Dschungel überlebt hatte, zur Ruhe kommen. Wenn er im Regenwald überleben konnte, konnte ich das auch.
Ich wartete auf die anderen, wir zogen das Tempo an und dann liefen wir bergab (immer gern genommen, besonders bei vierzig Grad) bis zu einer Wechselzone an einem weiten See, dem Übergang zum Packrafting. Die anderen hatten von einem Jaguar nichts mitbekommen, aber Staffan versicherte mir, er habe zwei Wanderspinnen gesehen, eine Art, die – wie es die Informationen der Rennorganisatoren fröhlich verlauten ließen – als „die giftigste der Welt“ galt. Selbst wenn man von dem Schlafentzug und der Entkräftung einmal absieht, ist Adventure-Racing nichts für schwache Herzen.
Packrafts sind leichter und stabiler als Kajaks und außerdem viel langsamer. Am Anfang waren wir noch auf einem Flusslabyrinth unterwegs, wo das keine große Rolle spielte, aber als wir dann bei Gegenwind auf einen weiteren See hinausfuhren, machte das eine Menge aus. Wir kamen nur langsam voran und ich war mir ziemlich sicher, dass wir inzwischen ein gutes Stück hinter unseren beiden größten Rivalen zurücklagen – dem Team der schwedischen Armee und den Litauern. Daher war es vielleicht nachvollziehbar, dass meine Teamkollegen, als wir schließlich die Landezone erreichten, am liebsten zügig den steilen Berg hinaufkommen wollten, der sich aus dem Wasser erhob.
Ich bin nun schon fast zwanzig Jahre Adventure-Racer und weiß, dass es bei wirklich extremen Bedingungen die wichtigste Regel ist, seine Kräfte einzuteilen. Hat man also bei vierzig Grad einen praktisch senkrechten Anstieg vor sich und sprintet dann hinauf, so schnell einen die Füße tragen, kann das nicht gut gehen. Der dichte Dschungel am Fuß des Bergs war schon schwierig genug zu bewältigen, aber der Anstieg danach war grässlich – grässlich schweißtreibend, bei grässlich schwergängigem Untergrund.
Ich ermahnte mein Team, dass sich alle ein bisschen zurückhalten und ihre Kräfte einteilen sollten, aber dann kam kurz vor dem Gipfel ein extrem steiler Grat, der letzte Anstieg, bevor es wieder eben wurde. Irgendwoher nahm Staffan die Superkräfte, um die letzten fünfzig Meter hinaufzurennen. Also rannten wir anderen ebenfalls, um zusammenzubleiben, aber die Gluthitze – es ging nicht das kleinste Lüftchen – forderte zu guter Letzt doch ihren Tribut und wir saßen einfach da, unfähig uns zu bewegen.
Bei der Ankunft in der nächsten Wechselzone waren wir nicht mehr gut in Form – und dass uns das Wasser ausgegangen war, machte es nicht besser. Da sich ein Streckenabschnitt, der auf der Karte wie die einfache Überquerung eines Hügels aussah, als viel länger und anstrengender herausgestellt hatte, kam uns der Verdacht, dass das ganze Rennen viel härter werden würde als alle, an denen wir bisher teilgenommen hatten.
Am Beginn der nächsten Etappe erwarteten uns erneut große Hitze und noch mehr Berge, aber dafür nicht ganz so viele böse Überraschungen, wie ich befürchtet hatte. Lange ging es über Geröll einen Kamm entlang, von dem aus man die Ebene des Pantanal überblicken konnte, und die Götter schickten uns eine sanfte Brise, die uns vor den Stichen der höllischen Moskitos bewahrte. Doch schon bald stand die Sonne wieder hoch am Himmel und mit ihr war auch die Hitze zurück, sodass die folgenden fünfunddreißig Kilometer eine ebenso große Strapaze wurden wie der Aufstieg am Tag zuvor. Wieder ging uns das Wasser aus, aber diesmal beschlossen die Götter uns Bäche und Flüsse vorzuenthalten. Wir hatten schrecklichen Durst und litten, obwohl wir dank der relativ kühlen Nacht zwei, drei Stunden Nachtruhe bekommen hatten, an schwerem Schlafmangel.
Durst und Hitze machen nicht nur alles schlimmer, man ist vor allem dehydriert und dadurch wahrscheinlich verwirrt und blöd im Kopf. Jedenfalls fiel es mir schwer, die anderen anzuspornen, und ich war deprimiert, weil wir so schleppend vorankamen. Wie ein Racing-Freund immer sagt: „Wenn du gemütlich zu Hause sitzt, wärst du gern draußen beim Adventure-Racing, und mitten im Rennen würdest du gern gemütlich zu Hause sitzen.“ Ich war gerade ständig in Gedanken zu Hause.
Als wir endlich die Wechselzone erreichten, wollten wir nichts als essen, trinken und schlafen. Vor allem schlafen. Aber es war keine Zeit, sich ordentlich auszuruhen; wir mussten schnell wieder auf die Beine und weiter – wenn meine Schätzungen stimmten, konnten wir mindestens noch zwei Plätze gutmachen, wenn wir unsere Ruhepause kurz hielten.
Als wir also zur Kajaketappe wieder am Wasser ankamen, waren wir genauso fertig wie am Tag davor. Trotzdem war mir auf unserem Weg hinunter zu den wartenden Booten klar, dass wir auf dieser Etappe eine besonders gute Zeit erreichen mussten, wenn wir unter den ersten Fünf landen wollten.
Beim Fertigmachen der Kajaks spürte ich von hinten einen leichten Windhauch. Wir konnten also mit Rückenwind stromabwärts paddeln. Zum ersten Mal waren die Bedingungen wie dafür gemacht, eine meiner Ideen auszuprobieren, mit denen man Rennen gewinnt. Nachdem ich die beiden Kajaks miteinander vertäut hatte, setzte ich das kleine Segel, dass wir tief unten in unserer Equipmentbox mitgebracht hatten. Marika und Jonas sprangen in das erste Boot, Jonas und ich kletterten in das zweite.
„Jetzt bekommen wir unsere zwei Stunden Schlaf“, sagte ich zu meinem Team, als wir ablegten. Alles lief genau nach Plan. Da beide Boote miteinander vertäut waren, konnten wir uns mit Paddeln und Schlafen abwechseln, wir steuerten vorsichtig durch die Nacht und kamen gut vorwärts.
Besonders bequem schläft man zwar nicht – eingewickelt in eine dünne Rettungsdecke wie ein Würstchen im Schlafrock auf dem Boden eines Kajaks –, aber wenigstens mussten wir mit dem Schlafen nicht bis zum Beginn der nächsten Etappe warten. Wir erreichten die Wechselzone sogar schneller, als ich gehofft hatte. Das war eine der besten Etappen meiner gesamten Adventure-Racing-Karriere. Und so traten wir zum nächsten Abschnitt – dem offenbar härtesten dieses Rennens – etwas zuversichtlicher an.
Eine Stunde später wateten wir durch Sümpfe und Flüsse und kamen nur quälend langsam vorwärts. In diesem Dschungel gab es offenbar nur knochentrockene Gluthitze oder Sümpfe und alles bedeckendes Wasser, aber nichts dazwischen. Und dieser Abschnitt war ein nasser. Uns blieb nichts anderes übrig, als so gut es ging durchs Wasser zu waten – und dabei vor uns mit unseren Stöcken nach Stachelrochen zu tasten.
Eine weitere Stunde später waren Rochen noch das geringste Problem. Jetzt schwammen um unsere Beine ganz andere Wesen herum. Da ich die hilfreichen Hinweise der Veranstalter noch im Kopf hatte, wusste ich auf einmal, welche: Piranhas – eine Art „mit kräftigen Kiefern, wie dafür geschaffen, Fleisch zu zerreißen“.
„Oha! Das ist jetzt nicht wahr, oder?“, rief ich den anderen zu. „Schaut euch die Kerle an. Piranhas. Das müssen Hunderte sein.“
„Ahaaa“, sagte Jonas. „Ist aber wohl in Ordnung. Ich glaube, im Buch stand, dass die nur angreifen, wenn sie sich in die Enge getrieben fühlen oder wenn Blut im Wasser ist.“
„Gut“, sagte ich, „also Ruhe bewahren und bitte nicht bluten.“
Das schien mir auch für den nächsten Flussabschnitt zu gelten. Wir kamen um eine Biegung, als es gerade dunkel wurde, trotzdem konnte ich eine Menge junger Krokodile ausmachen, die nebeneinander am Ufer lagen. Wir hörten die Schnappgeräusche ihrer Kiefer. Es klang, als würden sie sich für die nächtliche Jagd in Stimmung bringen.
Während wir durch den Sumpf, der sich an beiden Ufern erstreckte, langsam an ihnen vorbeiwateten, wurde es immer dunkler. Uns blieb nichts anderes übrig, als unsere Stirnlampen anzuschalten, obwohl wir genau wussten, was dann passieren würde.
Und tatsächlich, als hätten sie hinter den Kulissen nur auf das Bühnenlicht und ihr Stichwort gewartet, waren plötzlich überall Moskitos, Riesenwespen und fliegende Ameisen. Wir spürten ihre bösartigen, juckenden Stiche. Die Ruhe zu bewahren und nicht zu bluten wurde immer schwieriger. Besonders als uns einfiel, dass die Brasilianer diese Tageszeit „Schlangenzeit“ nennen.
Bei unserem letzten Blick auf die Karte war es besonders schwierig gewesen, unsere Position zu bestimmen – wenn im Maßstab 1 : 100 000 ein Zentimeter für einen Kilometer steht, kann man sich vorstellen, dass die Karte nicht besonders detailreich ausfällt. Und wir standen in einem Regenwaldgebiet von 200 000 Quadratkilometern! Gut möglich, dass wir zuletzt ganz falsch gegangen waren, aber wahrscheinlich behielten wir am besten einfach unsere Richtung bei und hofften, dass wir uns grob auf das richtige Gewässer zubewegten, wo die nächste Etappe begann.
„Das ist ja noch schlimmer als Ecuador! Nur dass wir uns diesmal nicht noch um einen Hund kümmern müssen.“ Staffan beugte sich frustriert über die Karte.
Bei dem Gedanken an Arthur überkam mich plötzlich eine seltsame Schwäche. Da stand ich hier in dieser Hitze am anderen Ende der Welt, während er zu Hause im Schnee bei dem Rest unserer Familie war. Hätte ich nicht selbst am besten gewusst, wie viel mir dieser Sport bedeutete, ich hätte mich gefragt, was ich eigentlich hier zu suchen hatte. Ich konnte nichts tun, als kurz innezuhalten und zu hoffen, dass er gerade fröhlich durch den Schnee rannte und mich nicht zu sehr vermisste.
Gleichzeitig wurden die Angriffe der Insekten immer heftiger. In dem Versuch, mich selbst zumindest ein bisschen zu schützen, schaltete ich meine Stirnlampe aus und hoffte auf das Beste. Auf festem Boden bewegten wir uns zu diesem Zeitpunkt schon nicht mehr; überall um uns herum war Wasser. Wir mussten beim Schwimmen versuchen die Richtung beizubehalten, schoben gleichzeitig mit unseren Stöcken die dichte Vegetation vor uns zur Seite und wehrten größere Schlangen und Fische ab.
Schließlich stießen wir wieder auf Land und beschlossen uns eine Pause zu gönnen und einen Blick auf die Karte zu werfen. Wir legten sie auf den Boden, schalteten die Lampen an und beugten uns darüber. Gerade als unsere müden Augen versuchten unseren vermutlichen Standort zu fokussieren, erschreckte uns ein vielfaches durchdringendes Quietschen von links. Wildschweine. Eine ganze Rotte.
Hinter uns war Wasser und links und rechts der Dschungel. Staffan schlug vor, auf einen der drei, vier Bäume zu klettern, die gleich am Ufer standen. Ich fand, sie sahen viel zu dürr aus, um unser Gewicht zu tragen, aber das Quietschen und die Hufgeräusche kamen immer näher und waren schon so laut, dass wir vermutlich auch versucht hätten Bambusstangen hochzuklettern. Just als wir uns an den Ästen hochzogen, hörten wir neues Gequietsche, diesmal von der anderen Seite. Noch eine Wildschweinrotte.
Irgendwo im Dschungel trafen beide aufeinander. Schließlich mussten sie sich geeinigt haben, denn nach einem weiteren quietschenden Gezeter erstarb das Geräusch der Hufe und wir blieben aufgewühlt am Flussufer zurück. Mitten in die Stille hinein war plötzlich ein lautes Krachen zu hören. Das Geräusch von schnappenden Krokodilkiefern ganz in der Nähe in der Dunkelheit.
Jetzt, fand ich, war es angebracht, sich ein kleines bisschen zu fürchten.
Wie sich herausstellte, waren wir tatsächlich in die richtige Richtung geschwommen und nach weiteren drei Stunden erkannten wir eine Landebahn und mehrere Gebäude. Nachdem wir uns in der Wechselzone dankbar auf den Boden hatten fallen lassen, erfuhren wir, dass zwar vier Teams bereits durchgekommen waren, die Veranstalter aber entschieden hatten, es bliebe nicht genug Zeit, die ganze Rennstrecke zu absolvieren. Bei nur zwei weiteren Renntagen lag noch die Packraftingetappe vor uns und danach 27 Kilometer Trekking, 85 Kilometer Kajak und 251 Kilometer auf dem Mountainbike. Das war selbst für durchtrainierte Ausdauerathleten ein bisschen viel.
Das Rennen wurde daher verkürzt und die Teams wurden in Dreisitzerflugzeugen zum Start der abschließenden Bikeetappe geflogen. Als wir zusammengequetscht in dem winzigen, lauten Doppeldecker über die Ebenen und den Regenwald des Pantanal flogen, war mir nicht danach zumute, die Aussicht zu bewundern. Ich war viel zu sehr damit beschäftigt auszutüfteln, welche Konsequenzen all das für unsere Position im Rennen haben würde. Zwar war es unmöglich, die Platzierungen auch nur annähernd genau vorherzusagen, doch ich war mir recht sicher, dass unser Platz unter den ersten Sechs der jährlichen Gesamtwertung ernsthaft in Gefahr war, solange vier Teams ins Ziel kamen. Als wir nach einem unruhigen Landeanflug, der unseren Nacken strapazierte, auf dem holprigen Runway aufsetzten, war ich ziemlich niedergeschlagen. Keine gute Einstellung vor dem Start einer zweihundertfünfzig Kilometer langen Bikeetappe, die als eine der härtesten in diesem ohnehin extrem harten Rennen ausgewiesen war.
Fast unmittelbar nach dem Start wurden unsere Bikes durch den Sand ausgebremst, der in alle Ritzen zu dringen schien, von unseren Rädern angefangen bis hin zu unseren Augen und unseren Schuhen. Die Temperatur stieg wieder über vierzig Grad und bald ging uns das Wasser aus. Es war so glühend heiß, dass es niemanden überraschte, als wir ausgerechnet mitten auf unserer Strecke in einiger Entfernung Flammen lodern sahen: offenbar ein riesiges Buschfeuer.
Je näher wir kamen, desto heißer wurde es, und bevor es dunkel wurde, wollten wir abseits unseres Weges versuchen, irgendwo Wasser zu finden – egal in welcher Form. Unser Weg führte uns nah an das Feuer heran, doch als wir es durch das angrenzende Dickicht umgingen, erhellte es mit einem Mal eine schillernde, glitzernde Fläche. Ich begriff, wie es Menschen geht, die in der Wüste halb verdurstet halluzinieren. Dann aber, ganz leise, hörten wir das Geräusch zuschnappender Kiefer. Das konnten nur Krokodile sein, und das wiederum konnte nur bedeuten, dass es hier tatsächlich Wasser gab. Gute und schlechte Nachrichten zugleich.
Es war nicht viel mehr als ein Tümpel. Während wir auf Knien unsere Wasserflaschen füllten, versuchte ich die inzwischen vertrauten Schnappgeräusche auszublenden. Beim Aufschauen jedoch sah ich drei große Augenpaare durch das Halbdunkel schimmern. Die Krokos lagen gerade mal auf der anderen Seite des kleinen Gewässers. Zügig füllten wir unsere Flaschen. Ich hielt meine in den Strahl der Stirnlampe, um nachzusehen, was wir da abgefüllt hatten. Es sah aus wie schlammige Cola. Und es schmeckte dreimal schlimmer. Wir beteten, dass wir uns mit dem Wasser keine obskuren Krankheitserreger eingefangen hatten, und legten uns hin, um eine Stunde dringend benötigten Schlaf aufzuholen.
Als gefühlte Minuten später die Sonne aufging, sah der Himmel viel dunkler aus als am vorherigen Tag. Sollte das tatsächlich bedeuten, dass Wolken aufzogen – und damit Regen? So war es. Als es zu regnen begann, schauten wir zum Himmel auf und es kam uns vor, als würden unsere Körper das ersehnte Nass wie Schwämme aufsaugen.
Wenig später führte unser Weg einen Fluss entlang. Da uns von den vorherigen Tagen noch immer alles wehtat, entschied ich, dass wir am besten mithilfe unserer Bikes stromaufwärts schwimmen würden – die Luft in den Reifen hielt sie an der Oberfläche und wir kamen gut vorwärts. So gut, dass ich Gelegenheit hatte, mich umzusehen.
Einen Augenblick lang begriff mein Gehirn nicht, was ich da vor mir sah. War es ein besonders dicker Reifen, vielleicht von einem Traktor? Oder eine Baumwurzel, die aus irgendeinem Grund bis in die Flussmitte ragte? Dann begriff ich, dass es eine Anakonda war. Und ich konnte Beulen in ihrem Körper erkennen: Sie fraß gerade etwas. Etwas, das fast so groß war wie sie selbst. Unwillkürlich musste ich an ein Video zurückdenken, in dem eine Anakonda eine Kuh verschlingt. Ich versuchte den Gedanken wegzuschieben und konzentrierte mich darauf, so ruhig ich konnte weiterzuschwimmen, obwohl sie an einem Punkt kaum drei Meter von mir entfernt war.
Als wir die Flussmündung erreichten, hatte ich die vage Ahnung, dass am Ufer Leute angelten, und ebenso vage nahm ich wahr, dass sie uns mit offenem Mund anstarrten. Jau, dachte ich, vermutlich sind wir tatsächlich so bescheuert, wie wir aussehen. Gleichzeitig empfand ich einen tiefen Respekt für die Menschen, die hier lebten – in einem Land, das offenbar alles daransetzte, uns durch die Mangel zu drehen – so wie es die Anakonda machte, an der ich gerade vorbeigekommen war.
Allerdings hatte der Adrenalinschub mir arg zugesetzt, denn sobald wir uns wieder auf unsere Bikes setzten, war die Erschöpfung wieder da und ich fühlte mich fiebrig. Inzwischen stand die Sonne hoch. Die Hitze war unerträglich und der Sand machte es noch schwerer voranzukommen als bisher. Da ich nicht in der Lage war, durch den Sand bergauf zu fahren, schob ich mein Bike. Allmählich stellten sich die klassischen Symptome eines Hitzschlags ein – anders ließen sich das Fieber, die Schwäche und die Erschöpfung nicht erklären. Als ich versuchte wieder aufs Bike zu kommen, brach ich am Wegrand zusammen. Nach drei Versuchen zog Jonas mich hoch und befestigte ein Schleppseil an seinem Bike. Eine Zeit lang ging das gut, aber ich fühlte mich schwächer, als ich mich je gefühlt hatte, fast so, als wollte mein Körper sich gleich abschalten. Während ich erbittert versuchte mich darauf zu konzentrieren, auf den Beinen zu bleiben und jeder Muskel sich anspannte, begannen die Halluzinationen. So muss es sich anfühlen, hörte ich mich denken, kurz bevor dein Körper aufgibt und du stirbst.
Und sobald ich mir gestattete ans Sterben zu denken, wurde meine Verzweiflung noch größer. Ich würde das Licht meines Lebens zurücklassen, Helena, meine süße Philippa und unseren frisch eingetroffenen Thor. Und ich würde Arthur zurücklassen, dem unsere Freundschaft das Leben gerettet und ein neues Leben geschenkt hatte.
In meinem Fieberwahn in der Hitze des Dschungels sah ich Arthur jetzt direkt vor mir. So deutlich, als wäre er wirklich da. Er ging langsam und ohne Zögern voran, ohne nach links und rechts zu schauen, still und entschlossen, wie bei unserem ersten Zusammentreffen, als wüsste er, dass ich ihm folgen würde, wohin auch immer er ginge. Ich spannte alle Muskeln an und fand irgendwie die Kraft, einen Fuß vor den anderen zu setzen, dann folgte ich dem Pfad, den Arthur für mich durch das Gestrüpp bahnte.
„Okay, mein Junge“, flüsterte ich. „Wenn du es schaffst, schaff ich es auch. Ich werde ebenso wenig aufgeben wie du damals. Mit uns beiden ist es noch nicht zu Ende.“
Irgendwoher nahm ich die Kraft, den letzten Abschnitt hinter mich zu bringen. Als ich die Ziellinie überquerte, schaute ich zum Himmel und schickte Arthur und meiner Familie ein stilles Dankeschön. Ich konnte es kaum erwarten, nach Hause zu kommen und sie in der Wirklichkeit in die Arme zu schließen.
| NAME: Billy ALTER: 12 BESITZERIN: Ann HERKUNFT: Nawzad, Afghanistan HEUTE: Hertfordshire, Großbritannien |
„Billy hat einen weiten Weg hinter sich gebracht, ehe er unser Hund wurde. Ich war schon immer eine Hundenärrin und bin mit Hunden aufgewachsen, doch obwohl das bei meinem Mann anders war, wollten wir beide immer einen haben. Dass ein Hund aus dem Laden nicht infrage kam, stand fest, denn über Massenzüchter wussten wir Bescheid, und nachdem wir lange in einer kleinen Wohnung gelebt hatten, die laut Auskunft der Rettungsorganisationen für Hunde ungeeignet war, konnten wir es nach dem Umzug in ein Haus kaum erwarten, einen Tierschutzhund zu adoptieren! Unsere ersten beiden Hunde waren zwei Westies: Daisy und Tommy, die das reife Alter von fünfzehn und sechzehn Jahren erreichten.
Da ich ehrenamtlich als Spendensammlerin für die Wohltätigkeitsorganisation Nowzad arbeite, die in Afghanistan Streuner und ausgesetzte Tiere rettet, stand eigentlich immer schon fest, dass wir einen Hund von dort retten wollten. Die Geschichten, die ich über die Tiere gehört hatte, auch darüber, wie manche misshandelt werden, hatten mich sehr bewegt. Als wir allerdings Billy zum ersten Mal sahen, hatten wir eigentlich gar nicht vor, einen Hund zu adoptieren – wir wollten nämlich ein paar Jahre ohne Hund verbringen, damit wir häufiger übers Wochenende aufs Festland reisen konnten. Damit war es vorbei, als ich auf der Nowzad-Website Billy entdeckte und mich gleich in ihn verliebte, und noch bevor ich meinem Mann überhaupt davon erzählen konnte, erzählte er mir gleich nach der Arbeit von einem Hund, den er im Netz bei Nowzad gesehen habe und der ihm gefalle – und das war Billy. Damals war Billy schon im gesetzteren Alter – fast zwölf –, und nachdem wir gelesen hatten, woher er kam und warum er in dem Tierheim war, waren wir fest entschlossen, dass wir ihm für seinen Ruhestand ein gutes Heim bieten wollten. Da es sehr teuer ist, einen Hund aus Afghanistan hierherzuholen, glaubten wir, es würden sich wegen seines fortgeschrittenen Alters wahrscheinlich kaum Leute für Billy interessieren, sodass er den Rest seines Lebens in dem Tierheim verbringen müsste.
Wenn ich Billy manchmal betrachte, kann ich kaum glauben, was er alles durchgemacht hat. Billy ist ein echter Kriegsveteran. 2006 und 2007 leistete er tapfer seinen Dienst im Irak und 2009 wurde er nach Afghanistan versetzt, wo er als Sprengstoffspürhund arbeitete. 2015 wurde er in die Provinz Kundus entsandt und dort war er noch, als die Taliban an die Macht kamen. Leider mussten seine Hundeführer damals fliehen, sodass er in den Händen der Taliban blieb. Was während dieser Zeit mit ihm geschah, wissen wir nicht; nur so viel ist sicher: Als die Regierungstruppen die Stadt Kundus zurückeroberten und Billy erneut zu ihnen kam, hatte er große Angst vor Männern und konnte nicht mehr arbeiten. Billy, der wahrscheinlich während seiner Dienstjahre vielen das Leben gerettet hat, wurde aufgegeben und in seinem Holzverschlag zurückgelassen, bis Nowzad ihn rettete und zur Adoption ausschrieb.
Wie jeder weiß, der schon einmal einen Hund aus einem fernen Land adoptiert hat, ist das ein langwieriger, komplizierter und teurer Prozess. Nachdem wir uns dazu entschlossen hatten, dauerte es bis zum 1. Dezember 2016, bis Billy nach drei Monaten Quarantäne in Afghanistan endlich in Großbritannien eintraf. Er landete morgens um 7 Uhr 20 am Terminal 5 von Heathrow und kam fünf Stunden später aus dem Animal Reception Centre des Flughafens. Als wir ihn zu uns nach Hause gebracht hatten, rannte er mit hundert Stundenkilometern durch das ganze Haus und beschnupperte auch noch den letzten Quadratzentimeter – als früherer Sprengstoffspürhund sucht er alles nach Bomben ab. Inzwischen weiß er, dass wir keine im Haus haben, und ist viel ruhiger geworden.
Angesichts seiner Vergangenheit ist Billy bemerkenswert brav. Nur wenn mein Mann das Haus verlässt, dreht er durch, denn zwischen den beiden hat sich eine starke Bindung entwickelt. Bereits durch seine Zeit bei der Armee ist er besonders gut abgerichtet und außerdem als älterer Hund wohl schon etwas ruhiger geworden und froh darüber, eine Familie zu haben. Futter steht bei ihm sehr im Mittelpunkt (sein Leibgericht ist Naan-Brot) und mit Tischmanieren ist es bei ihm nicht weit her, doch der Fairness halber muss man Billy zugutehalten, dass er ja nie welche gebraucht hat.
Für sein Alter hat er eine unfassbare Energie und lässt sich von den anderen Hunden im Park nicht so schnell unterkriegen. Da Sprengstoffspürhunde als Belohnung häufig mit Tennisbällen spielen dürfen, ist Billy geradezu verrückt danach. Es dreht sich dann alles um den Ball. Auf der anderen Seite ist er unheimlich liebevoll und kuschelt sich häufig auf der Couch an mich.
Obwohl man meinen sollte, dass sich bei einem älteren Hund die Verspieltheit schon herausgewachsen hat, bringt uns Billy noch jeden Tag zum Lachen. Erst letzte Woche sind wir zum ersten Mal mit ihm in Urlaub gefahren, an die Küste von Norfolk. Wir wollten ihn unser Ferienhaus zuerst frei erkunden lassen, damit er sich schlafen legen konnte, wo er wollte, und damit schien alles geregelt. Aber als wir in der ersten Nacht im Bett lagen, hörten wir ein lautes Geräusch und fragten uns, was er wohl trieb. Als ich nachsah, stellte ich fest, dass er in die Badewanne gesprungen war, wo er sich nun, die Nase an den Duschvorhang gedrückt, wunderte, wie zum Teufel er da wieder herauskommen sollte!
Seit wir Billy haben, wissen wir, dass ein Tierschutzhund ein wunderbarer Gefährte sein kann und dass es viele großartige Hunde gibt, die ein liebevolles Zuhause verdienen. Dabei geht es nicht nur um den Hund – auch für die Menschen ist das fantastisch. Für uns war ein Haus ohne Hund kein Zuhause, und seit Billy da ist, haben wir wieder eins. Alles, was er heute möchte, ist Zuneigung von morgens, wenn er wach wird, bis zum Schlafengehen. Und die bekommt er.“
| NAMEN: Ted und Zigge Stardust (alias „The B Boys“) ALTER: Ted 6, Zigge 2 BESITZERIN: Caisa HERKUNFT: Irland; Ted aus dem Tierheim „Dog Rescue Coolronan“ und Zigge von Maureen Scanlon aus Sligo. Ihre Adoption wurde durch die schwedische Organisation „FriendsForever“ vermittelt. HEUTE: bei Stockholm, Schweden |
„Wenn man sich meine beiden Jungs, Ted und Zigge, heute anschaut, würde man nie glauben, was sie hinter sich haben. Bereits als Kind und auch als Erwachsene hatte ich Hunde und schon vor meinen B Boys lebte ein Tierschutzhund bei mir. Kaufen wollte ich nie einen, wo es doch so viele ungewollte Hunde auf der Welt gibt. Mit meinem Sohn wohne ich in einer schwedischen Kleinstadt in einer Wohnung, was für zwei Hunde vielleicht nicht ganz ideal ist, aber überall in der Nähe kann man sie super laufen lassen und deshalb hatte ich mir vorgenommen einen in Pflege zu nehmen.
Wahrscheinlich wundern Sie sich jetzt, aber in Irland gibt es viele Hunde, die in Pflege genommen werden müssen, und die schwedische Wohltätigkeitsorganisation FriendsForever koordiniert das. Der erste Hund, der mir am Telefon vorgeschlagen wurde, war Ted – Dog Rescue Coolronan in Irland war benachrichtigt worden, dass auf einer Farm ein Border Collie Tag und Nacht angekettet sei, und jemand ging hin, um den Besitzer davon zu überzeugen, den Hund der Organisation anzuvertrauen. Da die Mitarbeiter nach der Rettung feststellten, dass er blind war, und sich Sorgen machten, dass sie kein Heim für ihn finden würden, fragten sie mich, ob ich ihn in Pflege nehmen wolle. Ich hatte weder jemals zuvor einen blinden Hund besessen noch war ich einem begegnet und versuchte mich online zu informieren, doch viel konnte ich dazu nicht finden. Dennoch beschloss ich das Wagnis einzugehen.
Schwach, verwirrt und dünn kam Ted 2013 bei mir an. Da er sein ganzes Leben im Freien gehalten worden war, verwirrte es ihn, in einem Haus zu leben. Er war sogar noch nie eine Treppe hinaufgestiegen. Als blinder Hund musste er sich erst eine ‚Karte‘ von unserer Wohnung anlegen, indem er umherging und sich den Grundriss einprägte (am ersten Tag pinkelte er ins Wohnzimmer, während er noch erkundete, wo was war, doch schon sehr bald hatte er es begriffen). Durch die Umstände seiner Aufzucht war der Umgang mit Menschen, vor allem Knuddeln und andere Berührungen, ziemlich ungewohnt für ihn, doch wir ließen ihm Zeit, sich in Ruhe daran zu gewöhnen. Da er uns nicht sehen konnte, sagte ich immer, wenn er aufwachte: ‚Ich bin hier, Ted‘, denn ich machte mir Sorgen, dass er vielleicht nicht mehr wusste, wo er war. Doch damit hatte er offenbar nie Probleme – Ted kam einfach mit allem zurecht, was ich mit ihm ausprobierte. Das ist typisch für ihn – er ist unglaublich ruhig und gelassen. Und nach zwei Tagen wurde mir klar, dass ich ihn nicht in Pflege nehmen wollte. Ich wollte ihn adoptieren.
Zwei Jahre später sprach man mich wegen eines ähnlichen Hunds an, den Maureen Scanlon aus abscheulichen Umständen befreit hatte – wieder ein Border Collie, der auf einem Hof im Freien angebunden gewesen war. Offenbar war er sehr ängstlich und hatte sogar nie ordentliches Futter bekommen. Ich sagte sofort zu und schon bald kam er zu mir nach Schweden. Wir nannten ihn Zigge Stardust: Zigge, weil er nicht geradeaus, sondern quasi nur im Zickzack gehen konnte, und Stardust, weil er im rechten Auge eine Linsentrübung hat. Zigge hatte einen ganz anderen Charakter als Ted. Er war sehr ängstlich, versteckte sich ganz hinten in seiner Box und es schien ihm alles zu viel zu sein. Es dauerte lange, bis er mir vertraute. Weil er mit der Treppe überhaupt nicht zurechtzukommen schien, trug ich ihn die ersten Wochen hinauf, und da er so daran gewöhnt war, im Freien zu sein, kam er anfangs drinnen überhaupt nicht zur Ruhe und lief vor lauter Stress ständig umher. In der ersten Zeit musste ich ihn auch drinnen anleinen, damit er sich beruhigte. Doch er genoss es, den Bauch gestreichelt zu bekommen und in meiner Nähe zu sein, und ganz allmählich machten wir Fortschritte.
Ich musste in das Training von Zigge viel Zeit investieren, bis er Treppen steigen konnte, mit den Geräuschen von draußen zurechtkam und sein Stress sich legte. Natürlich sind aus schwierigen Verhältnissen gerettete Hunde mit höherer Wahrscheinlichkeit verhaltensauffällig, doch ich bin der Ansicht, dass man mit Zeit und Geduld etwas daran ändern kann. Zigge fürchtete sich vor vielen Geräuschen (das liegt vermutlich nicht daran, dass er blind ist, sondern dass ihm soziale Erfahrungen fehlen) und ich habe tagelang neben ihm an Orten gesessen, die ihm Angst machten, wo viele Menschen waren und viel Verkehr herrschte. Mein Ansatz ist: Ja, ich merke, dass dir das Angst macht, aber wir machen das trotzdem! Bis dein Bauch und dein Kopf nicht mehr ‚Schnell weg!‘ rufen und du dich entspannen kannst. Zigge hat schon große Fortschritte gemacht, aber noch arbeiten wir daran. Offenbar steckt bei all dem Stress und der geringen Selbstachtung doch ein sturer Hund in ihm und daher dauert das Training eben länger.
Ganz unerwartet hat die Adoption von Ted und Zigge sie zu Botschaftern für blinde Hunde gemacht. Ehe ich sie zu mir nahm, versuchte ich so viel wie möglich über blinde Hunde herauszufinden, konnte aber nur ganz wenige Informationen auftreiben. Eigentlich hieß es immer nur: ‚Es kann klappen, solange man sie immer an der Leine hält und stets die gleichen Wege mit ihnen geht.‘ Doch mit Ted und Zigge habe ich andere Erfahrungen gemacht – sie können noch viel mehr. Ich habe angefangen für meine Familie und Freunde Videos auf Facebook zu posten, in denen man ihnen beim Spielen und bei ihrem Hundeleben zuschauen kann, und auf die Anregung einiger Leute hin eine eigene Website über sie eingerichtet. Einen so überwältigenden Zuspruch hätte ich nicht erwartet. Manche haben die Seite besucht, weil sie erfahren hatten, dass ihr geliebter Hund langsam blind wurde, und sie sich ein Bild davon machen wollten, welche Lebensqualität sie für ihn erwarten durften. In Schweden nehmen Augenprobleme bei Hunden zu, doch von Leuten (und Hunden!), die einem zeigen, dass auch Hunde ohne Augenlicht ein gutes Leben haben können, erfährt man nicht viel. Manche, die erfahren hatten, dass ihr Hund erblinden würde, haben mir erzählt, sie hätten von vielen – darunter echte Hundekenner – den Rat bekommen, ihn einschläfern zu lassen. Doch Ted und Zigge sind der lebende Beweis, dass das nicht sein muss. Die Facebook-Seite der Blind Boys ist ein tolles Forum für Hundefans und wir haben uns sogar schon mit einigen von ihnen verabredet, sodass Ted und Zigge jetzt überall viele neue Freunde haben.
Durch meine Hunde, die heute hier in Schweden in meiner Wohnung leben, Treppen steigen, im Auto mitfahren können und trainiert werden, sich noch mehr auf ihre Nase zu verlassen, habe ich gelernt, dass nichts unmöglich ist – manchmal braucht es eben seine Zeit. Es ist eine solche Freude gewesen, zu beobachten, wie sich ihre Persönlichkeiten mit den Jahren entwickelt haben. Ted ist noch immer der gelassene, ruhige Teddybär, der mir auf Schritt und Tritt mit seinem Lieblingsquietschtier im Maul folgt (der Rest der Familie findet das ständige Quietschen weniger schön). Wenn er anderen Hunden begegnet, weiß er sofort, wie ihre Laune ist, aber selbst wenn sie Angst haben oder es sich um aggressive Rüden handelt, macht das Ted nichts aus – er geht einfach weiter. Zigge hat seine wahre Persönlichkeit nicht so schnell preisgegeben. Auch wenn laute Geräusche ihm immer noch Angst machen, ist er heute recht selbstständig und fröhlich und erkundet die Welt gern auf eigene Faust. Als er ein rundes Jahr bei uns war, wurde er auf einmal sehr gesprächig, und wenn wir heute etwas unternehmen, was er mag – spazieren gehen, Freunde besuchen oder fressen –, ist Heulen angesagt! Außerdem hat er einen neuen Trick drauf: Wenn er nicht nach Hause will, wirft er sich zu Boden. Da kann man an der Leine ziehen, wie man will, er bewegt sich kein Stück …
Blinde Hunde sehen mit dem Herzen, und zu wissen, dass man ein Tier glücklich gemacht hat, ist ein unvergleichliches Gefühl. Umgekehrt machen auch sie einen glücklich. Wenn Sie also genug Zeit und Geduld haben, adoptieren Sie einen Hund! Sie werden viel zurückbekommen und außerdem retten Sie damit ein Leben.“
| NAME: Camila ALTER: etwa 5 BESITZERIN: Mariela HERKUNFT: Heredia, Costa Rica (vermittelt durch „Amigos de la Calle“) HEUTE: Florida Keys, USA |
„Weil es in Costa Rica, wo ich aufgewachsen bin, viele Straßenhunde gibt, hat meine Familie ihre Hunde immer gleich von der Straße weg adoptiert. Als Teenager habe ich meinen ersten Straßenhund bekommen und ihnen bin ich treu geblieben. Sie sind Überlebenskünstler, clevere Hunde, die gelernt haben das Wesen von Menschen zu erkennen, das Gute wie das Böse in ihnen, und wenn sie die Liebe einer Familie erfahren, bleiben sie ihr treu.
Heute lebe ich mit meinem Mann auf einer der Inseln vor Florida. Von Camila haben wir durch meine Mutter erfahren, die sie zu Hause in Costa Rica in Pflege hatte. Zuerst fühlte sich mein Mann noch nicht bereit einen neuen Hund aufzunehmen, denn erst kurz zuvor war unser Deutscher Schäferhund gestorben. Da wir selbst keinen Nachwuchs haben, sind unsere Haustiere unsere Kinder, und als wir eines von ihnen verloren, waren wir beide am Boden zerstört. Allerdings wussten wir, dass wir irgendwann wieder einen Hund adoptieren wollten – warum also warten? Wir reisten daher nach Costa Rica, um Camila persönlich kennenzulernen.
Ihr Leben hatte furchtbar begonnen. Von meiner Mutter hatte ich das erste Bild, das ich von Camila zu sehen bekam: Sie war im Hinterhof eines Hauses in der Nachbarschaft an einer kurzen Kette angebunden und hatte weder Futter noch Wasser noch einen Unterschlupf. Die Regenzeit in Costa Rica dauert neun Monate und sie litt eindeutig große Qualen. Später erfuhren wir, dass sie außerdem ein gebrochenes Bein hatte. Nach vielen Telefongesprächen stellte sich heraus, dass Camila bereits der Tierschutzorganisation Amigos de la Calle aufgefallen und zur Behandlung des Beins im Krankenhaus gewesen war und dass sie sich nur übergangsweise in dem besagten Haus befand, weil sich noch keine Pflegefamilie gefunden hatte. Daher nahm meine Mutter sie. Ein Jahr blieb sie bei meiner Mum, wo ihr Bein heilte und sie sich erholte, doch eigentlich hatte meine Mutter gar nicht vorgehabt, sich einen Hund zuzulegen – wir aber wollten einen.
Als wir sie kennengelernt hatten, wusste ich gleich, dass sie für uns die Richtige war, aber mein Mann war am Anfang noch nicht so sicher. Da sie lange in Costa Rica gelebt hatte, machte ich mir allerdings Sorgen, wie sie wohl reagieren würde, wenn wir sie zu uns nach Hause holten. Schließlich war sie uns nur ein paarmal begegnet, sie hatte noch nie das Meer gesehen und außerdem wohnt eine Katze bei uns.
Größere Sorgen hätte mir eigentlich die Reise von Costa Rica nach Miami bereiten sollen. Aufgrund gestrichener Flüge und anderer Probleme dauerte sie über siebzehn Stunden und war sicher schrecklich für Camila, denn all das bedeutete eine Menge Stress. Bei der Landung nachmittags um zwei war es extrem heiß und feucht, und als ich sie aus ihrer Box nehmen wollte, knurrte sie und war sehr aggressiv. Schnell legte ich ihr die Leine an und gab ihr Wasser und Futter, aber sie wollte nichts.
Ich fuhr mit ihr zu einem Park in der Nähe, wo sie ihr Geschäft erledigte und ein bisschen Wasser trank, und als wir dann zurück zum Auto kamen, legte sie sich auf meinen Schoß. Ich merkte, wie sehr sie unter Stress stand, doch wenn ich versuchte sie zu streicheln, knurrte sie mich nur an. Ich machte mir Sorgen, dass es nach allem, was sie erlebt hatte, doch nicht klappen würde, aber ich wollte die Hoffnung nicht aufgeben. Zwei Stunden später gingen wir zu Hause mit ihr am Strand spazieren und zeigten ihr ihr Futter, ihren Wassernapf und ihre Matte. Sofort legte sie sich hin, als wüsste sie genau, dass dort ihr Platz war.
Obwohl sie eine starke Bindung zu meinem Mann entwickelte, war sie am Anfang ein sehr schüchterner Hund, der kein Spielzeug anrührte und immer darauf zu warten schien, dass wir ihr Kommandos gaben. Das machte mich traurig, denn ich wünschte mir, dass sie so wie andere Hunde sein sollte. Ich war mir nicht sicher, ob sie unglücklich oder nur verwirrt war. Da sie sich Fremden gegenüber sehr schüchtern zeigte und auf Leute, die sie streicheln wollten, losging, mussten wir in der Öffentlichkeit sehr vorsichtig sein. Heute jedoch, nach zwei Jahren, versteht sie, dass man nur liebevoll zu ihr sein möchte, und jetzt ist sie es, die sich Fremden nähert, um sich streicheln zu lassen. Sie weiß außerdem, wie sie ihren Spaß haben kann. Wir haben ihr ein Hundeplanschbecken gekauft, auf das sie total steht – wie auf alles, was mit Wasser zu tun hat –, und wir haben es sogar geschafft, ihr das Paddeln auf einem Paddleboard beizubringen.
Nachdem wir ihr helfen konnten ihre Furcht zu überwinden, lernten wir die wahre Camila kennen: einen verspielten, liebevollen, cleveren und sensiblen Hund. Wir haben den Eindruck, dass sie aus Dankbarkeit versucht alles so zu machen, wie wir es möchten. Außerdem passt sie gut auf uns auf und das war schon gleich zu Anfang so. Bei unserem ersten Besuch in Costa Rica schlief Camila unten an der Treppe, doch eines Nachts kam sie nach oben und weckte mich. Es war das erste Mal und sie bellte dabei nicht, sondern winselte und stupste mich mit der Pfote im Gesicht an. Damals kannte ich sie noch nicht so gut, und weil ich dachte, sie sei einfach nicht daran gewöhnt, mich in ihrem Haus zu haben, schickte ich sie weg. Doch dann ging sie zu meiner Mutter, die mit ihr die Treppe hinunterstieg, weil sie glaubte, Camila müsse mal vor die Tür. Als sie an der Küchentür vorbeikamen, blieb sie stehen und meine Mutter bemerkte, dass sie auf der heißen Herdplatte etwas stehen gelassen hatte, das kurz davor war, Feuer zu fangen.
Letztes Jahr, als wir im Nationalpark ‚Smoky Mountains‘ Ferien machten und gerade frühmorgens zum Wandern aufbrechen wollten, drehte ich mich um und sah einen ausgewachsenen Schwarzbären vielleicht zweieinhalb Meter von uns entfernt, der uns betrachtete. Ich stand stocksteif und wie gebannt von der Schönheit des Tiers – als Biologin habe ich eine Schwäche für große Säugetiere –, doch Sorgen machte ich mir darüber, was Camila jetzt tun würde. Ganz langsam kam sie herüber und stellte sich vor mich. Sie bellte und knurrte nicht, doch ich glaube, sie war bereit mich zu beschützen. Vorsichtig zog ich sie zu mir heran, und ohne den Bär aus den Augen zu lassen, zogen wir uns in unsere Hütte zurück. Glücklicherweise drehte er sich um und ging wieder in den Wald.
Das Beste an Cami ist, dass sie uns, wie viele andere Hunde, daran erinnert, wie wichtig es ist, dankbar zu sein für das, was man hat, und den Augenblick zu genießen. Immer wirkt sie glücklich und genießt die einfachen Dinge wie ihr Planschbecken nach dem Morgenspaziergang oder einen Ritt auf dem Paddleboard. Sie ist eine wunderbare Gefährtin und für unsere Familie einfach unersetzlich.
Einen Hund zu adoptieren gehört zu den besten Entschlüssen, die man fassen kann. Es wird Ihr Leben völlig verändern: Solche Hunde bringen einem viel Freude, und weil sie früher etwas anderes erlebt haben, zeigen sie sich dankbar für die Zuneigung und die Sicherheit, die ihnen eine Familie gibt. Ein anderer Vorteil ist, dass die meisten Streuner Mischlinge sind, und damit leiden sie nicht an den angeborenen Problemen, die bei manchen Rassehunden vorkommen. Ich bin der Ansicht, dass der Mensch für das Leid vieler Hunde die Verantwortung trägt – sei es durch Inzucht in Massenzuchtbetrieben oder für das Schicksal von Straßenhunden. Wenn Sie also Tiere lieben, tragen Sie doch lieber etwas zur Lösung des Problems bei und geben Sie einem heimatlosen Hund eine Familie.“