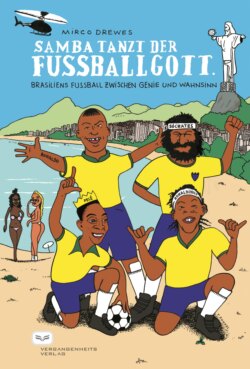Читать книгу Samba tanzt der Fußballgott - Mirco Drewes - Страница 7
Fußball – ein brasilianisches Lebensgefühl
Оглавление„Fußball ist eine höchst kreative menschliche Aktivität. Und sie ist reich an Emotionen. Es ist der Körper, von dem die ersten Kontakte mit den Gefühlen ausgehen. Der Körper ‚spricht‘ zuerst, ist der Schatten der Seele. Er besitzt kein Bewusstsein, rationalisiert nicht. Und weil er so real, so wahrhaftig und direkt ist, wird der Fußball von vielen so geliebt.“ Brasiliens Ex-Nationalspieler Tostão über Fußball als Spiel
„Ich behandelte ‚Bola‘ immer mit Aufmerksamkeit. Denn wenn man das nicht tut, widersetzt sie sich. Aber ich war stets der Herr, und sie gehorchte. Manchmal kam sie zu mir, und ich sagte: He! Meine Kleine ... Ich ging behutsamer mit ihr um als mit meiner Frau. Ich hatte eine tiefe Zuneigung zu ihr. Gerade weil sie hart sein kann. Wenn du sie schlecht behandelst, kann sie dir das Bein brechen!“ Brasiliens Ex-Nationalspieler Nílton Santos über den Fußball als Geliebte
Die Liebe der Brasilianer zum Fußball und des Fußballs zum Brasilianer ist ein weltweit bekannter Topos. Brasilien gilt nicht nur – und das zu Recht – als eine völlig fußballverrückte Nation, die brasilianische Seleção ist auch nicht allein die statistisch erfolgreichste Auswahlmannschaft, Rekordweltmeister, nein: Der Name der südamerikanischen Nation steht weltweit als Inbegriff für all das, was den Fußball attraktiv macht. Brasilianischer Fußball steht für Inspiration, Kreativität und Eigensinn, für Fantasie und Torhunger. Bis vor wenigen Jahrzehnten noch galt der brasilianische Spielstil als absolut einzigartig, in seiner tänzerischen Eleganz, der verschwenderischen Spielfreude und technischen Klasse seiner Spieler schien er grundverschieden vom europäischen Fußball und nicht zu kopieren. Es schien maximal möglich, die Seleção an einem günstigen Tag zu besiegen, gänzlich undenkbar jedoch, es mit dieser an spielerischer Brillanz aufnehmen zu können.
Im 21. Jahrhundert, in Zeiten der globalen Vermarktung des Fußballs und der Ökonomisierung des Sports durch alle Bereiche lässt sich der Trend zu einer Angleichung des Spiels beobachten. Der brasilianische Fußball ist in Sachen Taktik und Athletik europäischer geworden, der europäische Fußball ist im Hinblick auf die technischen Fähigkeiten seiner Individualisten brasilianischer geworden. Der Mythos des brasilianischen Fußballs ist davon unbenommen jedoch ungebrochen. Dass sich die brasilianische Öffentlichkeit und zahlreiche ehemalige Nationalspieler nach wie vor über jede etwas defensivere Spielausrichtung der Seleção echauffieren und nach Berücksichtigung der jeweils gerade vom Trainer verschmähten, besonders unberechenbaren Offensivkünstler schreien, mag diese These bestätigen.
Natürlich ist der kickende Brasilianer zudem ein großer Exportschlager. Kein anderes Land weist so viele im Ausland kickende Profifußballer auf. Im Jahr 2008 wechselten laut Angaben der CBF, des brasilianischen Fußballverbandes, allein 1.176 Spieler als Profis ins Ausland, insgesamt lebten zu diesem Zeitpunkt bereits über 5.000 Berufskicker in der Fremde. Brasiliens unerschöpfliches Reservoir an Talenten ist Legende, allerdings eine, die mit Vorsicht zu genießen ist. Der Nimbus, der Klang des Wortes ‚Brasilien‘ in den Ohren vieler Fußballverantwortlicher verleitet allzu gern zu Leichtsinnigkeiten auf der Einkaufstour. Nicht jeder Fußballer aus Brasilien hält, was seine Herkunft verspricht, wie kostspielige und spektakuläre Bundesliga-Flops der letzten Jahre belegen – erinnert sei an den Schalker Mittelfeldspieler Zé Roberto II, über den es hieß, er habe öffentlichkeitswirksam morgens um neun Uhr betrunken Bierflaschen vor dem Haus seines Mitspielers Rafinhas balanciert, oder an den vermeintlichen Bremer Starspieler Carlos Alberto, der es dank Trainingsprügeleien und Krankmeldungen in Serie auf ganze 197 Minuten Spielzeit für seinen Verein brachte. Auch werden gern Brasilianer eingebürgert, um der jeweiligen Auswahlelf das besondere Etwas zu verleihen. Hans Hubert „Berti“ Vogts wird sich noch gut, vermutlich im Gegensatz zu so manchem deutschen Fan, an die Nationalelfkarriere von Paulo Rink erinnern. Dank dessen deutschem Urgroßvater, einem Brasilienauswanderer, wurde Rink 1998 auf Geheiß des Bundestrainers eingebürgert, um die etwas limitierte Spielstärke des deutschen Angriffs, bestehend aus filigranen Leichtfüßen wie Carsten Jancker, Oliver Bierhoff oder Alexander Zickler, aufzuwerten. Der Traum vom Sambafußball im Deutschland des ausgehenden 20. Jahrhunderts, in dem der 39-jährige Lothar Matthäus als erschreckend klassischer Libero das Zepter in der Auswahlelf schwang, wirkte ähnlich bemüht wie die Sakkos des selbstbewussten Trainerassistenten Uli Stielike. Nach 13 Länderspielen ohne Tor hatte sich Rinks Assimilation sportlich wieder erledigt. Diese Erfahrungen und der überhitzte Markt in Südamerika haben zu einer Verschiebung des Fokus auf den asiatischen Markt geführt. Doch wo immer ein Vereinspräsident oder Manager sein Profil schärfen will, kommt gern ein brasilianischer Neuzugang ins Spiel.
Mythos und Wirklichkeit
Dass Brasilien trotz dieser Entwicklungen über eine enorme Auswahl an starken Individualisten verfügt, lässt sich indirekt auch an der Klasse der Spieler ablesen, denen keine nennenswerte Auswahlkarriere beschert war. Giovane Élber etwa, der zweiterfolgreichste ausländische Torschütze in der Geschichte der Bundesliga, kam auf ganze 15 Länderspiele. Auch die Tatsache, dass er in diesen Spielen sieben Tore erzielte, reichte für weitere Berücksichtigungen nicht aus. Zu denken wäre ferner an Marcelinho, der bei Hertha BSC und dem VfL Wolfsburg glänzte und es auf fünf Länderspiele brachte, oder an den hochaufgeschossenen Torjäger Mario Jardel, der es als fünfmaliger Torschützenkönig der portugiesischen Liga, zweimaliger Gewinner des „Goldenen Schuhs“ als bester Torjäger Europas und einmaliger Toptorjäger der Champions League auf mickrige zehn Länderspiele brachte.
Verlassen wir dieses trockene Terrain der Zahlenspiele, der exemplarisch gebrauchten Einzelfallgeschichten und der Unkenrufe einer Entwicklung des brasilianischen Fußballs abseits seiner Wurzeln. Um in die Seele des „brasilianischen Fußballs“ zu schauen, muss man wissen, was der Fußball für Brasilianer bedeutet.
Fußball als Wille und Vorstellung
Einen wichtigen Hinweis liefert die Sprache: Ohne bei den Eskimos und deren Wörtern für Schnee anfangen zu wollen, kann man mit Haroldo Maranhão und seinem Fußballexikon konstatieren, dass die Brasilianer allein 37 Synonyme für den Ball kennen, darunter zärtliche Bezeichnungen wie „Junge Frau“, „Mädchen“ und „Gefährtin“ oder sehnsuchtsvolle und ambivalente wie „Umworbene“ oder „Untreue“. Mit dem legendären Radioreporter Washington Rodrigues lässt sich festhalten, „dass man in Brasilien den Ball nennen [kann], wie man will, nur nicht Ball“. Die brasilianische Liebe kennt gewiss viele Passionen, profane Züge hat sie nicht.
Der ursprünglich durch Briten importierte und britisch betriebene Sport „Football“ wurde nach der Eroberung durch die Brasilianer auch sprachlich bald vereinnahmt: „Futebol“, so nennen die Brasilianer ihren Kick, und wenn es um die spezifisch brasilianische und damit auch einzig interessante Art geht, das Spiel auszuführen, dann handelt es sich um „futebol arte“ – den kunstvollen Fußball. Brasilianer zu sein verpflichtet schließlich. Dass es beim Fußball nicht darum geht, zumindest nicht als Zweck, der die Mittel heiligt, zu gewinnen, sondern schön zu spielen, findet Ausdruck in der Formel des „jogo bonito“. Das „schöne Spiel“ bezeichnet den angriffslustigen Stil, der auf eine tänzerische Demütigung des Gegners und die Entschlossenheit zum Spektakel hinausläuft. Die Rede vom „jogo bonito“ fungiert nicht deskriptiv – es ist der kategorische Imperativ des brasilianischen Spiels. Auf individueller Ebene kommt dabei eine Entität zum Tragen, die sich in Begriffen europäischanalytischen Denkens, zumal in Fußballfragen, in denen der Europäer aus brasilianischer Perspektive ohnehin als recht stumpfsinniger Klotz gilt, schwerlich fassen lässt: das Ginga. Ursprünglich bezeichnete das Wort den Grundschritt der Capoeira, das stetige Vor- und Zurückstellen der Beine im Rhythmus der Musik. Mittlerweile und insbesondere im Zusammenhang mit futebol bedeutet es jedoch weit mehr als dies. Sich an das Ginga annähernd, ohne ein wirkliches Verständnis behaupten zu wollen, kann man mindestens vier Dimensionen ausmachen, die es tragen. Das Ginga hat eine soziohistorische, eine tänzerisch-sportliche, eine personale und eine existentialistische Seite, die sich freilich überlagern und verschränken.
Fundiert ist das Ginga in den schwarzen Wurzeln des brasilianischen Fußballs, in den Elementen, die die ehemaligen Sklaven einbrachten. Die riesige Menge ehemaliger afrikanischer Zwangsarbeiter war zu Zeiten der Leibeigenschaft bei jeder körperlichen Betätigung zur Erbauung, Ertüchtigung und Traditionspflege auf eine sublime Körperlosigkeit angewiesen. Um der Züchtigung durch die Herren zu entgehen, musste beispielsweise das Training der Kampfkunst Capoeira als Tanz getarnt werden, der den körperlichen Vollkontakt simuliert, bloß antäuscht. Als die ersten privaten Kicks zwischen vorherigen Sklavenhaltern und den ihnen nach Abschaffung der Sklaverei nun als Tagelöhner dienenden Schwarzen stattfanden, musste ein Berühren der weißen Spieler unterbleiben, da dies sonst häufig heftige Misshandlungen zur Folge hatte.
Auf den Fußball übertragen verkörpert das Ginga ein tänzerisches Prinzip, wenn es darum geht, den direkten körperlichen Zweikampf zu vermeiden und den Gegner durch Finten und geschmeidige Richtungswechsel ins Leere laufen zu lassen. Wie ein Tänzer, der die Bewegungsmuster seines Partners antizipiert, um eine Kollision zu vermeiden.
Jeder Brasilianer, so Fußballstar Robinho in einem Interview für die Dokumentation Ginga, verfüge über das Ginga, das als innere Energie und Bewegungsprinzip des ganzen Menschen, des Körpers und der Seele, spürbar sei. Für die richtige Art des Fußballspielens sei es unerlässlich, dem Ginga nachzugeben, ihm Ausdruck zu verleihen, da sich einzig so die Persönlichkeit des Menschen ausdrücken lasse. Insofern bedeutet ein Ausleben des Ginga über die personale Ebene hinausweisend vor allem: Glück.
Wenn man an den Fußball der Favelas denkt, an die soziale Chance, die eine Fußballkarriere für arme Brasilianer bedeutet, bekommt Ginga eine handfeste materialistische Bedeutung. Um Scouts aufzufallen ist es unerlässlich, die individuellen Qualitäten maximal zu exponieren. Ginga bedeutet Selbstverwirklichung – und das Verschwindenlassen des Gegners im Dribbling.
Der in der Zweckrationalität des Fußballs als Ergebnissport sozialisierte Mensch mag an seine Grenzen stoßen: Wenn jeder Spieler sich selbst auszuleben und alle einengenden Umstände tendenziell zu ignorieren trachtet, entsteht in europäischen Augen in erster Linie wohl Chaos. Ein Brasilianer sieht hier jedoch die notwendigen Voraussetzungen für einen wirklich guten Kick.
Als existenzielles Element bedeutet Ginga den Tanz der Lebensverhältnisse, den Fluss alles Seienden. Falcão, der als bester Hallenfußballer der Welt gilt, resümiert: „Ginga bedeutet, das Leben nie zu ernst zu nehmen.“ Aus der Erkenntnis des Ginga und seiner Bedeutung für den Fußball leitet Stürmerstar Robinho den Schluss ab, dass Fußball „ernster Spaß“ sei. Spaß, solange das Ginga ausgelebt wird, ernst, weil das Ginga das Wesen aller Dinge abbildet und daher auch unbedingte Folge erwarten darf. Es ergibt sich in jedem Fall eine Spielidee, die nicht primär auf das Resultat und den mannschaftlichen Erfolg spekuliert und in der Taktik oder Athletik folglich als zweitrangig betrachtet wird. Dem Fachmann seien als Beispiele für in Brasilien besonders verehrte Ginga-Experten Ronaldinho, Robinho selbst und Denilson genannt – Spieler, die neben der Zuneigung der kickenden Jugend mitunter bei europäischen Experten durchaus Kritik wegen ineffektiver Spielweise oder gar Sperenzchen auf sich ziehen und zogen. Ebenfalls sind die Genannten, man möchte sagen: selbstverständlich, Stürmer. Abwehrspieler gelten in Brasilien nicht viel, wenn sie auch nicht ganz so bedauernswert wie Torhüter sein mögen. Das defensive Denken im Fußball gilt unter den Anhängern des „jogo bonito“ als destruktiv, als kalkulierte Gemeinheit gegen das Freiheitsgefühl des Ginga, eine Partybremse letztlich. Wer die teils wahnwitzigen, aber stets mitreißenden Sturmläufe von Leverkusens brasilianischem Innenverteidiger Lucio in den Jahren 2001 bis 2004 gesehen hat, wird ermessen können, welch einen frustrierenden Verzicht das reine Verteidigen für einen Brasilianer darstellen mag. Erst der große FC Bayern München, gnadenlos auf Erfolg gepolt, gewöhnte Lucio das Stürmen ab. Die zweckrationale Begründung: Unberechenbar auch für das eigene Team, zu gefährlich.
Und was die Logik der Ereignisse angeht, die aus einem voll ausgelebten Ginga folgen, so hat Robinho eine typisch brasilianische Vorstellung über theoretische Fußballperfektion. Nicht wenige Europäer würden dem Satz, dass ein Spiel zweier perfekter Mannschaften 0:0 enden müsste, zustimmen. Robinho sieht das völlig anders: „Wenn man mit Freude und Liebe spielt, wenn man schlau ist, hat die Abwehr nie eine Chance.“ Ginga scheint eine sehr uneuropäische Angelegenheit zu sein.
1.000 und 1 Fußballmärchen
Nicht nur sprachlich sind die Brasilianer in der Lage, ihrer Liebe zum Fußball auf vielfältige Weise zu huldigen. Ausdruck findet diese Ergebenheit zum Spiel auch in der hemmungslosen Begeisterung, mit der sich Brasilianer auf alle noch so kuriosen Variationen oder Abwandlungen des Spiels stürzen.
Ein frühes Exempel für das Faible zum Fußballhybriden, in dem sich die Leidenschaft für das Ballspiel mit dem typisch brasilianischen Synkretismus verbindet, lässt sich auf das Jahr 1913 zurückführen. Theodore Roosevelt, der abenteuerlustige US-Präsident, begab sich zu jener Zeit auf eine Reise durch das Amazonas-Gebiet. Bei seinen Erkundungen traf er auf den Stamm der Pareci. Dieser Indianerstamm frönte aus allein sportlichen Gründen einem Spiel – dessen rituelle Vorläufer bei den Mayas und Azteken noch mit Menschenopfern verbunden waren –, bei dem sich zwei Mannschaften gegenüberstanden, die sich einen Ball aus getrocknetem Kautschuk zuspielten, ohne dass dieser den Boden berühren durfte. Stundenlang und nur mit dem Kopf! Roosevelts Begeisterung für dieses Spiel, präzise „Kopfball“ benannt, sprach sich bis nach Rio de Janeiro herum. Eine großstädtische Zeitung regte an, die Indianer nach Rio einzuladen. Ein solches Kopfballspektakel versprach „interessant und originell“ zu sein, zudem hätte es gegenüber dem noch stark britisch dominierten Football seiner Zeit ein ureigen brasilianisches Element inne.
Nach neun Jahren erfüllten schließlich 16 Indianer den Großstädtern den, sicherlich aus ihrer Warte unverständlichen, Wunsch und reisten über 2.000 Kilometer zu einem Showmatch an. Der mediale Wirbel in Rio war riesig, alle Zeitungen kündeten das Spektakel an. Fluminense stellte sein Stadion, das damals größte in Brasilien, zur Verfügung. Die Indianer zelteten nach ihrer Ankunft am Tag vor dem Spiel auf dem Spielfeld und erwachten am nächsten Morgen mit einem Schock: Einer der Spieler war in Folge der Reisestrapazen über Nacht verstorben.
Dennoch musste das Zicunati-Spiel, so der indianische Name, stattfinden. Vor dem Spiel hatten die indianischen Gastspieler mit glatt gekämmten Haaren und in Pfadfinderkluft Aufstellung zu nehmen. Es wurde vor großer Stadionkulisse feierlich die brasilianische Nationalhymne im indianischen Pareci-Dialekt gesungen. Anschließend wurden die verdutzten Indianer in Fußballjerseys gesteckt und zur Mittellinie dirigiert.
Bald nach dem Beginn des Spiels drohte kurzzeitig ein Abbruch. Die Zuschauer hatten rasch die Regeln verstanden und begannen die Spieler anzufeuern, was diese in Angst versetzte. Nach gutem Zureden wurde das Spiel doch noch zu Ende geführt; das 21:20 der weißen Mannschaft gegen die Blauen wurde von den Fans bejubelt und am nächsten Tag in den Sportteilen der Zeitungen äußerst lobend besprochen.
Einzig die Protagonisten hatten nicht verstanden, was dieser ganze Zirkus bezwecken sollte. Häuptling Coloisoressê gab O Imparcial ein Interview, das an dieser Tatsache keinen Zweifel ließ: „All das Zeug wie Fußballschuhe, Trikots und Hosen – das ist nur lästig! Auch der Rasen behindert.“ Die Indianer zogen anschließend in ihr Dorf zurück, wo das Spiel noch heute Anwendung findet. Die Großstädter hatten ihren Spaß gehabt, wenn sich auch in Rio Zicunati nie etablierte. Sehr im Unterschied zu Autoball!
Blech und Büffelleder
Die wechselhafte Geschichte dieses merkwürdigen Motorsports beginnt in den 1930er-Jahren im badischen Karlsruhe und führte über das Rio de Janeiro der 1970er-Jahre zurück nach Deutschland, wo es der Fernsehentertainer Stefan Raab wiederbelebte. Die Begeisterung für den Ball verbindet eben die Völker – und Autofahrer.
Der in den 1920er-Jahren bekannte Automobilrennfahrer Karl Kappler setzte am 16. Juni 1933 seine eigentümliche Idee eines Spiels um, bei welchem zwei Autos gegeneinander um einen riesigen Ball von 120 cm Durchmesser (praktischerweise von der Reifenfirma Continental entwickelt) kämpften und diesen im Tor des Gegners unterzubringen versuchten. Auf dem Fußballplatz des Frankonia Karlsruhe schlug er im Mercedes-Benz seinen Kontrahenten Willy Engesser (Opel) vor mehreren Hundert Zuschauern. Mit dem Rückzug Kapplers aus dem Autoball 1935 schien das Spiel nach gerade zwei Jahren und einer Handvoll Partien bereits Geschichte zu sein.
Doch schien ein solches Spiel für die Brasilianer und ihre Liebe zu Spektakel und Mischformen aller Art allzu prädestiniert zu sein, um nicht dort eine Renaissance zu erfahren. Und tatsächlich: Nach gut dreißig Jahren in völliger Vergessenheit begannen Anfang der 1970er-Jahre in Rio de Janeiro plötzlich junge wohlhabende Großstädter sich in Gebrauchtwagen um einen gewaltigen Lederball zu balgen.
Die Frage, ob zuerst das Huhn oder das Ei dagewesen sei, lässt sich im Fall der brasilianischen Autoball-Ära eindeutig beantworten: Am Anfang war der Ball.
Nach einem wichtigen Sieg der brasilianischen Fußballnationalmannschaft hatte eine Firma aus São Paulo zur Ehrung der Spieler und als Werbegag einen riesigen Ball aus Büffelleder herstellen lassen. Einmal in der Welt musste mit diesem Ungetüm von Spielgerät doch irgendetwas anzufangen sein.
Nach einigen Jahren der Ratlosigkeit fand sich eine Gruppe von Leuten, die auf Pferdestärken setzten, wenn auch nur auf jeweils eine. In der Stadt Taubaté sollte eine Alternative zum Polo angeboten werden, die die fußballverrückten Brasilianer begeistern sollte: Pferdefußball hieß die Idee. Doch die Premiere misslang. O Globo schrieb: „Das Spiel hätte ein Publikumserfolg werden können, das Stadion war voll. Nur die Pferde waren vor dem runden Ungetüm zu Tode erschrocken. Eines wagte einen Tritt und brach sich sogleich ein Bein.“ Dass sich die beteiligten Akteure vor dem Spielgerät fürchteten und sich an diesem die Knochen brachen, machte den erwarteten neuen Trendsport bei aller Euphorie unmöglich.
Der Zuführung des riesenhaften Spielgeräts, zu dem es noch kein Spiel gab, zu seiner nachhaltigen Verwendung half der Zufall auf die Sprünge. Der Ball geriet in die Hände des Mannschaftsarztes des Fußballteams América. Jener Mário Tourinho, früheres Mitglied des Motorsportverbandes, fuhr in seinem Auto an der Copacabana entlang, als er plötzlich einen Fußball vom Strand kommend auf sein Auto zufliegen sah. Statt auszuweichen hielt Tourinho voll drauf und sah, justament getroffen von einem Geistesblitz, dem in hohem Bogen weit zurück „geschossenen“ Ball hinterher. Mehr Pferdestärken! Das war es.
Böse Zungen mochten behaupten, dass sich der Erfinder des Autoballs als Chirurg bloß neue Patienten zuführen wolle. Doch nicht nur Tierschützer dürften sich über das Substitut zum Pferdefußball gefreut haben. Tourinho selbst sah sich mit seiner Idee Autoball in bester hippokratischer Tradition: „In unserer heutigen Zeit, da der Alltagsstress bei so vielen Menschen immer mehr Neurosen hervorruft, ist Autoball keine schlechte Therapie.“
In der Halbzeit des Fußballspiels zwischen Flamengo und Madueira fand am 19. September 1970 das erste Autoballspiel auf einem Nebenplatz statt. Doch noch zog der neue Sport die Massen nicht an. Die klapprigen Gebrauchtwagen und das niedrige Spielniveau vergraulten anfangs viele Zuschauer. Mário Tourinho erinnerte sich der zwei unschlagbaren Komponenten, die zusammengenommen stets die Massen seiner Landsleute zu überzeugen wussten. Es musste ein publicityträchtiges Spektakel her und die Nähe zum Fußball, nicht nur über das ähnliche Reglement, ausgebaut werden. Also organisierte Tourinho 1971 eine Sperrung der Avenida Atlântica, der auf mehreren Kilometern entlang der Copacabana läuft, für ein Autoballspiel, das niemand ignorieren konnte. Die Fahrer hatten sich von Leihfirmen nagelneue Sportwagen geliehen und konnten so die Massen beeindrucken.
1973 war Autoball bereits als Massensport etabliert, die Fahrer fuhren unter den Flaggen der großen Fußballvereine Rios. Die erste Stadtmeisterschaft Rios sah Teams von Fluminense, Vasco, Flamengo und América vor. Die Autos waren in den Vereinsfarben lackiert, Nummern und Vereinsembleme schmückten die Türen. Sportreporter motivierte dies, die Spiele wie Fußballspiele zu kommentieren und weitere Rituale aus dem Fußball wurden übernommen: Einem Mannschaftssport entsprechend kamen unterschiedliche Fahrzeugtypen zum Einsatz, um ihre spezifischen Qualitäten einzubringen. Ein VW-Käfer war dank der gekrümmten Motorhaube in der Lage, hohe Bälle vor das gegnerische Tor zu „flanken“, wo Fahrzeuge mit höherem Dach, wenn man so will die „Dachballungeheuer“, diese ins Tor zu lenken versuchten. Fahrzeuge mit rechteckiger Motorhaube waren Spezialisten für präzise Pässe oder Standardsituationen.
Auch für das medizinische Wohl der Sportler wollte gesorgt sein. Es kamen zwar selten ernsthaft die Fahrer zu Schaden, dafür blieben umso häufiger „verletzte“ Autos auf dem Feld liegen. In diesem Fall eilten Mechaniker, die man in schönster Fußballmetaphorik „Masseure“ nannte, mit Werkzeug auf den Platz und behandelten die Patienten. Der berühmteste „Masseur“, ein Mechaniker namens Castro, bekam den Künstlernamen „Doktor“ verliehen, weil es diesem in zwanzig Minuten gelang, ein eben noch brennendes Auto wieder fahrtüchtig zu machen.
Ein lauter, dreckiger und chaotischer Spaß für alle großen Jungs der Strandmetropole war geboren. Im Autoball ließen sich wie in einem großen Kinderspiel die Triumphe der brasilianischen Fußballmannschaften und des Rennsports, den der Brasilianer Emerson Fittipaldi dominierte, nachspielen und -empfinden. Der frühere Autoball-Fahrer Ivan Sant‘Anna, im Brotberuf Finanzmakler, erinnerte sich im Gespräch mit Autor Alex Bellos: „Es war wirklich ein teurer Sport. Ich gab viel Geld aus. Pro Spiel etwa 3.000 Dollar. Für jedes Spiel musste man einen Wagen kaufen. Meistens alte Taxis, die wir für unsere Zwecke frisierten. Einige Leute leisteten sich sogar zwei oder drei Autos pro Spiel.“ Aus diesem Grund taugte Autoball verständlicherweise nicht zum aktiv ausgeübten Breitensport. Selbst die Heroen des motorisierten Ballsports konnten sich aus finanziellen Gründen kein Training erlauben. Bis zu 15.000 Zuschauer strömten dennoch zu den Spielen der tollkühnen Männer in ihren rasenden Kisten. Adrenalin, Benzin und eine gehörige Portion Testosteron machten den Sport derart attraktiv, dass sich selbst das US-Magazin Time des Autoball-Helden Walter Lacet exemplarisch annahm: „Walter Lacet verzichtet verächtlich auf den Sturzhelm; der Reißverschluss seines schwarzen Fliegeranzugs steht offen, sodass seine Brusthaare zu sehen sind, und so donnert er mit überdrehtem Machismo, der für den neuen Sport unverzichtbar zu sein scheint, über den Platz. Wenn der Ball zwischen zwei Autos festhängt, setzt Lacet bis zum äußersten Spielrand zurück und schießt von dort mit heulendem Motor auf das gegnerische Auto los. Wenn dessen Fahrer stur bleibt, ist es an den Mechanikern, mit Vorschlaghämmern die Wracks zu entwirren.“
Das Akquirieren von Plätzen stellte neben den Kosten für die Fahrzeuge ein weiteres Problem dar. Ebenso wie von den Fahrzeugen blieb von den Spielstätten häufig nicht viel übrig. Die Attraktivität des Sports für die Massen war jedoch unweigerlich mit dessen verschwenderisch-destruktivem Potenzial verbunden. Ein Dilemma. Ivan Sant’ Anna resümierte nach dem Ende der großen Zeit des Autoballs drastisch: „Die vier, fünf Jahre, in denen Autoball gespielt wurde, waren eine interessante Zeit. Wir hatten gute Publicity. Aber es hätte zu einem tödlichen Unfall kommen müssen. Mir war das immer klar, egal was passiert, Autoball würde beim Publikum nur ankommen, wenn es Tote gab.“
Neben den aus Sicht des Marketings bedauerlicherweise fehlenden Todesopfern war ein zweiter Grund hauptsächlich für das Aus des Sports verantwortlich: Die Ölkrise. 1974 verbot die brasilianische Regierung alle Arten von Motorsport. Autoball geriet in Vergessenheit. Bis es in Zeiten zunehmender Knappheit fossiler Brennstoffe von Stefan Raab für Deutschland wiederentdeckt wurde, wenn auch lediglich als Fernsehereignis, mit Sturzhelmen und zeitgemäß spritsparenden Fahrzeugen (beispielsweise: VW Fox mit Durchschnittsverbrauch zwischen 6 und 9 Litern auf 100 Kilometern). Wäre wohl nicht Walter Lacets Ding gewesen.
Knopfballduelle
Weiter zurück reichen die Anfänge einer anderen Promenadenmischung des Fußballs. Knopffußball heißt die an das deutsche Tipp-Kick erinnernde brasilianische Variante der Fußballimitation im Miniaturformat. Bereits zu Beginn des 20. Jahrhunderts, als auch der brasilianische Fußball noch in den Kinderschuhen steckte, waren es eben Kinder, die begannen, Fußballspiele mit Knöpfen spielerisch nachzuvollziehen. Mit jeweils elf Knöpfen wurde auf Tischen nach einem Miniaturball geschnippst, um diesen im gegnerischen Tor unterzubringen. Dieses Kinderspiel hat bis heute einen ungebrochenen Siegeszug in Brasilien angetreten.
Alex Bellos berichtet über das „Knopfbüro“ von Marcelo Coutinho. Dieses Fachgeschäft des Knopffußballs in Rio zieht Jungs und Männer aller Altersklassen in seinen Bann. Coutinho handelt mit Equipment aller Art für das simple Spiel, das sich in puncto Einfallsreichtum und Design stark weiterentwickelt hat. Die Nachfolger der Mantelknöpfe sind Plastikmarken in der Größe von Dominosteinen, die an Pokerchips erinnern. Die Chips sind in den Farben aller populären Fußballmannschaften zu haben, tragen Rückennummern oder Namen berühmter Spieler und bieten so der Fantasie allen Raum, den es braucht, um sich in die große Welt des Fußballs zu träumen. Die „Buttonistas“, wie die Anhänger des Spiels heißen, bewahren ihre Teams in Holzschachteln auf, die „Umkleidekabinen“ genannt werden. Auf Reisen zu Auswärtsspielen darf die medizinische Versorgung der Spieler nicht zu kurz kommen: Möbelpolitur, Reiniger, Wachs und Tücher werden zur Behandlung der Knöpfe mitgeführt.
Ähnlich wie moderne Computer- oder Konsolenfußballspiele bietet Knopffußball den Spielern die Möglichkeit, Knopf-Alter-Egos an die Seite der großen Stars zu setzen. So spielte beispielsweise in Marcelo Coutinhos Wettkampfteam, nachempfunden dem FC Porto, auch dessen Frau Monica im rechten Mittelfeld. Auch Gandhi und Nelson Mandela sollen im Sturmzentrum zu Einsätzen gekommen sein. Der Verdacht liegt nahe, dass der Knopffußball mit der Zeit den modernen elektronischen Fußballspielen zum Opfer fallen könnte. Doch der Knopffußball scheint auf beste analoge Art zu trotzen und schlägt gar den Weg sportlicher Institutionalisierung ein. Nach Jahren regionaler Streitigkeiten über das Spielgerät und die Anzahl der Schnippser pro Mannschaft (Rio: größerer Tisch, drei Schnippser; São Paulo: kleinerer Tisch, zwölf Schnippser) veröffentlichte das Sportmagazin Placar „Die Zehn Gebote des Buttonistas“. Das erste Gebot lautet salomonisch: „Es gibt keine falschen Regeln, nur verschiedene Meinungen und Geschmäcker.“ Die Zeit des konstruktiven Miteinanders im Tischfußball, der wie der große Fußball seine Zeiten der regionalen Eifersüchteleien zu überstehen hatte, hatte begonnen. Der nationale Sportrat gab am 29. September 1988 bekannt, dass der Tischfußball wegen der weit verbreiteten Praxis und der Meisterschaften auf nationaler Ebene als Sport anerkannt werde. Da ein „Buttonista“ während eines Spiels angeblich dreieinhalb Kilometer laufe, war auch der Nachweis physischer Herausforderung erbracht. Mittlerweile haben große Fußballclubs wie Internacional Porto Alegre und Corinthians eigene Tischfußball-Abteilungen und der Knopffußball ist beliebter denn je.
Brasilianische Ruhmeshallen
Ein Außenseiterdasein fristet das von Alex Bellos beschriebene „Ökoball“, welches im Regenwald in der Stadt Macapá gespielt wird: Das pädagogisch sinnvolle Spiel sieht einen Fußballplatz mit Bäumen vor, denen unbedingter Respekt entgegenzubringen ist. Trifft ein Spieler einen der Bäume, wird er des Feldes verwiesen – und, noch nicht genug bestraft, muss der Herausgestellte zudem eine Limone lutschen.
Es gibt wohl unzählige Abwandlungen des Spiels, die den jeweiligen Gegebenheiten fröhlich Rechnung tragen. Die brasilianische Kultur, deren beredter Ausdruck der Karneval ist, lebt von der Improvisation, Mischung und Travestie verschiedenster Einflüsse und Praktiken. Wo immer ein runder Gegenstand zu finden oder herzustellen ist – viele Indianerstämme produzieren eigene Fußbälle aus dem Harz der Kautschukbäume –, denken sich Brasilianer die merkwürdigsten Fußball-Spiele aus.
Wesentlich bekannter als die unzähligen lokalen Fußballhybriden sind die dem Ursprungsspiel enger verwandten Varianten wie Futsal oder Beach Soccer, die von Brasilien ausgegangen sind und mittlerweile als global bekannte Spielarten gelten können.
Futsal, ein Akronym für Futebol de Salão (Hallenfußball), ist ein Indoorsport mit zwei Teams à fünf Spielern. Mit einem schweren und sprungreduzierten Ball wird auf zwei kleine Tore gespielt, wobei es im Unterschied zum klassischen Fußball in der Halle keine Banden gibt. Die erste Idee zu diesem Sport geht auf den Uruguayer Juan Carlos Cerani zurück, der im Montevideo der 1930er-Jahre ein Fußballspiel auf einem Basketballplatz veranstaltete. Erstmals wurde als Spieluntergrund ein Kunststoffboden verwendet. In São Paulo wurde dieser Einfall in den 1950er-Jahren aufgegriffen und im Rahmen des CVJM-Sportprogramms zu einer eigenen Sportart weiterentwickelt.
Um auf dem Hallenboden ein wildes Herumhüpfen des Fußballs zu unterdrücken, wurden die Bälle anfangs mit Sägemehl, Kork oder Pferdehaaren beschwert, weswegen der Sport den Spitznamen „Spiel mit dem schweren Ball“ erhielt. Bereits 1954 wurde der erste Futsal-Verband in Rio gegründet, bis Ende der 1950er-Jahre zogen diverse brasilianische Landesverbände nach. Die Reglements unterschieden sich anfänglich deutlich und brachten interessante Nuancen hervor. Diese reichten von einem Sprechverbot für die Spieler, über ein Lärmverbot für die Zuschauer, bis hin zu einem Verbot der Ballberührung, wenn gleichzeitig eine Hand des Spielers den Boden berührte. Nachdem sich zahlreiche Spieler, beim Versuch einen Sturz durch Abrollen zu kompensieren, die Schultern gebrochen hatten, nahm man die Regel zurück.
1971 wurde der Internationale Verband für Hallenfußball (FIFUSA) in Brasilien gegründet und 1989 in den Weltfußballverband FIFA integriert. In Brasilien ist der Sport kaum weniger beliebt als der klassische Fußball, die einheitliche Profiliga floriert und mit Futsal lässt sich längst eine Menge Geld verdienen. Die brasilianischen Profis dominieren den Sport weltweit, fünf der sieben Futsal-Weltmeisterschaften wurden gewonnen.
Die Übergänge zwischen dem Futsal und Fußball sind in Brasilien gerade im Jugendbereich fließend, sodass viele berühmte Fußballstars der Seleção ihre Grundausbildung im Futsal erhalten haben. Falcão, der wohl beste Futsalspieler aller Zeiten, beschreibt die Vorzüge des Sports, bei dem äußerste Körper- und Ballbeherrschung vonnöten sind, aus Sicht brasilianischer Ballverliebtheit: „Beim Futsal hat man immer den Ball am Fuß. Auf dem großen Fußballfeld muss man manchmal fünf Minuten auf ihn warten.“ Für einen waschechten Brasilianer ein untragbarer Zustand.
Klar ist, dass der Futsal mit seiner Begünstigung individueller Ballbeherrschung und tänzerischen Geschicks alle Elemente bedient und fördert, die Brasilianer auch beim Fußball wertschätzen. Am Zuckerhut fragt niemand nach Taktik, Athletik und Disziplin! Und falls doch, so hört dem Langweiler niemand zu.
Samba, Sonne, Strandfußball
Über noch mehr brasilianisches Flair verfügt der Strandfußball. Die Strände der Copacabana sind ohne braungebrannte Strandkicker kaum vorstellbar. Samba, Sonne, Strand – diese Erlebnistrias scheint den brasilianischen Spielern, auch fern der Heimat, eingeschrieben zu sein.
Wie so häufig wurde auch im Falle des Strandfußballs aus der Not, die erfinderisch macht, schließlich ein eigenes Markenzeichen. Zu Beginn der 1920er-Jahre hatte das Fußballfieber bereits weite Teile der Bevölkerung gepackt, doch eine Aufnahme in die Vereine stand größtenteils nur wohlhabenden und weißen Spielern offen. Das Anwachsen der Metropole Rio de Janeiro brachte ein zunehmendes Verschwinden innerstädtischer Freiflächen mit sich. Wo also sollten die ärmeren Fußballfreunde ihrem Vergnügen nachgehen? Die Zeit des Strandfußballs war gekommen. Dieser breitete sich so rasch aus, dass der Bürgermeister Rios ein Verbot in die Wege leiten wollte – das Einreichen einer Petition mit 50.000 Unterschriften ließ ihn rasch von diesem Vorhaben Abstand nehmen. Zwar waren die Vereinsstrukturen elitär und von kolonialem Rassismus geprägt, doch bereits zu jener Zeit ließ sich das Volk nicht um seinen Fußball betrügen. Mit der zunehmenden Etablierung des Fußballs schwang sich auch der Strandfußball zu neuen Höhen auf.
In den 1950er- und 1960er-Jahren wimmelten Rios Strände von Fußballern, die elf gegen elf auf Sand um Ball, Sieg und Selbstverwirklichung rangen. Teams steckten ihre Strandabschnitte an der Ipanema und der Copacabana wie Claims ab und beanspruchten zu regelmäßigen Spielen ihr Territorium. Den Scouts der Vereine, die sich zu dieser Zeit Spielern aus allen Schichten geöffnet hatten, blieb das Treiben nicht verborgen. Der Strand wurde zum leicht anarchischen Laufsteg für zukünftige Profikarrieren. Mit der Zunahme des Strandfußballs, des Tourismus und der Bevölkerungszahl in der Metropole aufgrund der Arbeitsmigration nach dem Zweiten Weltkrieg wurde es eng an den Stränden. Zwischen 1940 und 1960 hatte sich die Bevölkerungszahl Rios annähernd verdoppelt. Die räumliche Enge, der Kampf um die Plätze und das zunehmende Spektakel führten zu teils wilden Auseinandersetzungen an den Stränden. Die Folge waren Reglementierungen und Einschränkungen des spielerischen Wildwuchses. Anfang der 1960er-Jahre war Strandfußball erst ab 14 Uhr erlaubt, Plätze wurden ausgewiesen und die Ordnung überwacht.
Doch Brasilien wäre nicht es selbst, wenn nicht auch diesem neuen Notstand durch Erfindungsreichtum begegnet worden wäre. So kamen zu dieser Zeit einige verscheuchte Strandfußballer auf die Idee, einfach auf die am Strand längst zur Institution gewordenen Beachvolleyballplätze auszuweichen und den Ball mit dem Fuß übers Netz zu jonglieren. In Deutschland kennt man das Spiel meist als „Fußballtennis“, treffender ist jedoch die ursprüngliche Bezeichnung „Footvolley“. Eine neue Spielart des Fußballs war geboren, die insbesondere auch von den kickenden Mädchen und Frauen begeistert angenommen wurde, da beim Footvolley weniger Athletik und Zweikampfhärte gefragt, sondern vor allem technisches und akrobatisches Geschick ausschlaggebend war.
Die Wohlhabenderen unter den Strandkickern verließen hingegen das öffentliche Territorium Strand wieder und besannen sich auf die Exklusivität der Fußballanfangsjahre. Ihr Rückzug vom Strandfußball führte die Mittel- und Oberschicht zurück in die Stadtzentren. Zu jener Zeit wirtschaftlicher Prosperität und die durch den WM-Sieg 1958 angeheizte Fußballbegeisterung galt es in den höheren Schichten als enorm statusfördernd, sich in den Städten private kleine Rasenplätze anzulegen, um Sport und gesellschaftliche Begegnung zu verbinden. Wer über genügend Mittel verfügte, sich die aufwendig zu pflegende Rasenfläche im tropischen Klima leisten zu können, der empfing Geschäftspartner und bedeutende Persönlichkeiten zu Grillfesten, auf denen dem Bier und privaten Kick gefrönt wurde. Diese vorwiegend reinen Männergesellschaften stellten sozialen Zusammenhang sicher und waren Nährboden für allerlei Geschäftliches.
Der Strandfußball selbst war natürlich nie totzukriegen. Wo immer ein Ball ist, wird gespielt. Doch nach der wilden und freien Anfangszeit erlebte der Strandfußball seine Phase der Domestizierung und schließlich der Anpassung an die neuen Gesetze der Kommerzialisierung. Anfang der 1990er-Jahre wurde für das Fernsehen der „Beach Soccer“ erfunden, bei welchem jeweils fünf Spieler in drei Perioden à zwölf Minuten gegeneinander antreten. Seit 1998 ist Beach Soccer an der Spitze offiziell Profisport. Frühere brasilianische Nationalspieler wie Romário oder Zico verdienten sich nach ihrer Fußballkarriere ein paar Reals dazu und dienten als populäre Zugpferde der Vermarktung.
Traum und Wirklichkeit
Die brasilianische Variante des Tellerwäscher-Mythos ist der Fußballer, der vom Strand oder Bolzplatz weg verpflichtet wird und zu Ruhm und Reichtum gelangt. Von der Wirklichkeit ist er weit entfernt, zumindest, wenn man die Wirklichkeit an den Strukturen misst, die die riesige Masse armer Fußballer ausbeuten, und nicht an den sehr seltenen Ausnahmen.
Das gewaltige Reservoir an Fußballtalenten wurde und wird von den brasilianischen Vereinen weidlich genutzt und ausgenutzt, wobei aus der Not der meisten begabten Spieler Kapital geschlagen wird. Der heutige Traum vom Profifußball führt nicht mehr über den spielerischen Freizeitkick, sondern über die Peneiras, die Spielersichtungen der Vereine. An diesen zentral organisierten Fußball-Assessment-Centern nehmen jedes Jahr Tausende Jugendliche teil. Katrin Sturm und Carsten Bruder nennen in Zwischen Strand und Stadion die Zahl von 20.000 Teilnehmern pro Jahr allein bei den Sichtungen des FC São Paulo. Von diesen 20.000 Spielern werden etwa 90 Spieler im Durchschnitt in die Jugendmannschaften des Vereins aufgenommen. Aus dem Kreise dieser Auserwählten schaffen ca. zwei Prozent den Sprung in den Profikader. Die Spieler opfern diesem Traum die wichtigsten Jahre ihrer Jugend und bekommen in den Akademien der Vereine, in denen sie jahrelang untergebracht werden, zumeist keine Schulbildung. Schaffen Sie es nicht, stehen sie vor dem Nichts, und diejenigen, die es schaffen, geraten sehr häufig in die Hände von Beratern, die den Vereinen zuarbeiten und die mangelnde Bildung ihrer Mandanten weidlich zum eigenen Vorteil ausnutzen. Von dem brasilianischen Elend und dem Traum vom Profifußball nähren sich Vereine und eine ganze Wirtschaft drum herum prächtig.
Um diesem Missstand bei der Ausbeutung der Talente Einhalt zu gebieten, haben in den vergangenen Jahren vermehrt ehemalige Spieler die sogenannten Escolinhas gegründet. Das Problem an den privat betriebenen Talentschulen ist jedoch, dass diese, abgesehen von einigen Förderstipendien für besonders talentierte arme Jugendliche, kostenpflichtig sind, wodurch sie in der Regel ausschließlich von Mittel- oder Oberschichtkindern besucht werden können.
Auch muss erwähnt werden, dass viele Spieler in den letzten Jahren, unter ihnen Weltstars wie Kaká, eng mit den zahlreichen evangelikalen Sekten Brasiliens in Kontakt gekommen sind und niemand beurteilen kann, welchen Formen der Indoktrination junge Fußballschüler in den Escolinhas ausgesetzt sind.
In seiner dreijährigen Zeit als außerordentlicher Sportminister legte Pelé ein Programm für öffentliche Fußballschulen auf, die Kindern aus allen Schichten offen stehen. Nicht nur Karriereförderung und karitative Motive waren ausschlaggebend: Die wachsende Jugendkriminalität in den Ballungsräumen machte politisches Engagement nötig. Der Erfolg nicht nur im Hinblick auf die Entwicklung der Jugendkriminalität gibt diesen Projekten recht. Professor Mauricio Murad von der Universität des Bundesstaates Rio de Janeiro stellt im Hinblick auf die soziale Bedeutung des Fußballs für sein Land fest: „Mithilfe des Fußballs als einem sehr wichtigen kollektiven Ritual erhalten wir Zugang zu den grundlegenden Dimensionen des gesellschaftlichen Lebens und der brasilianischen Geschichte. Fußball ist in Brasilien mehr als ein Massensport und unser Sport Nummer eins. Fußball ist eine Metapher des gesellschaftlichen Lebens in Brasilien, eine Zusammenfassung seiner wichtigsten Charakteristika“; und zieht für die öffentlichen Fußballprogramme das positive Fazit: „Sogar die UNO unterstützt und finanziert zusammen mit der FIFA seit einigen Jahren Zehntausende von Fußballsportzentren, deren Konzept in der Zusammenführung und gegenseitigen Beeinflussung der Kulturen besteht. Über ihre Funktion als Freizeitzentren hinaus dienen sie Kindern und Heranwachsenden auch als Treffpunkt, als Ort des Gedankenaustauschs und der Solidarität, erst recht, wenn sie in einem schwierigen sozialen Umfeld leben. Vom Elitären und Exklusiven zum Populären und Demokratischen, das ist die wesentliche historische Kurve des Fußballs in Brasilien.“
Wenn sich das Geschäft mit dem Fußball einem weltweiten Umsatzvolumen von jährlich 300 Milliarden Dollar annähert, sollte dessen sozial-pädagogische Bedeutung nicht nur Thema für Sonntagsreden sein, sondern mit entsprechenden Mitteln gefördert werden. In all seiner Widersprüchlichkeit, Schönheit, Grausamkeit und Komplexität bleibt der Fußball in erster Linie ein kultureller Ausdruck vieler Gesellschaften in der ganzen Welt.
Brot oder Spiele?
Dass der Ausdruck der die Gesellschaft prägenden Gegensätze und Paradoxien in Brasilien besonders deutlich ausfällt, zeigt auch die Ausstattung mit ansprechenden Fußballstadien, die sich unzählige ansonsten sehr arme Gemeinden leisten – und dies nicht selten nicht einmal gegen den Willen der Einwohner. Vorreiter des fast massenweisen Baus von Fußballstadien war während der 1970er-Jahre die Militärregierung, die mit prachtvollen Fußballarenen Symbole des Nationalstolzes errichten wollte. 1978 verfügte Brasilien laut dem Guiness-Buch der Rekorde über 27 Stadien mit einem Fassungsvermögen von mindestens 45.000 Zuschauern und fünf Stadien, die mehr als 100.000 Zuschauer aufnehmen konnten. Die Mentalität des „Hast du was, bist du was“ wurde und wird bis heute auch von kleinen und wirtschaftlich marginalen Gemeinden gelebt.
Alex Bellos berichtet über die kleine Stadt Brejinho im staubtrockenen und glutheißen Nordosten des Landes. 1993 war die Gegend von einer anhaltenden Dürreperiode betroffen, deren Folgen für die ärmere Bevölkerung Ausmaße einer humanitären Katastrophe hätte annehmen können. Öffentlich organisierte Notfallhilfe mit Lebensmittellieferungen konnte das Schlimmste verhindern. Die allgemeine Not in der Region führte bei den lokalen Politikern zu der Einsicht, dass es vor allem an einem mangele: einer schmucken Fußballarena!
Im Jahr der Dürrekatastrophe ließ Bürgermeister João Pedro die Arbeiten am Bau eines Stadions für 10.000 Zuschauer beginnen. Der Ort Brejinho kam zu jener Zeit, die ländliche Umgebung bereits mitgerechnet, übrigens auf 4.000 Einwohner.
Der Bürgermeister, ganz brasilianischer Fußballvisionär, begründete seine kurios bis wahnsinnig anmutende Maßnahme gleichermaßen mit Nachhaltigkeit wie auch mit dem Willen seiner Einwohner: „Ich habe nicht bloß an die Gegenwart gedacht. Ich machte etwas, das für lange Zeit bleiben wird. Die Menschen hier wollten mehr als alles andere ein Stadion. Ich versprach ihnen, dass ich es für sie bauen werde. Und ich hielt mein Versprechen.“ Das Stadion benannte João Pedro nach seinem verstorbenen Schwiegersohn, Dr. Antônio Alves de Lima.
Das Bemerkenswerte: Diese Geschichte ist nicht bloß ein Beispiel politischen Größenwahns oder reiner Anmaßung, denn die Menschen Brejinhos sind ihrem Bürgermeister dankbar. Sie tauften das Stadion eigenmächtig und liebevoll Tonhão (= der große Antonio) und verzichten zugunsten fußballerischen Glamours gern auf Investitionen in die Infrastruktur, die die strukturelle Armut mildern könnten. Das völlig deplatziert scheinende moderne Stadion inmitten der sandigen Wüstenei verfügt über eine komfortable Bar und sogar eine Rundfunklounge für eventuelle Radioübertragungen. Im Gespräch mit Alex Bellos blickt der Sportsekretär Brejinhos zurück auf die Zeit der Schmach: „Früher schämten wir uns, dass wir kein richtiges Stadion hatten. Wir baten und bettelten.“ Wie jener João Vilarim den Ausgang der Geschichte einordnet, kann man sich denken: „Endlich kam der Bürgermeister zur Vernunft!“
Das Vermächtnis des Stadions verhalf dem zweiten Schwiegersohn des Bürgermeisters zur Nachfolge auf diesem Posten. José Vanderlei begegnet aufklärerisch denkenden Menschen auf deren Einwände, ein Stadionbau in einer verarmten Region sei doch sehr anrüchig, wenn nicht korruptionsverdächtig, auf ganz eigene und an einer womöglich zynischen Realität geschulten Art: „Okay, wir haben 75.000 Dollar ausgegeben. Ein anderer Bürgermeister hätte vielleicht nichts getan, und die 75.000 Dollar wären auch so einfach weg gewesen.“
José Vanderlei gewann seine Wahl übrigens mit dem Versprechen, dass Fassungsvermögen der Tribüne von 3.000 Plätzen (etwa ein Sitzplatz pro Einwohner) auf 10.000 Plätze zu erhöhen. Die drei vorhandenen Kassenhäuschen wurden bisher einmal benutzt, wegen der Armut der Bevölkerung erhebt der Amateurverein normalerweise keine Eintrittspreise.
Welch interessante Bauprojekte die brasilianische Liebe zum Fußball hervorbringen kann, zeigt ebenfalls eindrucksvoll das Stadion in der Stadt Macapá in dem zu 90 Prozent mit Urwald bedeckten Bundesstaat Amapá. Das 1990 eingeweihte Stadion wird „Zerão“ genannt, die „große Null“. Der Grund: Die Mittellinie verläuft genau über dem Äquator. Nach dem Münzwurf vor einem Spiel werden die Kapitäne vom Schiedsrichter gefragt, auf welcher Erdhalbkugel sie beginnen wollen. Eine Mannschaft beginnt auf der südlichen, die andere auf der nördlichen Hemisphäre.
Vor so viel Entschlossenheit zum Fußballwahnsinn erscheinen die nach dem Bau des Stadions zutage getretenen Mängel als Randerscheinungen. Den Bauherren war es bei der Errichtung ihres Prestigeobjekts weniger um solide Planung zu tun als um rasche Fertigstellung. So riss der erstbeste tropische Sturm, beileibe keine Seltenheit in diesen Breitengraden, das Dach des Stadions fort.
Heute ragen die acht Stützpfeiler aus Beton als nackte Säulen in den Himmel. Mit einer grundsätzlichen Sichtbehinderung im Stadion müssen die Besucher ohnehin leben: Die Flutlichtmasten stehen im Innenraum des Stadions direkt um das Spielfeld. Dass es für die ausführende Firma der erste Stadionbau war, erübrigt sich zu erwähnen.
Zwischen Sprecher- und Trainerkabine
Was den Dilettantismus authentisch macht, ist die dahinterstehende Motivation, die in der Sache selbst liegt. Frei von derartigen Hemmschuhen wie einer soliden Grundlage für das eigene Handeln lassen sich auch Selbstzweifel leichter beiseite wischen. Und wo Populismus auf ein empfängliches Publikum trifft, können die merkwürdigsten Wege eingeschlagen werden. Aus dieser Gemengelage lassen sich die Karrieren so mancher Rundfunkreporter Brasiliens erklären.
Das Radio hatte seit den 1950er-Jahren nicht unwesentlich zur Entwicklung des Fußballs zum unbezweifelbaren Nationalsport beigetragen. Für die nicht geringe Zahl an Analphabeten im Brasilien jener Zeit war die Radioübertragung die einzige Möglichkeit, über das Fußballgeschehen im riesigen Land auf dem Laufenden zu bleiben. Der journalistische Umgang mit dem Sport war von Anfang an eher auf leidenschaftliche Dramatisierung gepolt als auf nüchterne Berichterstattung.
Der Fußball in Brasilien sprach eine eigene Sprache. Noch heute klingen südamerikanische Fußballkommentatoren in europäischen Ohren wie Schamanen oder Derwische, wie enttäuschte Liebhaber oder ekstatische Enthusiasten. Das weltberühmte, opernhaft intonierte „Gol“, angemessen ausgeschrieben mit mindestens zehn „o“, wurde 1942 vom Reporter Rebelo Júnior erfunden und trat einen Siegeszug durch die südamerikanische Fußballwelt an. Júniors Kollege Raul Longas heulte bei jedem Tor Ewigkeiten wie eine Sirene ins Mikrofon. Dies hatte den einfachen Grund darin, dass der kurzsichtige Sportbeobachter von seinem Platz aus nie erkennen konnte, welcher Spieler den Treffer erzielt hatte. Aus der Not ein Markenzeichen machend heulte er solange infernalisch herum, bis ihm ein Mitarbeiter den Namen des Torschützen schriftlich anreichte. Den Rundfunkreportern lagen die Massen zu Füßen. Und die Journalisten, die sich als Sprachrohr der Fans verstanden, lebten ihre Leidenschaft frei von jeglicher Zurückhaltung aus.
Der beliebteste Sportreporter der 1940er-und 1950er-Jahre, Ary Barroso, komponierte nebenher äußerst erfolgreich Songs, u. a. für die populäre Sambasängerin Carmen Miranda, war Schriftsteller, Politiker und Fernsehstar. Als Komponist war er Anfang der 1940er-Jahre derart erfolgreich, dass Walt Disney ihm die musikalische Leitung einer Filmproduktion anbot. Mit der Begründung, „Was soll ich in Kalifornien, wo Flamengo nicht ist?“, lehnte er das lukrative Angebot ohne zu zögern ab. Die Liebe zu seinem Verein war das Einzige, das zählte. Diese Leidenschaft erkannte man auch daran, dass der musikalische Barroso Tore Flamengos, statt diese schnöde anzusagen, mit einer triumphalen Fanfare auf der Mundharmonika begleitete. Gegnerische Treffer hatten ein tonloses ausgenudeltes Gekrächze des Instruments zur Folge. Doch bemerkenswerter als seine originelle Performanz war, wie Barroso den Einflusskreis seines Berufszweigs vergrößerte: Nicht nur, dass er eine Übertragung eines Flamengo-Spiels nach einem Treffer für mehrere Minuten unterbrach, um aus seiner Kabine auf den Platz zu stürmen und mit den Spielern zu jubeln; Barroso erstritt eigenmächtig das Privileg des brasilianischen Reporters, jederzeit am Spielfeld Interviews führen zu dürfen.
An die Traditionen der extrovertierten und unberechenbaren Radioreporter anknüpfend etablierte sich bald die Radialista, eine Mischung aus Show und Sportübertragung, die dem Wunsch nach Spektakel perfekt entsprach und vielen ihrer Macher eine Karriere auch jenseits des Sports einbrachte. Der Populärste der Radialistas war gewiss Washington Rodrigues. Dass er kein Problem mit ungewöhnlichen Herausforderungen hatte, erkannte man daran, dass er vor wichtigen Spielen schon mal den Ball interviewte. Die Quadratur des Kreises gelang ihm schließlich, als er von der Radiotribüne, traditionell ein Ort der fußballerischen Besserwisserei, direkt auf die Trainerbank des Traditionsvereins Flamengo wechselte.
1995 ging es mit Flamengo sportlich bergab. Dessen Präsident, übrigens selbst ein ehemaliger Radialista, kam in seiner Not auf die populistische Idee, dem Flamengo-Fan und Radiokritiker Washington Rodrigues den Trainerposten anzubieten. Dieser sagte ohne zu zögern zu. Im Gespräch mit Alex Bellos bekundete er, zwar kein ausgewiesener Fachmann zu sein, aber mit der nötigen Chuzpe ausgestattet fügte er hinzu, dass jeder Brasilianer wisse, wie Fußball funktioniere.
Nach kurzer Zeit musste er jedoch feststellen, dass seine Kompetenzen wohl nicht ausreichten, um den Zampano zu geben, und so entschied er sich, im Herzen doch Journalist, seine Spieler zu interviewen. Rodrigues befragte seinen Kader nach den Gründen für den sportlichen Niedergang und stellte nach der Auswertung dieser Interviews einige Vorschläge vor, aus denen die Spieler die beste taktische Marschroute auswählen durften. „Fußballtaktik ist wie ein Büffet. Wenn da vierzig Gerichte vor dir stehen, probierst du vielleicht vier oder fünf. Du isst nicht alle vierzig.“
In den deutschen Profiligen schreibt der DFB verbindlich die Fußballlehrer-Lizenz für die Trainer vor. Man mag sich fragen, wozu diese Humorlosigkeit gut ist, wo es doch so einfach sein kann. Nörgelt im Fernsehen ein sogenannter Experte zu viel herum, setze man diesen einfach auf die Trainerbank. Soll er es doch besser machen. Nach diesem Prinzip der ungefragten Wortmeldung bewirbt sich unverdrossen Lothar Matthäus, der in Brasilien bekanntlich anderthalb Monate trainiert hat (wovon er freilich 30 Tage wegen Schiedsrichterbeleidigung gesperrt war), auf die meisten freien Trainerstühle.
Ein weiteres Problem in der Wahrnehmung des Radialistas stellte sich bald heraus: An seine Vogel-Perspektive von der Pressetribüne aus gewohnt, war Rodrigues nicht in der Lage, das Spiel seiner Mannschaft von der Seite aus zu lesen. Kurzerhand bat er den brasilianischen Verband, einen Fernseher neben seine Trainerbank stellen zu dürfen, um auf diesem die Live-Übertragung der Flamengo-Spiele, die drei Meter von ihm entfernt stattfanden, sehen zu können. Der Brasilianische Verband wand sich mit diesem Anliegen an die FIFA, die jedoch zu diesem merkwürdigem Antrag schlechterdings den eigenen Statuten keine rechtsverbindliche Anweisung entnehmen konnte. Achselzuckend bekam Rodrigues seinen Wunsch genehmigt und schaute fortan auf der Trainerbank die Spiele seiner Mannschaft auf einem kleinen Fernseher.
In den vier Monaten seiner Amtszeit stabilisierte sich Flamengo immerhin so sehr, dass Rodrigues 1998 erneut für vier Monate als Aushilfstrainer einspringen durfte. Die professionelle Trainergilde dürfte die Episoden mit dem Radiofritzen, als Coach aus dem hohlen Bauch heraus, skeptisch betrachten. Washington Rodrigues wurde durch diese persönliche Erfahrung eine gewisse Demut vor dem Beruf des Trainers zuteil: „In vierzig Jahren lernte ich nicht so viel wie in jenen acht Monaten. Ich sah die Spieler zum ersten Mal in einem anderen Licht, was sie die Woche über machen, wie sie leben. Ich musste einsehen, dass vieles, was ich früher gesagt oder geschrieben hatte, falsch war. Es tut mir wirklich leid, und heute bin ich mit Kritik an Trainern viel vorsichtiger.“ Immerhin, möchte man sagen, wenn auch der Trainerberuf leichten Schaden genommen haben mag, so wurde zumindest ein wilder Sportreporter gezügelt.
Pilgergänge und das Blau der Jungfrau
Die Kreativität, mit der Brasilianer alle Möglichkeiten ausloten, ihrem Verein zum Erfolg zu verhelfen, zeigt sich auch in den absurden Exzessen, die der Aberglaube hervorbringt. Im religiösen Synkretismus Brasiliens gehen der Katholizismus, die besonders in den letzten Jahren wachsenden evangelikalen Sekten, traditionelle Religionen wie Voodoo oder Candomblé und der „ganz normale“ Aberglauben tolle Bündnisse ein.
Traditionell beten Katholiken bestimmte Heilige an, um Beistand bei konkreten Lebensproblemen zu erhalten. Im Gegenzug geloben die Gläubigen symbolische Bußetaten zu vollbringen. In einem Land, in dem der Fußball im Gefühl der Menschen vielleicht das zentrale Lebensproblem ist, welchem man mit der allergrößten Hingabe begegnet, mag der Pilgergang Didis, der mit Brasilien 1958 und 1962 Weltmeister wurde und bürgerlich Valdir Pereira hieß, nicht überraschen. Im Jahr 1957 gelobte Didi öffentlich, dass er zu Fuß vom Maracanã-Stadion zum Klubhaus Botafogos wandern würde, wenn Gott seinem Team die Meisterschaft schenken würde. Ein kräftiges „Amen“ und den erteilten Segen des Fußballgottes später durfte Didi tatsächlich zu seiner Pilgerschaft antreten. Womit er nicht gerechnet hatte, war, dass ihn 5.000 Fans auf seiner Wanderung begleiteten. Als er am Klubhaus ankam, trug er nichts mehr am Leib als die Unterhose. Unterwegs hatten sich die Fans tatkräftig um Souvenirs bemüht. Vor der Weltmeisterschaft 1958 in Schweden verzichtete Didi auf öffentliche Schwüre.
Legendär ist der Wallfahrtsort Juazeiro do Norte im nordöstlichen Bundesstaat Ceará. Jedes Jahr pilgern zwei Millionen Menschen in die 250.000-Einwohner-Stadt. Die Legende des Ortes geht zurück auf das Jahr 1899, in welchem sich bei der Kommunion des legendären Priesters Cicero die Hostie im Mund einer Laienschwester in Blut verwandelt haben soll. Solch Wunderwerk lockt natürlich neben christlichen Pilgern auch den abergläubischen Fußballliebhaber an, der es für geraten hält, sich mit dem (Fußball-)Gott gut zu stellen.
Mittlerweile weist die Kultstätte einen Devotionalienraum auf, in welchem sich Tausende Exvotos, kleine Opfergaben, für erbrachte Gunst von oben befinden. Fans, Spieler und Vereinsfunktionäre aller sportlichen Ebenen legen im Fußballtempel Trikots, Schuhe, Fotos, Haarbüschel, Totems und allen erdenklichen symbolischen Krimskrams ab, der dort gesammelt wird. Der riesige begehbare Devotionalienschrein trägt den Namen „Raum der Wunder“. Dem Abergläubischen beweist jede der Gaben selbstverständlich das Gelingen der Anbetung. Neben dem Raum der Wunder werden im „Nippesbasar“ die Kultgegenstände nach einer pietätsvollen Inkubationszeit wieder verhökert. Die ehemals profanen Gegenstände kommen mit geheiligter Aura wieder in den Umlauf.
Von nicht weniger magischer Aura umgeben ist die Pilgerstätte Aparecida do Norte im Bundesstaat São Paulo. Deren Geschichte beginnt im Jahr 1717, als Fischer in einem Netz eine Terrakotta-Statuette der heiligen Jungfrau fanden. Der Erzählung nach füllte sich der kaum Wasser führende Fluss nach der Bergung der Aparecida („unverhofft Erschienene“) getauften Dame mit Fischen. Die heilige Unverhoffte wurde seit dem 19. Jahrhundert mit einem blauen Samtmantel behangen ausgestellt und für so zahlreiche Wunder verantwortlich gemacht, dass der stetig anschwellende Pilgerstrom im Jahr 1955 mit dem Bau der Basílica de Nossa Senhora Aparecida gleich die Errichtung des zweitgrößten katholischen Gotteshauses erforderlich machte.
Die sich bald ergebende Verbindung dieser Heiligen zum Fußball mag dem rational denkenden und säkularisierten Europäer absurd erscheinen, für Brasilianer ist sie es keineswegs. Im WM-Endspiel 1958 hatte Brasilien gegen Gastgeber Schweden anzutreten, welcher wie Brasilien in Gelb antrat. Die abergläubischen Spieler der Seleção waren wegen der Tatsache, dass man plötzlich auf die blauen Ausweichtrikots zurückgreifen musste, schwer beunruhigt. Kurz vor dem Anpfiff stürmte der Leiter der brasilianischen Delegation, Paulo Machado de Carvalho, in die Kabine und erklärte den Spielern, dass das Blau im Gegenteil ein gutes Zeichen von oben sei, denn die Aparecida trage schließlich auch: Blau.
In dem Moment, in welchem der Schlusspfiff den Sieg Brasiliens besiegelte, war auch die „unverhofft Erschienene“ als Nationalheilige in Sachen Fußball etabliert.
Genau wie in Deutschland gelten auch in Brasilien die Torhüter als die Abergläubischsten aller Spieler. Im Unterschied zu den Gepflogenheiten hierzulande – Deutschland ist für seine grundsolide ausgebildeten Torwächter berühmt – erwartet man in Brasilien vom Torhüter nicht, dass er einen grundsoliden und sachlichen Job macht und keine Patzer begeht. Brasilianische Torhüter stehen vor der Alternative als Aussätzige oder Heilige angesehen und behandelt zu werden. Barbosa, der unglückliche Torhüter des verlorenen Finales 1950, wurde zeitlebens als Totengräber Brasiliens diskriminiert; hingegen wurde Claudio Taffarel, der Weltmeistertorhüter von 1994, nach dem gehaltenen Endspiel-Elfmeter des Italieners Daniele Massaro in mehreren Songs als „Schutzengel Sankt Taffarel mit den wundersamen Händen“ besungen und geehrt. Vor dieser zugespitzten Erwartungskonstellation mag es kaum Wunder nehmen, wenn brasilianische Torhüter einen ausgeprägten Wunderglauben entwickeln und einen besonders guten Draht zum Fußballgott aufzubauen trachten. Exemplarisch für diese besonders prekär lebende Fußballspezies Brasiliens stand der Tormann Darci, der stets einige Minuten vor Spielbeginn sein persönliches Ritual aufführen musste, um sich sicher zu fühlen: Er dribbelte mit dem Ball im Mittelkreis einmal rund um den Schiedsrichter, kniete anschließend zum Gebet nieder, drosch danach einige Bälle ins leere gegnerische Tor, um schließlich, zwischen die eigenen Pfosten zurückgekehrt, seine Torlinie mit dem Fuß nachzuzeichnen und das eigene Tor auratisch zu versiegeln. Danach durfte es losgehen.
Botafogo und der magische Hund
Es war für Darci gewiss wichtig, seinem Beruf in einem Umfeld nachgehen zu können, in dem derartige Marotten auf Verständnis stießen. Die Grenzen dessen, was selbst für einen abergläubischen Menschen noch nachvollziehbar ist, lotete in den 1940er- bis 1950er-Jahren Carlito Rocha aus. Jener Rocha war Präsident des Klubs Botafogo aus Rio de Janeiro, was bedeutete, dass sein persönlicher Glaube an Rituale qua Amtsautorität den gesamten Klub in Atem hielt.
Als der Fahrer des Mannschaftsbusses einst in falscher Richtung in eine Einbahnstraße einbog und umkehren wollte, untersagte dies der Präsident persönlich umgehend: „Botafogo geht niemals rückwärts. Das bringt Unglück.“ Für die Spieler bedeutete dies, dass sie den Weg zum Stadion zu Fuß fortsetzen mussten. Sollten die Kicker beabsichtigt haben, auf dem Fußmarsch zum Stadion ihre Fußballschuhe einzulaufen, so hätten sie in ihren Tretern Zettel mit den Namen ihrer jeweiligen Gegenspieler vorgefunden. Der Präsident präparierte die Schuhe seiner Angestellten am Tag des Spiels dergestalt, dass das Herumtrampeln auf den kleinen, die Gegner verkörpernden, Voodoo-Zetteln deren Aura negativ beeinflussen sollte. Unterstützend wurden die Vorhänge im Botafogo-Klubhaus vor jedem Spiel zusammengeknotet, eine symbolische Fesselung des Gegners.
Bei Auswärtsspielen verstreute der Präsident ein Kilo Zucker auf der Stadionmauer des Gegners. Die magische Wirkung des Zuckers lässt sich womöglich auf die frühere Sklavenarbeit der Afrobrasilianer in den Zuckerrohrplantagen zurückführen, die seit dem 17. Jahrhundert den Voodoo nach Brasilien gebracht hatten. Neben diesem Schadenszauber, den Präsident Rocha dem Gegner angedeihen ließ, führte er eine im Laufe der Zeit wachsende Zahl an Talismanen mit sich. Um diese beisammenhalten zu können, ließ sich der Präsident schließlich eine riesenhafte Sicherheitsnadel anfertigen, an der er sie nun gesammelt um den Hals tragen konnte. Der edlen Überlegenheit Botafogos angemessen wurde die im doppelten Sinn Sicherheit gebende Nadel aus Gold hergestellt.
Die Spieler Botafogos waren selbst vor körperlichen Übergriffen ihres Vereinsvorsitzenden, natürlich im Dienste der gemeinsamen guten Sache, nicht sicher. Um zu verhindern, dass seine Spieler vergiftet werden konnten, bereitete der Präsident den Spielern das Essen eigenhändig vor. Ist über die Kochkünste Senhor Rochas nichts bekannt, so ist doch überliefert, dass dieser seine Finger beim Kochen im Haar des ihm jeweils nächststehenden Spielers reinigte.
Was im Verdacht stand, auf irgendeine geheimnisvolle Weise Botafogos Erfolg zuträglich zu sein, wurde gnadenlos durchexerziert. Und selbstverständlich auch vice versa: 1945 träumte der Botafogo nahestehende Sportjournalist Geraldo Romualdo da Silva, dass der Klub im nächsten Spiel über ein Unentschieden nicht hinauskommen würde. Als Botafogo sogar das Spiel verlor, wurde umgehend angeordnet, den somnambulen Unglücksraben vom Träumen abzuhalten. Wie dies zu bewerkstelligen war? Ganz einfach: Die Vereinsführung buchte dem Journalisten am Abend vor den Spielen einen Platz im besten Kasino der Stadt, Angestellte des Klubs holten diesen zur Sperrstunde ab und unterhielten den Journalisten ununterbrochen bis zum Spielbeginn. Mit Schlaf war es in dieser Saison nichts für da Silva, zumindest nicht am Wochenende.
Galt Carlito Rocha infolge derartiger Exzesse 1948 als der abergläubischste Vereinsboss Brasiliens, so führte ihm der Zufall in jenem Jahr seinen kongenialen Partner zu, mit dem gemeinsam Carlito Rocha fortan das legendärste Tandem in der Geschichte sportlichen Aberglaubens bildete: Biriba, einen Promenadenmischling von magischer Prominenz.
Das Debüt des berühmtesten Vierbeiners der Fußballhistorie fand in einem an sich unspektakulären Rahmen statt. Einem Ersatzspieler Botafogos namens Macaé war der herrenlose Straßenköter zugelaufen, just an einem Tag, als Botafogos Reserve ein ansonsten recht bedeutungsloses Spiel gegen Bonsucesso, eine unterklassige Mannschaft aus Rio, austrug. Da Macaé auf die Schnelle nicht wusste, wohin mit dem Hund, nahm er diesen mit zum Spiel. Lange Zeit hielt der Hund brav neben der Ersatzbank aus, bis er plötzlich bei einem Angriff Botafogos wie von der Tarantel gestochen auf den Platz in Richtung gegnerisches Tor stürmte. Der Schlussmann Bonsucessos griff, durch die Tatsache irritiert, dass sich neben den gegnerischen Stürmern und dem Ball noch ein Hund in seinem Strafraum aufhielt, an einem harmlosen Schuss vorbei. Macaé mag zunächst im Boden versunken sein, da er auf sein neues Haustier nicht besser acht gegeben hatte, zumal bei diesem Testspiel der unberechenbare Präsident zuschaute. Doch in dem Moment da der Schiedsrichter das Tor gab, stand für Präsident Carlito Rocha eines fest: Diesen Hund hatte der Himmel geschickt. Der Botafogo gewogene Fußballgott hatte Gestalt angenommen – als schwarz-weiß gemusterter Bastard. Daran konnte kein Zweifel bestehen, schließlich trug der Hund in seinem Fell die Vereinsfarben.
Hatte Macaé zunächst mit einigem Ärger gerechnet, so durfte er sich stattdessen einer plötzlich eingetretenen und nachhaltigen Wichtigkeit für seinen Verein erfreuen. Zwar nicht als Spieler, so aber doch als persönlicher Betreuer des magischen Hundes, der innerhalb kürzester Zeit das Maskottchen des Vereins wurde. Biriba, so ordnete der Präsident an, hatte fortan jedem Botafogo-Spiel beizuwohnen.
Tatsächlich stellte sich unter Biribas Ägide ein deutlicher Aufwärtstrend der Mannschaft ein. Um die magische Wirkung des Hundes zu befördern, bekam Biriba vom Mannschaftskoch Botafogos auf Weisung Rochas vor jedem Spiel ein Festmahl zubereitet. Manche Spieler mochten munkeln, der Hund werde besser versorgt als sie selbst, doch der Erfolg gab Carlito Rocha recht, wenn man auch nicht von einem wissenschaftlich validen Kausalzusammenhang sprechen konnte.
Biriba war bald nicht mehr nur als Glücksbringer wichtig, in engen Partien kam der Hund auch zu spektakulären Sondereinsätzen: Drohte ein Spiel zuungunsten Botafogos zu kippen, ließ Präsident Rocha den munteren Mischling aufs Feld jagen. Nach der nötigen Spielunterbrechung, um den Hund einzufangen, fand der Gegner nicht selten nicht mehr zu seinem Spiel-Rhythmus.
Die Bedeutung Biribas erkennend und ausgestattet mit einer passablen Portion Paranoia ließ Präsident Rocha anordnen, dass vor jedem Fresschen Biribas ein Spieler vorzukosten hatte. Im Fall eines Giftanschlags hätte man den Verlust eines einzelnen Spielers gewiss auffangen können, doch wer hätte den magischen Hund Biriba ersetzten sollen?
Die Erfolgs-, oder sollte man tatsächlich Glückssträhne sagen, Botafogos hielt an. Immer mehr Menschen brachten die Siege Botafogos mit Biriba in Zusammenhang. Schließlich kam es zu Entführungsdrohungen. Hundehalter Macaé wurde verpflichtet mit Biriba ins Klubhaus zu ziehen, um den ehemals streunenden und nun äußerst sesshaften Hund rund um die Uhr zu bewachen. Wer weiß, ob der Spieler sich des herrenlosen Hundes angenommen hätte, wenn er geahnt hätte, wie dessen Präsenz sein Leben verändern sollte? Leicht hatte es der Hundehalter gewiss nicht.
Und die Biriba-Show wurde noch toller. Vor einem wichtigen Spiel Botafogos erdreistete sich der unantastbare Vierbeiner und pinkelte einem Spieler des Teams in der Umkleide ans Bein. Die Logik Präsident Rochas kannte keine Ausnahme. Nach dem Sieg wurde angeordnet, dass Biriba bis Ende der Saison, wenn es die Natur denn hergab, vor jedem Spiel ans Bein desselben Spielers urinieren sollte.
Nun mag der geneigte Leser den Kopf ob dieser Auswüchse schütteln, doch eines steht unumstößlich fest: In der Premierensaison Biribas gewann Botafogo die Stadtmeisterschaft Rio de Janeiros – zum ersten Mal seit dreizehn Jahren. Roch es in der Kabine des Teams 1948 zwar etwas streng nach Hundefutter und Urin, so verlor die Mannschaft doch seit dem Auftauchen des legendären Straßenköters kaum noch ein Spiel. Carlito Rocha und Biriba waren das außergewöhnlichste Duo des brasilianischen Fußballs, die Fans Botafogos werden als historische Reminiszenz bis heute Cachorrada genannt, zu deutsch: Hundemeute.
Der Fluch des Phantomfroschs
Neben dem Hund Biriba und dessen zugunsten des eigenen Teams ausgeübten Zauber erlangte ein weiteres, wenn auch namenloses, Tier Berühmtheit im brasilianischen Fußball: der Frosch von Vasco da Gama.
Jener Traditionsklub der portugiesischen Einwanderer Rios verfügte in den 1930er-Jahren über eine hervorragend besetzte Mannschaft, die 1934 und 1936 bereits Rios Stadtmeisterschaft gewonnen hatte. 1937 stand im heimischen Stadion São Januário die Begegnung der Startruppe gegen den Abstiegskandidaten Andaraí FC an. Auf dem Weg zum Stadion stieß der Mannschaftsbus Vascos mit einem Müllwagen zusammen, was die Ankunft am Stadion endlos verzögerte. Dort wartete der Gegner ahnungslos im Nieselregen. Obwohl ein Antrag auf Wertung des Spiels zu eigenen Gunsten wegen des Nicht-Antretens des Gegners möglich gewesen wäre, erwies sich Andaraí als sehr fair im Sinne des Sportsgeistes.
Nach Ewigkeiten traf Vasco schließlich am Stadion ein und das Spiel konnte stattfinden. Der klar unterlegene Klub aus Bahia setzte auf eine auch real-sportliche Anerkennung der sportiven Geste und durfte nach entgegenkommenden Vorgesprächen auf eine gewisse Schonung hoffen. Doch auf dem Platz machte Vasco rücksichtslos ernst und schlachtete den Gegner, dessen Freundlichkeit man die Austragung des Spiels überhaupt verdankte, mit sage und schreibe 12:0 ab. Nach dem Abpfiff dieser ungastlichen Lehrstunde betrat Andaraís Ersatzspieler Arubinha das Spielfeld, kniete auf dem Rasen nieder und sprach laut ein Gebet, in welchem er beschwor, dass Vasco, wenn es denn einen gerechten Gott gäbe, genau zwölf Jahre lang die Meisterschaft nicht mehr gewinnen möge.
Zunächst maßen die Vereinsoberen der Geschichte keine besondere Bedeutung bei, doch kurze Zeit nach dem Spiel kursierten Gerüchte, Arubinha habe heimlich einen Frosch unter dem Rasen begraben. In den Naturreligionen Brasiliens gilt der Frosch, der Wächter des Regenwaldes, als Überbringer schlechter Nachrichten und Verwünschungen. Und das amphibische Menetekel begann Wirkung zu zeigen. Die kommenden Jahre sahen Vascos Starelf in der Tabelle stets weit vorn, doch es wollte mit dem Titel nicht klappen. 1943 drang Vasco mit einer der stärksten Mannschaften der Vereinshistorie endlich wieder ins Endspiel vor. Doch Gegner Flamengo, der Klub der benachteiligten Massen, triumphierte mit 6:2. Jetzt wurde Vascos Management nervös. Ein früherer Spieler des Klubs, der vorgeblich über besondere spiritistische Fähigkeiten verfügte, wurde angeheuert, um den Frosch zu entfernen, den Fluch zu bannen. Dieser schritt mit einer Wünschelrute, die auf dämonische Präsenz reagieren sollte, den gesamten Platz ab und verkündete schließlich, der Frosch sei unauffindbar.
Als im kommenden Jahr die Mannschaft, erneut hochfavorisiert in die Meisterschaft gestartet, den Titel wiederum verfehlte, schien es keine Alternative zu geben als vor dem Fluch zu kapitulieren. Arubinha wurde öffentlichkeitswirksam gebeten, dem Klub zu verzeihen. Man habe nun wirklich genug gelitten, er möge doch endlich verraten, wo der Frosch vergraben sei. Das Dumme war nur, dass Arubinha von einem Frosch nichts wissen wollte, er habe keinen Schimmer, wie die Gerüchte aufgekommen seien und habe nichts unter dem Rasen der einstigen Schande vergraben.
Es half nichts: Vascos Fans mussten das gesamte Spielfeld umgraben. Dass kein Froschskelett gefunden wurde, machte die Sache natürlich nur noch bedrohlicher. Die Vereinsoberen gaben keine Ruhe und beknieten Arubinha, etwas gegen den Fluch zu unternehmen. Achselzuckend verkündete dieser, er hebe offiziell den Fluch auf. Im folgenden Jahr wurde Vasco Meister und glaubte sich endgültig vom Phantom-Frosch befreit. Um ganz sicher zu gehen, verpflichtete Vasco zudem einen Masseur, der im Nebenberuf Medium war und einen direkten Draht zu den Orixas, den afrobrasilianischen Göttern, hatte.
1970 schlug die Stunde Vater Santanas. Seit dem Titelgewinn 1958 hatte Vasco die Meisterschaft nicht mehr gewonnen. Dieser Umstand wurde allgemein als Comeback des verwunschenen Froschs gewertet. Vater Santana trommelte, als die Saison erneut zu kippen drohte, etwa zwei Dutzend Kumpel, allesamt Dämonenbeschwörer wie er, zusammen, um in einer nächtlichen Zeremonie die Sache endgültig zu Ende zu führen. Die Candomblé-Kombo ließ diverse Dämonen Besitz von ihren Körpern ergreifen und streute Muscheln auf das Spielfeld, aus denen sie die Handlungsanweisungen der Dämonen entnahmen. Die launischen Götter forderten zur Neutralisierung des Fluches allerhand, beispielsweise musste ein großes Holzkreuz hinter einem Tor begraben werden. Solcherart gefordert hatten Vater Santana und seine Freunde Arbeit bis fünf Uhr morgens.
Was der skeptische Westeuropäer für eine alberne Arbeitsbeschaffungsmaßnahme für Esoterik-Freaks halten mag, wird in Brasilien anders gewertet. Vasco gewann die Meisterschaft und Vater Santana wurde fortan von den Anhängern des Klubs als Superstar behandelt und in jedem Spiel mit Sprechchören gefeiert. Seine Arbeit wurde erst in den Neunzigerjahren etwas eingeschränkt, als der Gesetzgeber die rituelle Opferung von Tieren für Vascos Erfolg verbot. Der Erfolg heiligt eben doch nicht mehr alle Mittel.
Das brasilianische Verständnis des Begriffs „Fußballmärchen“ ist zweifelsohne komplexer und reicher an Schattenseiten, als es hierzulande der Fall ist. Denn wie in den alten Märchen ist der brasilianische Fußballkosmos bevölkert von blutigen Legenden, absurden Verwünschungen und schutzbringenden Talismanen. Im Vergleich zu unsichtbaren Fröschen, magischen Mischlingshunden und Voodoo-Zauber erscheint eine böse Stiefmutter als recht banales Problem.