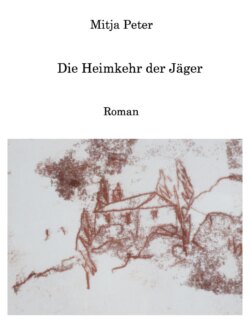Читать книгу Die Heimkehr der Jäger - Mitja Peter - Страница 4
На сайте Литреса книга снята с продажи.
II.
ОглавлениеAn jedem Morgen war Irene als erste in der Küche, um die Milchflasche für ihren zweijährigen Sohn zuzubereiten. Carla und Marie schliefen noch. Während Irene auf das Aufschäumen der Milch wartete, trat sie kurz ans Fenster und lauschte auf das gleichmäßige Brausen des Verkehrs, der über den nahen Platz strömte. Ab und an polterte ein Lastwagen beim Überqueren einer Bodenwelle. Dann wieder war ein Hupen zu hören. Gegenüber im Nachbarhaus schlug die Haustür ins Schloss. Jemand hustete und dann hörte sie, wie schwere Müllsäcke zur Straße hinaus geschleift wurden. Gleich mit dem Aufwachen kreisten Irenes noch dumpfe Gedanken wieder um ihre Arbeit. Die immergleichen Wortfolgen schwirrten ihr in den Sinn wie lästige Fliegen. Auch im Schlaf schien ihr niemand diese Last abzunehmen, die sie sich selbst auferlegt hatte. Eine Last, die erst mit den Jahren zur Qual geworden war, seit ihr bewusst war, dass sie ihrem Anspruch nicht würde gerecht werden können. Wie jeden Morgen und Abend füllte sie die Milch aus dem Topf in die Flasche um, schraubte den Deckel zu und stellte die Flasche in einen Behälter mit kühlem Wasser. Seit sie das Kind hatte und sich so viele Handgriffe täglich wiederholten, kam ihr das Leben in vielen Stunden eintöniger vor, doch empfand sie zugleich in Momenten der Besinnung, etwa am Abend sobald sie den Kleinen schlafen gelegt hatte und noch eine Weile im dunklen Zimmer neben seinem Bett lag, jeden Tag als ein Abenteuer, eine mühselige, alle Kräfte beanspruchende Wanderung durch ein unbekanntes Land. Aber diese Entdeckungsreise im Alltag der Erde führte zu keinem Ziel. Sie stieß auf kein weites, grünes Tal mit schimmerndem Bach und zierlichen Uferbäumen, kein Ort des Bleibens tat sich hinter einer Biegung auf, sie fand kein Gold, keinen fremden Eingeborenenstamm, keine pflanzenüberwucherte Stadt. Die Mühe begann jeden Morgen neu. Ich bewege mich im Kreis, dachte sie und setzte Wasser für Tee auf. Seit sieben Jahren arbeitete sie an einer Dissertation über die Anlagen von Segesta. Dabei war ihr aufgegangen, was für eine illusionäre Gaukelei die Wissenschaften sein konnten. Zu Ruhm gelangte man offenbar nur, indem man sein Gewissen ablegte. Um Entdeckungen, Ergebnisse seiner Forschungen bieten zu können, schritt so mancher über Ungereimtheiten hinweg. Sie fügten die Gegenstände in ihren Händen ihren Vorstellungen, nicht umgekehrt. Wie selten war es, dass beide zu Deckung kamen. Irene aber war gewissenhaft. Sie wollte nichts bloß behaupten, sondern alles einwandfrei beweisen. Obwohl sie sah, dass fast alle in ihrem Fach Behauptungen erhoben, blendeten, das Kümmerliche ihrer Beweisketten vertuschten, und dennoch Erfolg hatten, rang sie selbst um Wahrhaftigkeit. Und scheiterte damit immer wieder, da die Wahrheit von Ereignissen, die mehr als zweitausend Jahre zurücklagen, sich jedem Zugriff nun einmal entzog. Sie goss siedendes Wasser über die Teeblätter. Den Wissenschaftlern ist vielleicht zugute zu halten, dass es oftmals ihre Begeisterung für das Fach ist, die sie Schwächen, die übertünchten Brüche ihrer Arbeiten, übersehen lässt. Sie selbst lassen sich dann täuschen von einer nach zermürbenden Gedankenstrecken gewonnenen Erleuchtung, die aber gerade tückischer ist als die seltene, unvermittelte Inspiration, deren Empfänger von ihr überrascht wird, tückischer daher, weil doch niemand von dem offensichtlichen Lohn seiner Bemühungen lassen will, während im anderen Fall das nie Gesuchte leichter auch wieder aufgegeben werden kann. Irene hatte die Begeisterung nur einmal erfahren. Damals war sie - knapp drei Jahre war es her - in Sizilien gewesen. Sie hatte an einer Ausgrabung in Segesta teilgenommen und hatte in den vier Monaten ihres Aufenthalts den Tempel und das Theater untersucht. Immer wieder war sie wie selig und benommen auf den Steinen des etwas unterhalb einer Bergspitze in den Hang gebauten Theaters gesessen und hatte die Freiheit des Schauens genossen. Vor ihr breitete sich die Landschaft wie ein Gleichnis der Erde aus. Das fruchtbare Tal spannte einen weiten Bogen zum Meer hin, umgrenzt von den Küstenbergen, deren sanftes Steigen in schroffe Gipfelfelsen mündete.
Die Berge verschlossen den Raum nicht, sondern öffneten ihn, mehr noch als die nur erahnbare blau-diesige Ferne der Bucht von Castellamare, ins Weltweite. Stundenlang fotografierte und zeichnete sie, machte Notizen, unterbrochen nur von der Siesta, die sie im Schatten eines Baums oder im luftigen Zelt des Ausgrabungscamps hielt. Am Abend dann in dem kargen Zimmer des alten Bauerngehöfts, wo ihre Unterkunft war, bewertete sie ihr Tagwerk, verglich es mit Unterlagen und Büchern, die sie in ihrem Reisegepäck hatte, und breitete ihre Zeichnungen auf den Terrakotta-Fliesen des Bodens aus. Den kleinen Holztisch, der zur Zimmereinrichtung gehörte wie noch eine Truhe, ein Bett und ein Stuhl, hatte sie ans geöffnete Fenster gerückt. Dort las und schrieb sie, während draußen die Zikaden schrillten, begleitet vom leiseren Zirpen der Grashüpfer, und der Himmel über den Wipfeln der Pinien und Kiefern langsam in tiefstes Blau dunkelte. Irene nahm gerade das Teesieb aus der Kanne, als sie ein Trappeln kleiner Füße und dann ein kurzes, empörtes Stöhnen hörte. Da wurde auch schon die Küchentür aufgestoßen und Max stolperte verschlafen herein, ließ sich neben ihr fallen und begann zu weinen. "Ja doch, mein Schatz", sagte sie, "Guten Morgen" und hob ihn auf. In ihren Armen beruhigte er sich gleich, streckte aber eine Hand nach der Milchflasche aus. "Sie ist noch ein bisschen heiß", sagte Irene, worauf Max erneut jammerte. Sie beruhigte ihn, indem sie sich gemeinsam an den Küchentisch setzten und einen Spielzeugkatalog betrachteten. Nach einer Weile gab sie ihm die Milch und trug ihn in sein Zimmer, wo sie ihn, während er trank, auszog und wusch. In einer Stunde schon würde sie wieder über einem Buch brüten, in das sie Hoffnungen gesetzt hatte, das ihr aber in der Frage der im Tempelinneren fehlenden Cella bisher auch nicht weiter half. Ihr wurde übel bei dem Gedanken, dass sie in einigen Tagen gerade zu diesem Thema innerhalb eines Kolloquiums vortragen sollte. "Errichtet über einer prähistorischen Kultstätte", dachte sie, "der Tempel steht an einer den frühen sizilianischen Einwohnern heiligen Stelle. Das ist nichts Neues. Kein brauchbares Ergebnis. Das haut mir Madame um die Ohren." - Überhaupt Madame Bastide! Von Beginn an hatte sie Irene mit ihren Skrupeln und Zweifeln behindert und gepeinigt. Diese kleinen Briefe, die sie ihr auf ihren Platz in der Bibliothek legte! Meist begannen sie so, ohne Anrede: "Frage: Kann es sein, dass der Tempel zum Schein gebaut wurde, um nämlich die griechischen Nachbarn zu besänftigen? Vorgetäuschte Assimilation wäre das wohl zu nennen. Lesen sie dazu mal Richardson. Gruß Bastide." In dieser Art. Und dann die Sitzungen in Madames kleiner Wohnung in der Rue Vaneau, wo die Wände sozusagen mit Büchern tapeziert waren, sogar über den Türen hingen Regale. Nachmittage in ihrem Arbeitszimmer, die nicht zu enden schienen. Verkrampft saß Irene dort auf der Chaiselongue, im Rücken ein riesiges, besticktes Seidenkissen, das Madame Bastide einmal aus China mitgebracht hatte, Madame Bastide ihr gegenüber auf einem schlichten, ungepolsterten Lehnstuhl, zwischen ihnen ein mit Papieren und Büchern überhäufter niedriger Tisch; in einen ernsthaften Arbeitsdialog, wie es ihre Gastgeberin nannte, verstrickt, saßen sie da mehrere Stunden und ihr wurde es immer unbehaglicher zumute. Madame bot ihr niemals etwas an, weder Kaffee noch Tee, höchstens mal ein Glas Leitungswasser, geschweige denn Gebäck oder Kuchen, nicht aus Unhöflichkeit, es kam ihr einfach überhaupt nicht in den Sinn. Einmal, Irene war schon im Aufbruch, stand im Mantel, Rucksack geschultert, an der Tür, da fragte Madame sie plötzlich: "Sie dürften wohl Hunger haben?" - es klang wie eine Feststellung. "Oh, wir essen ja gleich zu Hause", wich Irene aus, Madame aber hörte ihr gar nicht zu und war schon in die Küche gelaufen. Sie kam mit einem vollkommen runzligen Apfel und einem Stück Baguette zurück, das trocken war, um ehrlich zu sein. "Danke, aber ich mag nur die fast noch grünen Äpfel", sagte Irene, nahm aber das Brot. Madame rümpfte tatsächlich, leicht pikiert durch die Replik, die Nase und sagte: "So, na wie Sie meinen. Auf Wiederschauen dann." Max war nun angezogen. Irene hob ihn hoch in die Luft, schüttelte ihn ein wenig, bis er lachte und stellte ihn auf die Füße zurück. Er blickte zu ihr auf und sagte: "Mama. Nicht arbeiten." - "Doch Max, ich muss arbeiten, und Du musst in die Krippe." - Der Junge nickte kurz und machte sich über eine Säulenhalle aus Bausteinen her, die Irene am Abend zuvor mit ihm gebaut hatte. Max rammte mit einem Bagger einige der Säulen und betrachtete sich dann die Trümmer. Irene war inzwischen in die Küche gegangen, trank dort Tee und aß zwei Scheiben Toastbrot dazu. Obwohl sie frühzeitig aufgestanden war, war sie nun doch in Eile. Sie musste Max noch die Tasche packen und ihm Mantel und Schuhe anziehen. Irgendwie schafften sie es aber, obwohl Max sich sträubte und, immerzu in Bewegung, nach irgendwelchen Dingen in seiner Reichweite griff, rechtzeitig das Haus zu verlassen. Fünfzehn Minuten später saßen sie in der Metro und stiegen an der dritten Station schon wieder aus. Sie kamen nach oben in den Lärm einer in der Morgensonne glänzenden Ausfallstraße. Stadtauswärts schlug sie eine schnurgerade Schneise durch einen Eichenwald. "Hier beginnt Paris", dachte Irene an jedem Morgen und sah sich um; Vorstadtvillen säumten einen seitlich der Straße gelegenen kleinen Park. In den Villen, die früher von Gärten umgeben gewesen waren, hatten sich der Nähe eines Friedhofs gemäß, Blumenhändler und Steinmetze angesiedelt. Pavillons und Verkaufsbuden waren an der Straßenfront der Villen angebaut worden, in den ehemaligen Vorgärten lagerten Grabsteine oder Blumenkästen. Irene ging mit Max auf dem Arm durch den kleinen Park, vorüber an einem von Sträuchern umschlossenen Rondell, zwei Kastanienbäumen und einem Rasenstück. Sie überquerten eine Zufahrt zu einem Friedhof und betraten durch ein altes, schmiedeeisernes Tor den Garten der Krippe. Die scharfen und klaren Klänge des Sommermorgens flossen hinter ihnen zu einem einheitlichen Rauschen zusammen. Feucht und kühl war es unter den Platanen, die den kiesbestreuten Weg zum Haus beschatteten. Die scheckige Baumrinde duftete. Seitlich des Eingangsportals, zu dem drei Stufen hinaufführten, stand eine schlichte unlackierte Holzbank vor der Mauer aus hellem Sandstein. Dort saß Piero, der sich, als die beiden näher kamen, erhob, aber dann unschlüssig stehen blieb. Irene ging ohne ihn eines Blicks zu würdigen zum Eingang hinauf und verschwand mit Max in der Villa.
Piero setzte sich wieder und wartete. Das Sonnenlicht, gebrochen vom Laub der Platanen, erwärmte einzelne Flecken eines verlassenen Sandkastens, in dem die am Vortag gebrauchten Spielsachen bis zur Rückkehr der kleinen Göttergesellschaft in magischer Starre gleichmütig ihr Los trugen. Nach und nach vertrieben die Sonnenstrahlen den grauen Schleier der Frühe aus dem Garten. Das bisher ferne Brausen des Verkehrs rückte mit zunehmendem Licht näher, wurde aufdringlich und lärmend. Die schwere Haustür fiel wieder ins Schloss. Piero wagte nicht, den Kopf zu drehen. Er lauschte. Gleich würde er das Rasseln hören, das ihre Schritte in dem feinen Kies erzeugten. Aber da fegte schon ihre Stimme wie eine helle Fanfare die Leere seines Kopfes, in der er panisch das rechte Wort suchte, beiseite. Ihrem Gruß folgte ein ungeduldiges "Was willst Du?".
Sie saß neben ihm auf der vorderen Kante der Bank, bereit zum Aufspringen, ihm zugewandt und ihn fest ansehend. Er schwieg, er wusste es nicht.
-"Soll ich Max heute Nachmittag abholen", fragte er zögernd, auch um überhaupt etwas zu sagen und dachte dabei: "Ich weiß es doch, ich weiß es doch, was ich will. Nur aufwachen und Eure schlafenden Gesichter betrachten."
- "Das würde ihn sehr freuen", sagte Irene, "hör mal, lassen wir uns nicht täuschen von unserer Zeit in Sizilien. Du hast eigentlich Recht - wir beide, das ginge nicht gut."
- "Weißt du, mir scheint es, als würde etwas, was sein soll, nicht geschehen", sagte Piero. Er sah nun etwas Zärtlichkeit in ihrem vorher so kalten Blick glänzen.
- "Wie geht die Arbeit voran? Du hast mir doch von dieser Galerie erzählt, die an Deinen Sachen interessiert sei."
- "Sie haben fünf Bilder von mir angenommen. Sie hängen seit einigen Tagen. Es ist im Marais. Die Galerie Zéphyr."
- "Oh! Das passt gut zu Deinem Stil, finde ich. - Hat Dir das Alleinsein geholfen. Bist Du dem näher gekommen, was Du Dir vorstellst?"
- "Ich weiß es nicht." - "Und Marie", fragte sie.
- "Marie kann morgen schon auf und davon sein. Ich mag sie und will ihr ein wenig bei der Suche nach ihrem Vater helfen, das ist alles."
Plötzlich war sie verlegen. Piero saß vorgeneigt, seine Arme ruhten auf den Beinen, in einer Hand spielte er mit Kieseln, die er vom Boden aufgelesen hatte. Sie sah ihn jetzt nicht mehr an. Ihre Finger trommelten auf der Rückenlehne der Bank. Sie wunderte sich selbst über ihre Neugierde und ihre Unruhe. Sie ärgerte sich, dass er sie verunsichert hatte. Eifersucht ist es nicht, dachte sie. Wie soll ich dieses Gefühl aber nennen.
- "Ja, vielleicht habe ich mich in sie verliebt", sagte Piero, "aber was bedeutet das schon. Ich verliebe mich leicht und mehrmals täglich."
Sie lachte und strich ihm mit den Fingern über Stirn und Nase.
- "Von wie vielen Sizilianerinnen träumst Du denn noch?"
- "Du verstehst mich nicht", sagte Piero.
- "Doch, ich verstehe Dich sehr gut", erwiderte Irene und stand auf, "ich habe leider kaum Zeit. Die Universität wartet. Holst Du dann Max, ja? Bring' ihn zu Carla. Und rufe mal an kommende Woche. Wir könnten abends ausgehen, vielleicht ins Kino – oder was gibt es an Konzerten?"
Piero nickte und winkte ihr zu, da sie sich im Reden schon einige Schritte entfernt hatte. Als sie die Allee entlang zum Tor lief, bereute sie es, ihm eine Verabredung vorgeschlagen zu haben.
"Es wäre wirklich besser, wir würden uns nicht mehr sehen", sagte sie laut, schloss das Tor und warf einen Blick zurück auf die schmale Gestalt vor der nun völlig vom Sonnenlicht angestrahlten Fassade.
In der Universität fand sie einen Stapel Bücher auf ihrem Tisch vor. Ein kleiner Zettel lag obenauf. "Könnte einen Blick wert sein. Bastide." stand darauf geschrieben. Irene wischte den Zettel beiseite, schlug eines der Bücher auf, las kurz darin mit an die Schläfe gelegter Faust und ließ ihre geballte Hand dann auf den Stapel knallen. Die anderen Studenten in der Bibliothek drehten sich nach ihr um, glotzten verwirrt und wandten sich dann wieder ihren Büchern oder Manuskripten zu, gleichgültig wie Kühe, die ihre Mäuler wieder ins Gras hinab senken. Irene hätte laut schreien mögen. Stattdessen nahm sie einen Ordner aus ihrer Tasche und blätterte darin, hier und da etwas mit Bleistift anstreichend. Die Wissenschaft will immer Lösungen. Ich kann ihr aber nur mit Zweifeln und Fragen dienen, dachte sie einmal und notierte es am Seitenrand. Der Morgen verging. Am Mittag ließ sie sich von zwei Mitstudenten überreden, in der Mensa zu essen. Sie willigte ein, weil sie heute länger in der Bibliothek arbeiten wollte, als sie ursprünglich geplant hatte - denn Piero holte ja nun Max von der Krippe ab.
In der Mensa saßen sie zufällig mit einigen Naturwissenschaftlern an einem Tisch, unter denen eine angeregte Diskussion im Gange war. Während des Essens hörte Irene, ohne von ihrem Teller aufzublicken, dem Gespräch zu. Auf ihre beiden Begleiter achtete sie überhaupt nicht mehr, gab nur einmal fast widerstrebend Auskunft, nachdem sie mehrmals angesprochen worden war. Dagegen lag ihr hin und wieder etwas auf der Zunge, was sie zu der Diskussion nebenan gerne beigetragen hätte. Sie wagte es aber nicht. So wie sie verstand, hatte eine von namhaften Wissenschaftlern unterzeichnete Resolution die Debatte ausgelöst. Die Unterzeichner begrüßten die Fortschritte in der Gentechnik und setzten sich für weitere Forschungen auf diesem Gebiet ein. Ein großer, sehr aufrecht sitzender Student, der eine kleine randlose Brille trug, sagte, als sich Irene mit ihrem Tablett gerade gesetzt hatte: "Hat die Vernunft jemals ein moralisches Problem gelöst? Zweite Frage: Hat sie sich nicht höchstens darüber hinweg gesetzt?"
- "Der Begriff Vernunft müsste zunächst definiert werden", warf ein Mädchen ein, das zugleich Irene grüßend zulächelte.
- "Befürworter und Gegner der Technik haben unterschiedliche Auffassungen, was vernünftig ist."
- "Vieles in der Wissenschaft scheint mir ausschließlich irrational fundiert zu sein, "fügte ein dritter Student hinzu, der gerade beim Schälen eines Apfels war.
- "Wann kommst Du wieder mal zum Tennis?" fragte das Mädchen, mit dem Irene den Gruß getauscht hatte.
- "Mit dem Kleinen ist das schwierig. Ich hätte dann ein schlechtes Gewissen, da ich sowieso so wenig Zeit für ihn habe", sagte Irene. Sie wunderte sich über das Angebot, denn zum letzten Mal hatten sie vor vielleicht drei Jahren miteinander Tennis gespielt, und nun war es so, als habe dieser lange Zeitraum überhaupt keine Bedeutung.
"Jedenfalls sind diejenigen, die sich etwas auf ihre Rationalität einbilden, seien es Politiker, Manager oder Wissenschaftler, häufig unberechenbar wie Kinder, und im Gegensatz zu diesen auch dumm, arrogant und gewissenlos", sagte der Student mit der randlosen Brille. Sein Gesicht war von Narben übersät, die Haut hell und fleckig.
Irene war von seinem selbstbewussten Reden beeindruckt.
Ein anderer griff nun offenbar einen früheren Punkt der Diskussion wieder auf. Während sich noch Widerspruch gegen die letzte Behauptung regte, sagte er: "Nicht nur die menschliche Natur, alle Natur ist einzigartig und heilig."
- "Warum ist sie heilig", fragte Irenes Bekannte.
- "Sie ist heilig, weil sie ein Geheimnis ist."
- "Womit wir uns abfinden sollten," sagte der Narbengesichtige, der offenbar gar kein Naturwissenschaftler war, "wir wundern uns über das Dasein, wir staunen über seine Schönheiten, wir selbst sind Teil dieses Ungeheuren. Was fassbar ist, ist nicht mehr schön. Und die Natur ist mächtiger. Ich stelle mir manchmal ein Forschungslabor in Kalifornien vor. Dort wird eine große Entdeckung gemacht, eine einmalige Sache. Alle sind euphorisch. Und im gleichen Augenblick, als sie ihr "Heureka" schreien, bebt die Erde, ein großes Beben, in wenigen Sekunden sind von dem Labor nur noch Trümmer übrig."
- "Mich fragte mein kleiner Neffe neulich, was denn die Schwerkraft sei und während ich es ihm in üblicher Weise zu erklären versuchte, merkte ich, dass nicht nur ich, sondern niemand ihm eine wirklich befriedigende Antwort würde geben können. Und so ergeht es uns mit fast allen diesen Kinderfragen. Sie rühren meist an Dinge, die auch uns Erwachsenen letztlich unerklärlich sind."
Diese schüchtern vorgebrachte Äußerung eines Studenten, der bisher geschwiegen hatte, wurde von kaum jemand wahrgenommen, denn alle hingen noch dem Bild des zerstörten Labors nach und versuchten daraus einen philosophischen Schluss zu ziehen. Nur Irene hatte zugehört und sah den jetzt wieder schweigenden Studenten aufmerksam an, während bereits der augenscheinlich Älteste am Tisch, ein Dozent, dessen ungewaschenes Haar mit einem nur lose zugeknöpften, zerknitterten weißen Hemd korrespondierte, empört ausrief: - "Aber dann wäre ja alles sinnlos! Wenn nur ein einziger Forscher das Beben überlebt, dann baut er das Labor wieder auf und die Entdeckung wird irgendwann wiederholt und doch bekannt. Wir wissen, dass unsere Gedanken, Gefühle, Sehnsüchte und Erinnerungen auf elektrochemischen Prozessen im Gehirn beruhen. Wir sollten uns von dem seelenvollen Wesen, das wir bisher annahmen, verabschieden."
- "Selbst wenn dies wahr wäre", erwiderte der Angegriffene, "würde sich damit irgendetwas verändern? Die Entdeckungen der Hirnforscher können den Begriff Seele nicht überflüssig machen."
- "Ja, das glaube ich auch", pflichtete jemand bei.
- "Selbst wenn es gelingen würde, diese Gehirnvorgänge chemisch und physikalisch völlig zu erforschen, wenn wir also sagen könnten: das Gefühl der Liebe zu A wird in B so und so bewirkt und noch weiter, B liebt gerade A und nicht C, weil dies und jenes in seinem Hirn Ursache dafür ist, so hätten wir bloß Formeln und nicht mehr."
- "Formeln vermögen aber sehr konkrete Dinge in komprimierter Form darzustellen", warf der Dozent ein.
- "Das ist richtig", sagte der Narbengesichtige, "aber es blieben Fragen. Wir wären noch nicht am Grund angekommen. Ein anderes Beispiel: Fänden wir heraus, wann und wodurch das Universum entstanden ist, würde sich etwa auch die Theorie des Urknalls bestätigen: es blieben Fragen. Was war zuvor und warum war es so? Warum gibt es etwas und warum so und nicht anders?"
- "Naiv!" schrie der Dozent in die Runde.
- "Wir driften ab von unserem eigentlichen Thema, "sagte der Student mit der randlosen Brille, der so aufrecht da saß und jetzt gerade bedachtsam ein Joghurt auslöffelte.
- "Ja", sagte auch Irenes Bekannte, "wir sprachen doch über die Gentechnik. Über künstlich geschaffene Menschen und..."
"Künstliche Menschen", sagte der Student mit der leisen Stimme, dem auch jetzt wieder nur wenige zuzuhören schienen. - "Was für eine Lächerlichkeit! Den Forschern geht es doch nicht um das Wohl der Menschen, es geht ihnen nicht einmal so sehr um Ruhm oder Geld, es geht ihnen vor allem darum, weiterspielen zu dürfen, in möglichst großer Freiheit experimentieren zu können. Das ist ihr Sport. Sie sind Kinder. Der Zellhaufen, das Reagenzglas, die Pipette, das Mikroskop: das sind ihre Spielzeuge." Den beiden Archäologen gelang es doch noch, Irene in ein Gespräch zu verwickeln. Sie schnappte nur noch hier und da einen Satz aus der Debatte auf. Sie wurde immer dann hellhörig, wenn der junge "Häuptling Narbe", wie sie ihn im stillen für sich nannte, sich zu Wort meldete, mit einer kräftigen, lebendigen Stimme, die unwillkürlich aufhorchen ließ: "Aber warum gestehen wir dem Menschen eine Würde zu und warum soll sie unantastbar sein? Warum heißt es: Du sollst nicht töten! Das Selbstverständliche zu begründen - das ist die schwerste Aufgabe."
Noch als sie schon wieder in der Bibliothek saß, dachte Irene über diese Worte nach. Den langen Sommernachmittag hin brütete sie dann über den Büchern, die ihr Madame Bastide herausgesucht hatte. Doch auch in ihnen fand sie keine Erklärung für das Fehlen der Cella. Was angeboten wurde, waren Scheinlösungen. Bei näherer Betrachtung entpuppte sich alles als pompöse Kulisse zur Täuschung des Lesers. Durch die weit geöffneten großen Fenster strömten die warme Luft und die Düfte der Sträucher im Innenhof herein in den Saal. Die Stimmen der Studenten, die unten im Schatten saßen, drangen manchmal herauf und das Rauschen der Stadt erfüllte den blassblauen Himmel über den Dächern der Fakultät. "Ich bin gar keine Wissenschaftlerin", sagte sie sich zum wiederholten Mal, als sie später aus dem kühlen Gebäude in die warme Luft des Abends hinaustrat, die sie weich und besänftigend umfing, "und dennoch wälze ich meinen Stein. Einmal glaubte ich ihn am Ziel zu haben, in Segesta war es. Mit Hilfe eines alten Mannes und eines kleinen Jungen hielt ich den Stein für eine Weile auf dem Berg. Zu Hause verlor sich das Hochgefühl wieder im täglichen Wirrwarr. Nicht zu vergessen, dass sich dann Max gleich nach der Rückkehr bemerkbar machte."
Der Alte und das Kind waren häufig auf dem Ausgrabungsgelände erschienen. Sie hatte in der Hocke neben einem freigelegten Mauerstück gesessen und zugehört, wie der Alte dem Jungen, der ein eigenartiges spitzes Käppchen trug, dessen Ohrenklappen wie Flügel nach außen gestülpt waren, erklärte, was dort gearbeitet wurde.
Schließlich waren sie ins Gespräch gekommen. Irene hatte von ihren Forschungen erzählt und der Alte hatte sie und einige andere Studenten zu sich eingeladen. Sie dachte an diesen Abend als an einen ausnehmend schönen zurück. An einem langen Holztisch, der seit Jahrhunderten benutzt zu werden schien, hatten sie gesessen, die Tafel gedeckt mit blau-weißem Tongeschirr. Mehrere dickwandige, grobe Schüsseln mit Salaten und ein großer Korb voll frisch gebrochenen Weißbrotes standen da, ebenso kleinere Schalen mit Oliven und eingelegten Tomaten. Die Haushälterin des Alten trug dann noch drei gebratene Hähnchen auf Platten herein, während der Gastgeber um den Tisch herumging und Wein in die verzierten Gläser goss. Von draußen schallte das ununterbrochene Konzert der Zikaden herein.
‚Seit sieben Jahren an dieser Arbeit’, dachte sie, ‚und ich habe nichts erreicht. Hunderte von beschriebenen Blättern, Tausende von Kopien, dennoch könnte ich Madame nichts vorlegen. Was tue ich da überhaupt? An jenem Abend lag die Zukunft groß und offen vor mir. Ich fühle mich mit dieser Arbeit verwachsen. Sie ist ein Teil von mir. Nein, mehr noch, sie breitet sich in mir aus, etwas Monströses, das mehr und mehr von mir Besitz ergreift.’ - Signore Pisani, so der Name ihres Gastgebers, besaß verblüffende Kenntnisse über die Anlagen von Segesta. Auf Irenes Frage, ob er selbst Archäologe sei, hatte er geantwortet: "Nein, aber Kunsthistoriker."- Er habe viele Jahre an der Universität von Bologna gelehrt und sich erst jüngst ganz auf dieses kleine Landgut zurückgezogen, das er von seiner Schwester übernommen habe, die seit dem Tod ihres Mannes in Mailand lebe. Als Irene ihm die Schwierigkeiten ihrer Arbeit schilderte, riet er ihr, eben diese Schwierigkeiten nicht vertuschen zu wollen, sondern zum Thema zu machen. Die Wissenschaft scheue Widersprüche. Dies sei ein Fehler, sagte Signore Pisani. Eine Abhandlung könne auch suchend ihr Thema umkreisen, Antworten vorschlagen statt behaupten. Natürlich werde sie das Rätsel um Segesta nicht lösen. Bei dieser Feststellung erschrak Irene. Dies sei aber keine Schwäche ihrerseits, fügte Pisani sogleich hinzu. Es sei schön, dass nicht alles sein Geheimnis preisgebe. Damit hätten wir uns abzufinden. Ja es liege darin geradezu der Sinn unseres seltsamen Daseins. Da sie aber nun einmal Archäologin sei, so Pisani weiter, müsse sie dem gerecht werden und ihre Aufgabe so gut es ihr möglich sei, erfüllen. Der Kaiser sei ein Kaiser, der Bauer Bauer, der Gelehrte Gelehrter, zitierte er irgendeine alte chinesische Weisheit. Ein Bauer, der sein Bestes gebe, sei höher zu schätzen als ein Kaiser, der seine Regierungsgeschäfte schleifen lasse.
An jenem Abend, als sie um den gedeckten Tisch saßen, begeisterte er sie alle mit seinen Reden, in denen er Geschichte, Naturwissenschaft, Kunst und Philosophie aller Länder und Zeiten wie selbstverständlich als einen einzigen Garten vor ihnen erwachsen ließ, zwanglos sich von einem Baum zum nächsten bewegend. Es war, als verfüge er über das gesammelte Wissen der Menschheit. Auf die Frage, wie er denn seine Tage verbringe, erwiderte er, es sei ihm niemals langweilig, er teile die Stunden genau ein, was das Wichtigste sei; am Morgen treibe er seine Studien voran, am Nachmittag arbeite er im Garten oder versuche auf Wanderungen durch die Umgebung das Schauen zu erlernen.
Irgendwann erfuhren sie, dass er selbst eine kleine Ausgrabungsstätte auf seinem Grundstück hatte - alle horchten auf -, wohl ein römisches Haus, das nach und nach von ihm freigelegt werde. Derzeit sei er an einem Mosaikfußboden beschäftigt. Und er führte seine Gäste noch am gleichen Abend, etwas trunken von vielem Wein, eine große Stablampe auf den Weg richtend, zu der Grabungsstelle und zeigte ihnen zwischen Olivenbäumen eine Vertiefung, in der sie in dem suchenden Lichtkreis deutlich das Fundament einer römischen Villa erkannten. Von dem Mosaik waren viele blaue und jadegrüne Steine sichtbar gemacht sowie eine graue, zu einer geschwungenen Dreiecksform angeordnete Fläche, die Pisani als Flosse eines Delphins deutete.
Irene fuhr mit der Metro von der Universität nach Hause. Die Bahn schoss rüttelnd in den Tunneln dahin und kam nach jeweils kurzer, wie von roher Kraft dahingerissener Fahrt abrupt in den Stationen wieder zum Stillstand. Irene kam aus dem Untergrund die Treppen hinauf und verharrte für einen Augenblick an der oberen Stufe. Alles Leben der Stadt schien sich aus den Gebäuden in die Straßen ergossen zu haben und wogte im flimmernden Sonnendunst weit dahin. Und mitten darin, im Strom der Passanten, erkannte sie Carla und dann etwas später Max, der an Carlas Hand ging und ein Baguette im Arm hielt. Irene lief den beiden entgegen.
"Wir mussten noch einmal zum Bäcker", sagte Carla, "der junge Herr mochte ein frisches Brot, das noch knuspert."
Irene nahm Max hoch und küsste ihn auf beide Wangen.
"Ist Piero noch da", fragte sie Carla. – "Nein, er hat Max abgegeben und Marie mitgenommen", sagte Carla leichthin. - "Ach ja!?" - "Bemüh' dich nicht", sagte Carla. - "Was meinst du", fragte Irene. - "Gleichgültig zu erscheinen."
Sie bogen vom Boulevard ab in eine Seitenstraße, die bald nach einer Kurve parallel zu den Bahngleisen verlief. Kurz vor dem Gare du Nord fächerten sich hier die Gleise weiträumig auf. Die ebenerdige Wohnung hatte einen eigenen Eingang, da sie früher einmal für die Concierge des Mietshauses bestimmt gewesen war. Drei der vier Zimmer hatten große Fenster zur Straße hin, und dort spielten im Sommer bis zur Dunkelheit die Kinder der Einwanderer, von denen viele in dieser Gegend wohnten. Soeben tobte wieder eine sich jagende Schar um die beiden Ecken der Wohnung. Irene blieb nachdenklich in der Diele stehen und sah durch die drei offenen Zimmertüren zu, wie die Köpfe der Kinder draußen vor den Fenstern hin und her schossen; hell schallten das Trappeln der Füße und die sich überschlagenden Stimmen durch den Raum. Max hockte neben ihr auf dem Boden, wo sie ihn abgesetzt hatte und machte sich am Verschluss ihres Rucksacks zu schaffen. Das Klingeln des Telefons riss sie aus ihrer Versonnenheit. Sie meldete sich. - "Ja Maman, wir sind gerade erst nach Hause gekommen. Max war noch mal mit Carla einkaufen", sagte Irene. - "Ich war an der Universität." - "Was heißt warum?" - "Ja Maman, ich muss immer noch dort hin." - "Das dauert eben, Maman." - "Gut, bis...nein, Piero hat ihn abgeholt." - "Ach Maman, bitte." - "Nein!" - "Nein!" - "Gut,... dann....vielleicht in zwei Wochen " - "Wiederhören!" - "Ja, bis dann. "- "Ich bin nicht kurz angebunden." - "Also, wie geht es Dir?" - "Schön." - "Wusste ich nicht." - "Ja gut, das ist vielleicht für sie gut, aber für mich nicht." - "Also gut, ich melde mich." - "Adieu!"
Knallend legte Irene den Hörer zurück in die Gabel. Carla stand im Türrahmen ihres Zimmers, lehnte sich mit der Schulter an und lächelte. - "Erzählt mir von einer meiner Schulfreundinnen, die einen Finanzberater geheiratet habe. Sie hätten sich ein großes Haus am Rande des Dorfes gebaut. Gleich hinter dem Grundstück beginne der Wald. Diese Freundin habe sogar eine Putzhilfe und müsse gar nicht viel im Haushalt machen", sagte Irene, den Ton ihrer Mutter nachäffend.
- "Oh, so kann ich mir dich auch gut vorstellen", sagte Carla, "im Hauskleid, wie du morgens die breite Marmortreppe..."
Ein Telefonbuch kam geflogen. Carla flüchtete lachend in ihr Zimmer, wo sie sich auf ihr Bett warf. "Du hast sogar recht," rief Irene, die ihr nachgelaufen war und sich ebenfalls auf das Bett fallen ließ, "die Eingangshalle muss so groß sein wie die Scheune bei meinen Eltern, viel Marmor, kahle Wände." Max kam angewackelt, das Telefonbuch in zwei Händen tragend, und kroch zu ihnen aufs Bett. Eine Weile lagen sie einfach nur da und schwiegen, während Max mit einem Wachsmalstift, den er in einer seiner Hosentaschen aufgestöbert hatte, das Telefonbuch bemalte.
- "Es tut mir leid," sagte Carla dann, "das mit dir und Piero, ich muss es noch einmal ansprechen," sie übersah Irenes abwehrende Geste und fuhr fort: "ihr seid beide verrückt, nicht nur verrückt nacheinander, sondern auch verrückt, weil ihr nicht zusammenbleiben wollt."
- "Wie könne er eine eigene Familie gründen, wenn er doch mit der Familie, der er entstamme, noch nicht im Reinen sei", sagte Irene.
- "Das hat er gesagt?" rief Carla.
- "Ja. Du weißt, wie seine Mutter gestorben ist."
- "Aber was hat das denn mit Euch zu tun?"
- "Er hat etwas verloren und glaubt nicht daran, es wieder finden zu können", sagte Irene.
- "Und Du?"
- "Ich habe einen Fehler gemacht."
- "Und du bist zu stolz, ihn rückgängig zu machen. Weißt du", sagte Carla, "ich glaube, ihr flüchtet beide in Vorwände, bei dir ist es deine Arbeit, bei ihm die Vergangenheit."
- "Mag sein", sagte Irene.
Sie lagen noch lange schweigend nebeneinander. Max, dem das Malen bald langweilig geworden war, hatte sich an seine Mutter geschmiegt und war eingeschlafen. Langsam, unfassbar langsam, schwand das Tageslicht. Das Lärmen der Kinder dauerte an. Ihre Stimmen schienen mit zunehmender Dunkelheit immer heller und klarer, fast plastisch zu werden. Das Licht schwand, und jene Magie der Dämmerung breitete sich aus, die in der Kindheit beim Spielen alles gelingen lässt, eine traumverlorene Sicherheit und Übereinstimmung unseres Inneren mit den Aktionen des Spiels bewirkt, so dass jeder Ball, den wir mit dem Fuß oder einem Schläger berühren, mühelos sein Ziel findet.
Etwas, was ihr Pisani während eines gemeinsamen Spaziergangs gesagt hatte, kam ihr plötzlich in den Sinn: "Sie müssen in mir einen Schuldbeladenen, Gescheiterten sehen, dem eine Rückkehr unmöglich ist. Als Kind stellte ich mir mein späteres Leben paradiesisch vor. Warum nur? Man hat als Kind keinen Begriff vom Erwachsenensein." -
Dann erstarb das Rufen der Kinder und nichts war mehr zu hören als das Rauschen und Klopfen der Züge.
Als Irene erwachte, war es tief in der Nacht. Max schlief ruhig, aber Carla lag nicht mehr an ihrer Seite. Sie wird noch einmal ausgegangen sein, dachte Irene. Plötzlich fiel ihr ein, wovon sie geweckt worden war.
Da erschallte auch schon wieder die Sirene eines Gleisarbeiters, gefolgt von weiter entfernten Warntönen, die dem ersten wie ein Echo folgten. Irene trat ans Fenster und blickte über das nächtliche, von hoch an Masten und Türmen befestigten Flutlichtern angestrahlte Schienenfeld, ein Anblick, der sie immer an die Konzentrationslager denken ließ.