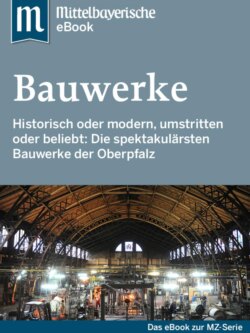Читать книгу Spektakuläre Bauwerke in der Oberpfalz - Mittelbayerische Zeitung - Страница 5
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеWie Bauklötze der Geschichte
Seit Jahrhunderten thront die Kastler Klosterburg über dem Lauterachtal. Während des Nationalsozialismus mussten hier Kinder aus Slowenien leben.
Heimatpfleger Hermann Römer verfolgt die Geschichte der Klosterburg in Kastl. Im Moment werden die Räume, in denen früher ein Gymnasium untergebracht war, nicht genutzt. Fotos: Gabi Schönberger
Von Andrea Fiedler, MZ
Kastl. Hermann Römer zeigt mit seiner Hand auf die Kirchenmauer. Die Wand verändert sich. Meterhohe Quader weichen hier salischem Mauerwerk. Die Struktur wirkt unruhig, wie aus Steinresten zusammengesetzt. Es ist der erste Blick auf die Klosterburg in Kastl, der die wechselvolle Geschichte verrät. Die Anlage scheint wie aus Bauklötzen einzelner Epochen verschmolzen. Die Spuren des Mittelalter, als Mönche eine bayerische Prinzessin einbalsamierten. Und die Zeit, in der die Nationalsozialisten die Anlage nutzten.
Es ist ein kalter Tag, an dem Hermann Römer den Spuren der Geschichte nachspürt. Erst am Nachmittag hat die Sonne den Nebel aus dem Tal vertrieben, und den Blick ins Lauterachtal gewährt. Der Ortsheimatpfleger läuft durch die Tore, passiert die Kirche. Dann steht er vor einem mehr als 40 Meter tiefen Brunnen, der die Anfänge der Klosterburg belegt.
Klosterbau im Jahr 1103
Drei Burgen sollen auf dem Hügel gestanden haben. „Chroniken aus dem 14. Jahrhundert belegen sie.“ Wie alt ihre Überreste aus dem frühen Mittelalter tatsächlich sind, kann heute aber niemand erklären. Belegt ist nur, dass die Burgherren sich zerstritten hatten und im Jahr 1103 mit dem Bau eines Benediktinerklosters begannen.
Hermann Römer ist die wenigen Schritte vom Brunnen zur Kirche gelaufen, die damals entstand. „Jeder Abt hat seitdem versucht, etwas hinzuzufügen.“ Massive romanische Säulen tragen das Kirchendach, in dem sich gotische Spitzbögen kreuzen. Unterhalb der Decke sind die Wappen der Häuser aufgemalt, die dem Kloster Geld und anderen Besitz vermachten. Das Kloster in Kastl sei in kurzer Zeit reich geworden, erklärt der Heimatpfleger. Es gewann an Bedeutung: Im Januar 1319 besuchte König Ludwig der Bayer mit seiner Familie die Klosterburg. Während des Aufenthalts starb seine Tochter Anna an einer Erkältung. Die Mutter, die weiterreisen musste, ließ das Kind zurück. Benediktinermönche mumifizierten den Körper und bestatteten ihn.
Spuren der Gotik und Romanik an der Klosterkirche
Vor zehn Jahren meldeten sich amerikanische Filmleute in Kastl. Darunter Mumienspezialisten, die zuvor bei Untersuchungen in Ägypten waren. Im Vorraum der Klosterkirche bauten sie ihr Labor auf und begannen die mumifizierte Prinzessin zu untersuchen. Die Spezialisten röntgten den Körper, analysierten Schädelknochen und Zähne. „Wir wollten alle Ergebnisse haben“, sagt Hermann Römer. Am Ende stellte sich heraus, dass die Prinzessin nicht älter als 15 Monate war. Jünger als angenommen.
Eine Mumie im Schrank
Im Vorraum der Kirche hängt ein Bild der 38 Zentimeter großen Mumie. Derzeit liegt sie in einem Schrank. Hermann Römer erinnert sich, dass die Mumie bis vor ein paar Jahren zeitweise in der Kirche ausgestellt war. Und auch heute fragen ihn die Leute, wann die Prinzessin wieder zu sehen ist. Weil der Körper Temperaturschwankungen und hohe Luftfeuchtigkeit nicht verträgt, wird die Prinzessin einen neuen Schrein bekommen – und dann wieder zu sehen sein.
Das Benediktinerkloster wurde im Jahr 1560 aufgelöst, weltliche Verwalter eingesetzt. Sie nutzten die Anlage, um Getreide zu lagern. Später wurde die Klosterburg an das Amberger Jesuitenkolleg übergeben. Und im 18. Jahrhundert lebten Mönche des Malteserordens in Kastl. Auch sie haben ihre Spuren in der Klosterkirche hinterlassen. Im Zuge der Säkularisierung erhielt der Freistaat Bayern die Klosterburg. Sie gehört ihm bis heute.
Es ist auch das Schicksal slowenischer Kinder, das mit der Klosterburg verbunden ist. Während des Nationalsozialismus lebten nicht nur junge Frauen des Bunds Deutscher Mädel in der Anlage. In Kastl wurde außerdem ein sogenanntes Umsiedlungslager eingerichtet. Hermann Römer hat im Gemeindearchiv die Spuren der slowenischen Kinder, die am 20. September 1942 in Kastl ankamen, gefunden. Ein Kassenbuch, in dem Einkaufsbelege und Rechnungen aus dieser Zeit stecken. Rund 170 Kinder – alle zwischen ein und 14 Jahren alt – seien über Ungarn und Österreich in die Oberpfalz gekommen, erklärt Hermann Römer. Ihre Eltern seien verhaftet worden und in Konzentrationslagern gestorben. In Kastl sollten die Kinder die deutsche Sprache und Geschichte lernen, sie bekamen altdeutsche Namen.
Unterhalb der Kirchendecke sind Wappen zu sehen.
„Für die Kinder war es eine schwere Zeit“, sagt Hermann Römer. Der Heimatpfleger hat mit einigen Slowenen gesprochen, die für drei Jahre in Kastl lebten. Ihnen habe eine Bezugsperson gefehlt, erzählte ihm eine Frau vor ein paar Jahren. Auch im Ort hat Hermann Römer die Geschichte wieder aufgerollt. Die Kastler mussten sich Vorwürfen stellen, die Geschichte zu verschweigen. „Die Kastler haben die Kinder schon gesehen“, sagt Römer. „Aber sie sind immer geführt worden, es gab keinen Kontakt.“ 1945 befreiten die Amerikaner die Kinder aus dem Umsiedlungslager.
Die Slowenen wollen auf der Klosterburg in Kastl eine Gedenktafel anbringen, um an ihre Zeit zu erinnern. Sie wird sich ins Mosaik der Geschichte einfügen.
Die Klosterburg thront über dem Ort Kastl.