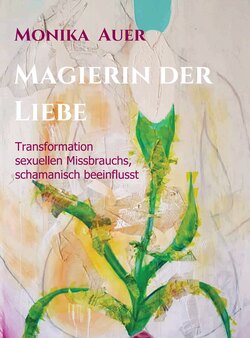Читать книгу Magierin der Liebe - Monika Auer - Страница 8
ОглавлениеVorwort von Professor Ruth Hampe
Zur Salutogenese des Bildlichen, zu Bildern von Monika Auer
(3) „Erinnern wir uns: Jeder Mensch zeichnetin seiner Kindheit, tanzt, denkt sich treffende Wörter aus und singt. Warum dann aber genießt er, wenn er erwachsen ist, selbst extrem ausdrucksarm geworden, nur manchmal die 'Schöpfung' eines Künstlers?“
Bereits Joseph Beuys hat die Bedeutung von Kunst und Heilkunde hervorgehoben. Nicht nur seine visionären, eigenen Erfahrungen nach einem Flugzeugabsturz während des 2. Weltkrieges von Mongolen in Filz und Fett eingepackt worden zu sein und so eine heilsame Wirkung erlebt zu haben – was dann auch Material seiner Kunstaktionen geworden ist, bedingen seinen Ansatz von Kunst und Leben. Vielmehr hebt er eine Auseinandersetzung mit einer Realität hinter der Materialität hervor, einer Dimension, bevor der Gedanke zustande kommt – also auch Inspiration und Intuition betreffend. Sein Ausspruch: „Jeder Mensch ist ein Künstler“, bezieht sich auch auf die Selbstheilungskräfte des Menschen und die kreativen Fähigkeiten sein Leben wie ein Kunstwerk bzw. eine soziale Plastik zu gestalten.
Wie bezogen auf einen alchemistischen Umwandlungsprozess werden elementare Erfahrungen und Stofflichkeiten benutzt in der Symbolik und Metaphorik von der Geburt bis zum Tod. In der Hinsicht werden die gestalteten Objekte oder Relikte von Handlungen zu Erinnerungsstützen von Denkansätzen. Sie sind ästhetische Zeugen eines gedanklichen Prozesses, der mit der Verschmelzung von Raum und Zeit arbeitet.
Mit seinem Ausspruch von 1984 „Kunst ist Therapie“ hat Beuys eine Dimension von Kunst angesprochen, der eine Vermittlerfunktion wie in einem schamanistischen Ritual zukommen kann. Heutzutage wird von dem ‚Flow‘ – dem zum Fließen-Bringen – im kreativen Prozess gesprochen bzw. dem Erleben eines Einheitsbezuges.
Auch Monika Auer hat in ihren ästhetischen Gestaltungen Anteile von sich neu entdeckt und ihre Lebensgeschichte anders bewältigen können. Ihre Auseinandersetzung mittels des künstlerischen Ausdrucks ist auch biographisch geprägt. Es ist die Bearbeitung traumatisch erlebter Kindheitserfahrungen von sexuellen Übergriffen in der Familie bis zum zwölften Lebensjahr, die sie über den ästhetischen Prozess neu zu integrieren versucht und die mit achtunddreissig Jahren einen Wendepunkt herbeigeführt haben mit dem Ausstieg aus ihrem Berufsleben.
So kam diese existentielle Krise mit der Infragestellung des eigenen Selbst in der Welt einer Entscheidung zwischen Leben und Tod gleich, worüber sie einen Neuanfang zu initiieren vermochte. Es beinhaltet ein prozesshaftes bildnerisches Arbeiten über ein Jahr als Bewältigung traumatischer Kindheitserlebnisse mit den Auswirkungen auf spätere Lebensphasen hin zu einer Neugeburt. Fast schonungslos geht sie auf ihre authentischen Erfahrungen ein, die heutzutage fast jedes Mädchen und jeden achten Jungen betreffen können und thematisiert die Auswirkungen von Borderline-Erlebnissen und Depressionen. Kunst wird für sie zum Ausdrucksmittel des Unaussprechlichen, das vor der sprachlichen Erfassung im gefühlsmäßigen Erleben liegt. Immer wieder thematisieren ihre Arbeiten ein sexuelles Trauma und eine mythische Selbstvergewisserung, Teil von Mutter Erde zu sein und ihre Heilkräfte zu spüren. Selbstzerstörerische Anteile werden zum Ausdruck gebracht ähnlich wie in apotropäischer Bedeutungsgebung – also Unheil abwehrend – und damit gebannt.
Das ästhetisch Gestaltete wird zu einem Gegenüber und aus dem diffus Beängstigenden und Belastenden geholt und wieder integrierbar. Es erscheint wie ein Hinabsteigen des Selbst in tiefe abgespaltene Erlebnishorizonte, die die Ohnmacht des verletzten Kindes hervortreten lassen und gleichzeitig in der Bewusstwerdung von Depersonalisationen die Bedeutung des eigenen Leibes als Ort des Lebens neu benennen. Elementare Wünsche nach Geborgensein, Vertrauen und Liebe werden wieder zugelassen und die eigene Sexualität neu wahrgenommen. In dem Sinne vermittelt dieser ästhetische Prozess etwas Versöhnendes in der Aufdeckung des Bedrohlichen und Abgewehrten. Der Integrationsprozess der Missbrauchserfahrungen führt zu einem gewandelten Selbst- und Weltbezug.
Aus der Traumaforschung ist bekannt, dass bei posttraumatischen Belastungsstörungen der Mensch auf der neuronalen Ebene in einen Ausnahmezustand versetzt wird. In dem Zusammenhang wird von der Amygdala als Alarmzentrum und emotionales Gedächtnis unseres Gehirns gesprochen. Darüber wird bei Gefahr ein Alarmsignal an den Hypocampus gesandt, um entsprechende Schutzhandlungen vorzunehmen. In einer traumatischen Situation kann dagegen eine Stresssituation nicht abgewehrt werden, und es kann zu einer Überflutung von Extremreizen kommen.
Unter traumatischen Stress schaltet sich der Hypocampus ab und Reaktionen des ‚Freeze‘, Gefrierens, und des ‚Fragment‘, also des Fragmentierens, treten auf, wodurch das Erlebte nicht mehr zusammenhängend wahrgenommen werden kann. Durch diese Trennung der emotionalen von der faktischen Wahrnehmung geht die Verknüpfung der Erinnerung verloren. Es besteht zu den traumatischen Erlebnissen keinerlei bewusste Verknüpfung, was dazu führt, dass es bei erneuten Konfrontationen oder Sinneserlebnissen zu einem ‚Flash Back‘ der emotionalen Gefühle kommen kann – die Person wird ‚getriggert‘. Auffallend sind dissoziative Identitätsstörungen, d.h. Depersonalisierung und Derealisierung als Ausdrucksformen einhergehend mit Bindungsstörungen.
Da das Trauma von der bewusstseinsmäßigen Spracherfassung abgespalten ist, können präverbale Medien eine Brückenfunktion in der Integration vornehmen. Allgemein wird ressourcenorientiert und mit positiven Bildern als alternative Wahrnehmungserfahrung im therapeutischen Prozess gearbeitet. Der ästhetische Ausdruck – also beispielsweise das Bildnerische; die Musik, der Tanz, das literarische Wort – kann in der Mehrdimensionalität eine Vermittlerfunktion einnehmen, die Zugänge zu abgespaltenen Erlebnishorizonten schafft und Integrationsformen über das Ästhetische bereitstellt.
Die gestalterischen Ausdrucksformen von Monika Auer sind mit Acryl gemalt und tragen Collage-Elemente aus Zeitungen und Illustrierten. Sie zeigen ein expressives, schnelles Arbeiten, das ganz impulsiv, unreflektiert einem fließenden Prozess des Gestaltens zu unterliegen scheint.
Die Bilder verweisen auf eine gefundene Spiritualität in der Bewältigung von erlebten Traumata. So heißt es auch zu einem ihrer Bilder „Queen I – a Birth of an Angel“: „Ich bin! Ich bin in meiner Mitte! Ich bin an meinem Platz! Ich bin da! Ich bin!“ Bilder werden für sie zu Ausdrucksformen eines Bewältigungsprozesses und verweisen auf Erkenntnisgewinn im Metaphorischen des Bildlichen, eine Transparenz von Realitätsbezügen. In dem Sinne sind sie subjektiv geprägt, laden aber im Betrachten ein, eigene Assoziationen wahrzunehmen und eigene Zugänge zu finden.
Sie zeigen die Kunst einer Frau, die offen ist, sich neuen Aufgaben zu stellen und die sich inspirieren lässt von dem Kommenden.
Es ist der Vor-Schein – wie Ernst Bloch (4) dies für das Ästhetische hervorhebt – der uns in der Kunst zu berühren vermag.
Allgemein sind Bilder Ausdruck inneren Empfindens und Verarbeitens. Sie sind nicht nur Dokument eines Zustandes, sondern verweisen zugleich auf ein Anderes, etwas Atmosphärisches, welches sie bestimmt. In dem Zusammenhang sind sie Zeugnis eines Erinnerns im spielerischen Tun, fangen Unsagbares ein und verwandeln es in Neologismen der ikonischen Sprachgebung.
Wenn Monika Auer in ihrem Buchprojekt „Magierin der Liebe“ ein Zeitzeugnis ablegt, versucht sie Geschehenes verstehend einzuordnen. Dagegen verbleiben die Bildmetaphern im Uneindeutigen, skizzieren nur, wo Schmach, Widerstand und Neuanfang sichtbar werden. Gerade dies macht sie reizvoll und transformiert das Geschehene in farbige Zeichen einer Prozessverarbeitung, die nicht der Sprache bedarf.
Als Alice Miller (5) ihre zufällig entstandenen kleinen Klecksbilder graphisch und malerisch weiter bearbeitete, erlangten sie in den Assoziationen einen projektiven Gehalt. Sie eröffneten einen Zugang zu frühkindlichen Erfahrungen, die sprachlich nicht erfassbar waren. Sie ermöglichten ihr mittels dieser Zufallstechnik eine Wahrnehmung von Verdrängtem und Abgewehrtem, von frühkindlicher Missbrauchserfahrung, die bildsymbolisch integrierbar wurde.
Nicht die Direktheit, sondern die Unbestimmtheit in der Aufdeckung verdrängter gefühlsbestimmter Anteile ließen das Unfassbar in der Bildgestaltung fassbar werden.
Der Objektbezug des Gestalteten bedingt eine Handhabbarkeit, die in dem situativen Erleben verhindert war, ein Verstehen unbewusster Muster, denen eine Sinnhaftigkeit zugesprochen werden kann. Wenn Aaron Antonovsky (6) von Verstehen, Handhabbarkeit und Bedeutungsgebung in Bezug auf den Kohärenzsinn spricht, so lässt sich dies auf besondere Art und Weise in ästhetischen Gestaltungsprozessen finden.
Dabei geht es nicht unbedingt um die Direktheit und Offenlegung des Gewesenen, sondern vielmehr um die emotionale Integration und Annahme dessen, was nicht ungeschehen gemacht werden kann. So bildet sich im bildnerischen Ausdruck eine Bildsprache heraus, die Schritte einer Verarbeitung aufzeigen, die versöhnlich wirken in der Transformation zu etwas Zukünftigen, ein Loslassen von der Beherrschung durch das Vergangene.
So verliert sich auch in den Bildern von Monika Auer die sprachliche Festschreibung, der Verweis auf das zu Enthüllende in den Metaphern zeichnerischer Verknüpfung. In der Hinsicht sprechen die Bilder unabhängig von dem persönlichen Geprägtem das Allgemein-Menschliche an.
Es beinhaltet eine Dekonstruktion des Erlebten, eine Überwindung von Grenzziehungen in der Vielschichtigkeit des projektiven Gehaltes im Bildnerischen.
In einer Abhandlung zu Cy Twombly hebt Roland Barthes die Linie, den Duktus im Sinne einer Schrift hervor bzw.:
(7) „Ob Leinwand, Papier oder Mauer: es handelt sich um einen Schauplatz, wo etwas daherkommt (…). So muss man das Bild als eine Art Theaternehmen: der Vorhang öffnet sich, wir schauen, wir warten, wir vernehmen, wir verstehen; und ist die Szene vorbei, das Bild verschwunden, dann erinnern wir uns. “
Bei Monika Auer handelt es sich um eine Art Spurensuche von der Destruktion, Fragmentierung hin zum Finden einer Formgestalt. Sie steht in Resonanz zu ihrem inneren Erleben, der Erinnerung an Vergangenes im Kontext von neuen Erfahrungen. Das Kontextuelle bildet die Bühne, auf der die Zeichen eines Neuanfangs auftauchen. Anders als in den Schriften, wo menschliche Beziehung auf das Begehren, das Sexuelle reduziert zu sein scheint, taucht in der bildlichen Metapher eine Zartheit und atmosphärische Zugänglichkeit im Menschlichen auf, das Worte nicht zum Ausdruck zu bringen vermögen.
Dieses Anderssein als das geschriebene Wort macht in dem Vorschein-Charakter das Bildliche aus. Dem Unausgesprochenen umgibt eine andere Dimension als dem Wort in dem Versuch des Erfassens von Handlungsmustern, denen man zu entfliehen versucht. Das menschliche Miteinander im gefühlsbestimmten bildnerischen Ausdruck rückt in den Vordergrund und verweist auf Integrationsprozesse in der schemenhaften Andeutung. Das macht diese Bilder interessant und hilft die biographische Aufarbeitung zu transformieren.
Es handelt sich um einen Zyklus von Bildern aus dem Zeitraum 2004 mit der existentiellen Aufarbeitung sexueller Missbrauchserfahrungen. Die Einbindung von Alltagsmaterialien, wie Zeitungspaper, von Honig, Zimt und Rotwein – in einigen der letzten Arbeiten, verweist auf eine sensorische, synästhetische Verarbeitungsform, in der die Anklage, die Depersonalisation einer Neuerfindung gewichen ist. Im ästhetischen Ausdruck verweist Monika Auer auf Resonanzbezüge zum Kosmischen, in dem das Weibliche eine überindividuelle Metapher erhält.
Ruth Hampe