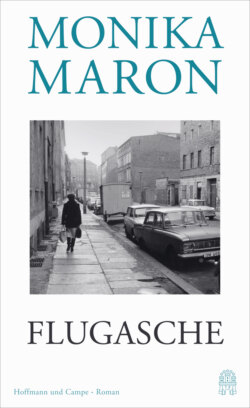Читать книгу Flugasche - Monika Maron - Страница 3
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ERSTER TEIL I.
ОглавлениеMeine Großmutter Josefa starb einen Monat vor meiner Geburt. Ihren Mann, den Großvater Pawel, hatte man ein Jahr zuvor in ein polnisches Kornfeld getrieben. Als der Großvater und die anderen Juden in der Mitte des Kornfeldes angekommen waren, hatte man es von allen Seiten angezündet. Meine Vorstellungen von der Großmutter Josefa sind nie zu trennen von einem langen Zopf, einem blauen Himmel, einer grünen Wiese, Zwillingen, einer Kuh und dem Vatikan. Auf dem Foto, das an einer Wand meines Zimmers hängt, wäscht die Großmutter ab in einer weißen Emailleschüssel mit einem schwarzen Rand. Am Hinterkopf der Großmutter hängt ein schwerer Dutt, der aus einem Zopf zusammengerollt ist. Die Großmutter ist untersetzt, hat kräftige Oberarme und schwarzes Haar.
Die Kindheit der Großmutter hat mir meine Mutter oft als mahnendes Beispiel ausgemalt, wenn ich mein Zimmer nicht aufräumen wollte oder Halsschmerzen simulierte, um nicht in die Schule gehen zu müssen. Deine Großmutter wäre froh gewesen, wenn sie in die Schule hätte gehen dürfen, sagte meine Mutter dann und erzählte die traurige Geschichte von der sechsjährigen Josefa, die nicht lesen und schreiben lernen durfte, weil sie die Zwillinge und die Kuh hüten musste. Ich gab zu, es besser zu haben als die Großmutter, die arm war und darum bis an ihr Lebensende mit drei Kreuzen unterschreiben musste. Nicht einmal mir selbst gestand ich, die arme Josefa zu beneiden. Aber ich muss sie beneidet haben, denn das Bild von dem beneidenswerten Bauernmädchen, das meine Phantasie mir malte, war bunt und fröhlich. Das Kind Josefa saß unter einem blauen Himmel auf einer grünen Wiese mit vielen Butterblumen. Eine magere Kuh kaute stumpfsinnig vor sich hin. Die Zwillinge lagen nebeneinander im Gras und schliefen. Josefa hatte ihren weiten gestreiften Rock über die Knie gezogen, sie spielte an ihrem langen Zopf und sprach mit der Kuh. Sie war barfuß und musste nicht in die Schule.
Später, als die Großmutter mit ihrem Mann aus Kurow bei Łódź nach Berlin gezogen war und vier Kinder geboren hatte, von denen meine Mutter das jüngste war, soll sie zu jedem Essen Sauerkraut gekocht haben, mit Speck, Zwiebeln und angebräuntem Mehl lange geschmort, bis es weich und bräunlich war. Noch heute lehnen meine Mutter und Tante Ida jede Zubereitung von Sauerkraut ab, die dem Rezept meiner Großmutter nicht absolut entspricht.
Warum mir im Zusammenhang mit der Großmutter immer das Wort Vatikan einfällt, weiß ich nicht genau. Die religiösen Verhältnisse der Familie waren für das ordentliche Preußen chaotisch. Der Großvater Jude, die Großmutter getaufte Katholikin, später einer Baptistensekte beigetreten, die Kinder Baptisten. Auf den Vatikan soll die Großmutter oft geschimpft haben. Sie soll, wenn auch Analphabetin, eine intelligente Frau gewesen sein.
Obwohl ich die Großmutter um ihre Kindheit auf der grünen Wiese beneidete und mit ihrer überlieferten Kochkunst sehr zufrieden war, beschloss ich an einem Tag gegen Ende meiner Kindheit, meine wesentlichen Charaktereigenschaften von ihrem Mann, dem Großvater Pawel, geerbt zu haben. Die Eltern meines Vaters zog ich für die genetische Zusammensetzung meiner Person nicht in Betracht. Er war ein biederer Pedell, sie eine biedere Zugehfrau. Beide hatten, soweit ich das aus Erzählungen schließen konnte, an erstrebenswerten Eigenschaften wenig zu bieten.
Im Wesen des Großvaters Pawel eröffneten sich mir eine Fülle charakterlicher Möglichkeiten, mit denen sich eine eigene Zukunft denken ließ und die zugleich geeignet waren, die Kritik an meinem Wesen auf das großväterliche Erbteil zu verweisen. Der Großvater war verträumt, nervös, spontan, jähzornig. Er stand nicht auf, wenn die Katze auf seinem Schoß saß, kochte jeden Morgen jedem seiner Kinder, was es zum Frühstück trinken wollte, Tee, Milch, Kaffee oder Kakao, und soll überhaupt ein bisschen verrückt gewesen sein. Meine Mutter sprach von der ewigen Unruhe des Großvaters, der mal nach Russland und mal nach Amerika auswandern wollte, was nur durch das rustikale Beharrungsvermögen der Großmutter Josefa verhindert wurde. Wenn der Großvater und die Großmutter sich stritten, drohte der Großvater, nun endgültig auf Wanderschaft zu gehen. Aber Mama packt mir ja nie die Wäsche, fügte er meistens hinzu, und blieb. Als er eines Tages wirklich gehen musste, ging er nicht freiwillig, und die Großmutter ging mit ihm. Davor aber blieb seine Lust zu wandern auf die Sonntage beschränkt. Sonntags setzte sich der Großvater auf sein Fahrrad und besuchte Freunde. Wenn es Sommer war und die Freunde einen Garten hatten, brachte er der Großmutter abends Blumen mit.
Die Verrücktheit des Großvaters war verlockend. Verrückte Menschen erschienen mir freier als normale. Sie entzogen sich der lästigen Bewertung durch die Mitmenschen, die es bald aufgaben, die Verrückten verstehen zu wollen. Die sind verrückt, sagten sie und ließen sie in Ruhe. Bald nach meinem Entschluss, die Verrücktheit des Großvaters geerbt zu haben, konnte ich schon die Symptome an mir beobachten, die ich aus den Erzählungen meiner Mutter und meiner Tante Ida kannte. Ich wurde unruhig, jähzornig, verträumt. Als ich das erste Mal hörte, wie Ida meiner Mutter zuflüsterte: »Das muss sie von Papa haben«, genoss ich meinen Erfolg.
Selbst die Armut, in der die Familie meiner Mutter gelebt hatte, erschien mir reizvoll. Es war eine andere Armut als die, von der mein Vater sprach, wenn er mir zum Geburtstag ein Fahrrad schenkte und dabei vorwurfsvoll erklärte, dass man zum zehnten Geburtstag eigentlich noch kein Fahrrad bekommen dürfe, weil man sonst ein verwöhntes Gör würde. Er habe sich sein Fahrrad erarbeiten müssen. Auch seinen Einsegnungsanzug habe er sich erarbeiten müssen. Zeitungen habe er austragen müssen, nach der Schule, und froh habe er sein müssen, weil er sein verdientes Geld nicht zu Hause habe abgeben müssen. Solche Reden konnte ich, ohne zu widersprechen, über mich ergehen lassen und ruhig auf den Einspruch meiner Mutter warten, der sich für gewöhnlich in einem ironischen Lächeln ankündigte, während sie meinem Vater noch zuhörte. Das verstehe sie nicht, begann sie scheinheilig, bei zwei Kindern, und Vater und Mutter hätten gearbeitet. Sie seien schließlich vier Kinder gewesen, der Vater Heimarbeiter für Konfektion, die Brüder arbeitslos. Aber sie hatte sich nichts selbst verdienen müssen als Kind und besaß mit zehn Jahren ein Fahrrad, ein altes zwar, aber ein Fahrrad, mit zwölf Jahren einen alten Fotoapparat, und als ihre Klasse in Skiurlaub fuhr und ihr die Ausrüstung fehlte, trieb ein Bruder Skier auf, der andere Stiefel, der Vater nähte nachts eine Hose, die Mutter trennte ihre Strickjacke auf und strickte einen Pullover. Die Brüder brachten sie zum Bahnhof und konstatierten zufrieden, dass ihre Schwester das hübscheste Mädchen in der Klasse war. Wir waren viel ärmer als ihr, sagte meine Mutter, aber wir waren keine Preußen.
Ohne zu wissen, was das Preußische an den Preußen eigentlich war, entwickelte ich eine ausgeprägte Verachtung für das Preußische, als dessen Gegenteil ich den Großvater Pawel ansah. Preußen waren nicht verrückt, das stand fest. Sie mussten ihre ersten Fahrräder selbst verdienen, wuschen sich den ganzen Tag die Hände und erfüllten ständig eine Pflicht. Preuße sein gefiel mir nicht. Da ich mich als genetische Alleinerbin des Großvaters fühlte, verdoppelte ich den Anteil jüdischen Blutes in mir und behauptete, eine Halbjüdin zu sein. Vierteljüdin klang nicht überzeugend. Bei jeder Gelegenheit verwies ich auf meine polnische Abstammung. Nicht, weil ich als Polin gelten wollte – ich kann mich nicht erinnern, jemals Stolz auf eine nationale Zugehörigkeit empfunden zu haben –, aber ich wollte keine Deutsche sein. Heute scheint mir, meine Abneigung gegen das Preußische gehörte zur Furcht vor dem Erwachsenwerden, das mich den geltenden Normen endgültig unterworfen hätte. Die Berufung auf meine Abstammung war die einfachste Möglichkeit, mich den drohenden Zwängen zu entziehen.
Der Großvater Pawel war tot, verbrannt in einem Kornfeld. Er gehörte mir. Er sagte, dachte und tat nichts, was mir nicht gefiel. Ich gab ihm alle Eigenschaften, die ich an einem Menschen für wichtig hielt. Der Großvater war klug, musisch, heiter, großmütig, ängstlich. Die Angst, die in ihm gelebt haben muss, war nicht zu leugnen, und es hat lange gedauert, ehe ich mich mit ihr abfinden konnte. Hätte ich nicht das Foto gefunden, das den Großvater vor einem kleinen Bauernhaus in Polen zeigt, wäre der Großvater für mich ein mutiger Mann geblieben. Auf dem Bild ist der Großvater mager und grauhaarig, den Mund verzieht er zu einem unsicheren Lächeln, die Augen blicken ängstlich und erschrocken. Das Bild wurde 1942 in dem Dorf aufgenommen, in dem die Großmutter Josefa geboren worden war und in dem der Großvater lebte, nachdem man ihn aus Deutschland ausgewiesen und bevor man ihn in ein Getto eingeliefert hatte. Die Angst des Großvaters bedrückte mich. Nachdem ich sie einmal entdeckt hatte, fand ich sie auch auf den älteren Bildern, die aus der Zeit in Berlin stammten, als der Großvater noch schneiderte und an den Sonntagen seine Freunde besuchte. Der skeptische, wachsame Blick und die Kopfhaltung, die auf fast allen Bildern die gleiche war und die den Eindruck erweckte, der Großvater wiche vor dem Betrachter des Bildes vorsichtig zurück. Als ich die Angst des Großvaters entdeckte, kannte ich selbst kaum eine andere Angst als die vor Mathematikarbeiten und dunklen Kellern. In den Büchern, die ich damals las, war auch mehr von Mut die Rede als von Angst, vom Mut der Widerstandskämpfer, der Neulanderoberer, der sowjetischen Partisanen. Angst war keine liebenswerte Eigenschaft, und ich versuchte sie zu unterdrücken, so gut ich konnte.
Später erkannte ich meine Verwandtschaft mit dem Großvater auch in der Angst. Als Mohnhaupt mich nicht in die Partei aufnehmen wollte, weil er, wie er sagte, befürchten müsste, von mir einen Schuss in den Rücken zu bekommen, hatte ich Angst vor ihm. Jeder Pförtner macht mir Angst, der mich angeifert, weil ein Blatt in meinem Personalausweis lose ist. Ich fürchte mich vor den alten Frauen, die mit ihren Krückstöcken die Kinder von den Wiesen jagen, damit ihre Hunde in Ruhe darauf scheißen können. Die Machtsucht primitiver Gemüter lässt mich zittern. Ich glaube, da der Großvater jähzornig war, muss auch auf seine Angst das Rauschen in den Ohren gefolgt sein, ein Rauschen, das den Kopf ausfüllt und alle Gedanken verdrängt außer dem Gedanken an die Angst. Die Angst wächst, wird größer als ich selbst, will aus mir hinaus. Sie bäumt sich und reckt sich, bis sie Wut ist und ich platze. Dann schreie ich den Pförtner an, bis er sich knurrend in sein Häuschen verzieht. Einer alten Vettel mit einem dicken Dackel habe ich sogar gedroht, sie zu verprügeln, falls sie nicht sofort das Kind losließe, das sie am Oberarm gepackt hielt. Und die andere Angst, die abgründige, die schwarze, die ein großes finsteres Loch um mich reißt, in dem ich schwerelos schwebe. Jeder Versuch, einen Halt zu finden, ist zwecklos. Was ich berühre, löst sich von dem, zu dem es gehört, und schwebt wie ich durch den Abgrund. Wenn ich an den Tod denke. Wenn ich den unfassbaren Sinn meines Lebens suche. Der Großvater fürchtete das Kornfeld, in das er getrieben wurde. Was habe ich zu befürchten? Das Bett, in dem ich sterben werde. Die Leben, die ich nicht lebe. Die Monotonie bis zum Verfall und danach.