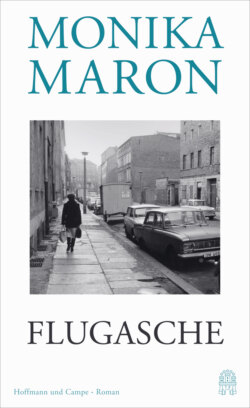Читать книгу Flugasche - Monika Maron - Страница 5
На сайте Литреса книга снята с продажи.
III.
ОглавлениеZum ersten Mal seit fünfzehn Jahren fürchte ich mich, an Christians Tür zu klopfen. Blödsinnig. Was ist denn passiert, wovor wir uns fürchten müssten? Wir waren uns ein Stückchen näher als sonst, unendlich näher. Nichts zum Fürchten also. Und trotzdem das beklemmende Gefühl: Es wird anders sein als vorher. Die Angst vor Erwartungen, seinen und meinen, vor einer neuen Verletzbarkeit, die vertraute Töne nicht mehr zulässt. Auch die eigene Unsicherheit, welchen Christian ich hier suche – den alten, zuverlässigen Freund oder diesen neuen Christian mit den warmen, kräftigen Händen.
Oder ich weiß es längst und gebe es nicht zu, weil ich enttäuscht werden könnte. Vielleicht ist es für Christian bei der einen Josefa geblieben, der geschlechtslosen lebenslänglichen Freundin, die ermutigt werden musste, als sie verzagt war, als sie fror, als Worte nicht ausreichten, als sie fühlen wollte, dass sie lebt. Es fällt schwer, sich selbst der Unredlichkeit zu verdächtigen. Aber ich komme nicht umhin, mich zu fragen, ob es mir nicht ordinär und einfach nur unerträglich wäre, nichts hinterlassen zu haben als die freundliche Erinnerung oder die Möglichkeit zu vergessen.
Manchmal erschrecke ich, wie wenig ich über mich weiß, wie perfekt der Selbstbetrug eingespielt ist, wie mühevoll nur Lüge und Wahrheit und Scham über die Lüge sich voneinander trennen lassen.
Wie verzweifelt beschwöre ich zuweilen noch ein ehrenhaftes Motiv, wenn ich mich längst durchschaut habe, wenn ich die Eitelkeit oder die Sucht zu gefallen schon aufgespürt habe in mir. Und will es doch nicht wahrhaben, suche nach einer annehmbaren Auslegung, heische um Verständnis bei mir selbst, ehe ich mich, wenn überhaupt, geschlagen gebe, in den eigenen Abgrund sehe und das Entsetzlichste finde: nicht anders zu sein als andere.
Aus Christians Wohnung klingt Musik, »… Why don’t we do it in the road …?«, ein Stockwerk tiefer geht eine Tür auf, es riecht nach Sauerkraut. »Aber häng die Wäsche nicht wieder auf Schreibers Leine, sonst regt die sich wieder uff«, ruft eine Frauenstimme. Irgendwer schlurft in Pantoffeln die Treppe rauf.
Ich klopfe.
Ehe Christian auch nur Guten Tag sagen kann, erzähle ich irgendwas von einem Stoffladen, in dem ich zufällig gerade war, ganz hier in der Nähe. Frage, ob ich störe, warte die Antwort nicht ab, weil ich keinen fremden Mantel an der Garderobe finde, schimpfe auf das langweilige Stoffangebot. Ich sehe, wie Christian lächelt. »Ist ja gut, hör doch mal auf zu reden«, sagt er und küsst mich auf die Wange, wie immer. Oder nicht wie immer. Er schiebt die Zigaretten über den Tisch.
»Tee oder Kaffee?«
»Schnaps.«
»Was macht deine Reportage?«
»Du hast es geschafft, ich bin bei Variante eins.«
Christian rutscht ein Stück tiefer in seinen Sessel, schlägt die Beine übereinander, die grauen Kieselaugen leuchten, nur einen Moment und nicht triumphierend, nur froh. Er sieht müde aus. Solange wir uns kennen, war Christian der Vernünftigere, der immer um ein paar Jahre erwachsener war als ich. Ich war daran gewöhnt, ihm den größten Teil der Verantwortung für unsere Freundschaft zu überlassen. Hin und wieder hatte ich ein schlechtes Gewissen, weil ich wusste, dass Christian sich nicht wehren würde, auch wenn ich ihn überforderte. Aber ich nahm ihn an als etwas Sicheres, Schönes, das es für mich auf der Welt gab. Vergleichbar mit einer Mutter oder einem großen Bruder. Zu Beginn unserer Freundschaft ging dieses Gefühl der Geborgenheit nur mittelbar von Christian aus. Mich faszinierte die intellektuelle, kultivierte Atmosphäre des Grellmann’schen Haushalts. Und ich verehrte Christians Vater, ein Gefühl, das ich für Werner Grellmann bis heute empfinde. Als ich ihn kennenlernte, war er vierzig Jahre alt. In meiner Erinnerung hat er sich seither wenig verändert. Damals erschien mir ein Vierzigjähriger älter als heute ein Fünfundfünfzigjähriger, da ich das Altern als eigene Perspektive noch nicht in Erwägung zog.
Das war gegen Ende der fünfziger Jahre. Zwei Jahre zuvor noch hielt Professor Werner Grellmann an der Philosophischen Fakultät Vorlesungen, die immer überfüllt waren, obwohl der größte Teil der Studenten nur die Hälfte verstand, wenn der Marxist Grellmann Sartre und Kierkegaard sezierte, mit der eleganten Grobheit des sicheren Chirurgen, aber nicht ohne den unabdingbaren Respekt des Wissenschaftlers vor der fremden Denkleistung.
Es war wohl der gleiche Respekt vor den Gedanken anderer, der ihn bewog, als Einziger nicht seinen Arm zu heben, als der Ausschluss eines jungen Genossen beschlossen wurde, der infolge ständiger Lektüre westlicher dekadenter Literatur erhebliche ideologische Schwächen gezeigt haben sollte. Werner Grellmann wurde deshalb nicht aus der Partei ausgeschlossen, aber die Fähigkeit, junge Wissenschaftler zu erziehen, sprach man ihm ab. Er avancierte vom Professor für Philosophie zum Bürgermeister von Wetzin, einem schlammigen Dorf im Oderbruch, aus dem er ein Musterdorf machen sollte. Seine Frau und die drei Söhne, Christian war der älteste, blieben in Berlin. Ruth Grellmann unterbrach die Arbeit an ihrer Dissertation und ernährte die Familie von Schreibarbeiten, denn die fünfhundert Mark, die Werner Grellmann als Bürgermeister verdiente, reichten nicht aus für zwei Haushalte.
Ich versuche mich zu erinnern, ob damals, als ich Werner Grellmann kennenlernte, Spuren von Bitternis an ihm zu finden waren. Ich glaube nicht. Auch in den Bildern aus jener Zeit trägt er für mich die weisen clownesken Züge in dem feinen, sensiblen Gesicht mit den grauen Augen.
An einem der Wochenenden, die ich bei den Grellmanns verbrachte, erzählte uns Werner Grellmann, wie er die Dorfstraße von Wetzin pflastern ließ. Wir saßen um den großen runden Tisch auf alten hochlehnigen Lederstühlen. Es war ein nasskalter Tag kurz vor Weihnachten, das einzige Licht im Zimmer verbreitete der Chanukkaleuchter, der auf dem kleinen Bücherregal rechts neben der Tür stand. Den Leuchter hatte Ruth Grellmann, die vor ihrer Hochzeit Ruth Katzenheimer hieß, als Einziges in die Ehe eingebracht. Werner Grellmann, der keine Weihnachtsbäume duldete, dem alles zutiefst fragwürdig war, das auf irgendeiner Art von Gläubigkeit beruhte, der die schmalen Augenbrauen skeptisch hochzog, sobald sein Gesprächspartner das Wort Glauben bemühte, Werner Grellmann hing an diesem Leuchter auf mir bis heute unerklärliche, fast mystische Weise.
Ruth brühte die dritte oder vierte Kanne Tee, während Werner Grellmann Christian und mir die Geschichte vom Straßenbau in Wetzin erzählte. Im Frühjahr hatte er gesehen, wie seine Wetziner Mühe hatten, ihre Stiefel und Fahrräder aus dem Schlamm zu ziehen, in den tagelanger Regen die Wetziner Dorfstraße verwandelt hatte. Zwar war die Fahrbahn mit grobem Kopfstein gepflastert, aber die Bürgersteige waren nichts als festgetretener Lehmboden, auf dem das Wasser nach heftigen Regengüssen noch tagelang stand. Werner Grellmann, ein leidenschaftlicher Fußgänger und Radfahrer, vor allem aber immer auf die Rechte der Mehrheit bedacht, beschloss: Die Wetziner Bürgersteige werden gepflastert. Ihm fehlte nur das nötige Geld. Zufällig, erzählte er uns, sei er einige Tage nach diesem Entschluss, der das öffentliche Leben Wetzins einschneidend verändern sollte, über den Dorffriedhof gegangen. Ich war sicher, dass dieser Spaziergang auf dem Friedhof kein Zufall war. Werner Grellmann verabscheut Friedhöfe ebenso wie Weihnachtsbäume und verblüffte uns einmal, als wir Friedhofsidylle gegen seine spöttischen pietätlosen Attacken verteidigt hatten, mit der Frage, wo sich eigentlich das Grab von Friedrich Engels befände. In London, vermuteten wir. Und Werner Grellmann lachte vergnügt und listig, blies mit spitzem Mund etwas Imaginäres von seiner Handfläche und sagte: »Da ist es. Im Wind.« Ich bin also sicher, er ist nicht zufällig über den Friedhof gegangen, sondern hat gewusst, was er dort suchte, und hat es auch gefunden. Er hatte auf das ländliche Traditionsbewusstsein und die bäuerische Trägheit spekuliert, die er in Gestalt kostbarer uralter Marmorsteine auf dem Wetziner Friedhof fand. Das Recht auf Grabstätten verjährt nach dreißig Jahren, erfuhr Werner Grellmann von dem Finanzverantwortlichen des Dorfes, einem schlauen, mit allen Wetziner Regenwassern gewaschenen Mann. Mit seiner nächsten Maßnahme setzte Werner Grellmann auf den Geiz seiner Wetziner, die seit eh und je arme Leute waren. Er veröffentlichte eine Annonce in der Kreiszeitung: »Wer Anspruch erhebt auf den Fortbestand der Ruhestätten seiner Anverwandten, zahlt bitte bis zum Letzten des Monats die Miete für die nächsten dreißig Jahre. Anderenfalls wird die Grabstätte eingeebnet. Für den Abtransport der Steine sind die Verwandten verantwortlich. Kommen diese ihren Pflichten nicht nach, sieht sich die Gemeinde gezwungen, die Abfuhr der Steine selbst vorzunehmen. Unterschrift: Der Bürgermeister.« Wenn der Bürgermeister die Steine nicht haben will, dann soll er sie man auch selbst wegschleppen, werden die Bauern gedacht haben, und Werner Grellmann unternahm einen zweiten Spaziergang über den Friedhof, diesmal in Begleitung des Steinmetzes, der den Wert der Steine schätzen sollte. Mit der Schätzsumme des Wetziner Steinmetzes fuhr der ungläubige Werner Grellmann in die Bezirkshauptstadt, lud auch den dort ansässigen Steinmetz zu einem Friedhofsspaziergang ein. Der verdoppelte das Angebot. Diese Summe teilte Werner Grellmann nun wieder dem Wetziner Steinmetz mit, und ich weiß heute nicht mehr, wie viele Steinmetze er noch über den Friedhof führte, ehe ihm das Gebot ausreichend erschien. Wetzin jedenfalls bekam gepflasterte Bürgersteige, die für mich inzwischen zum Inbegriff nützlicher, wahrhaft atheistischer Denkmäler geworden sind. – Dieser trübe vorweihnachtliche Nachmittag bei Grellmanns ist mir deutlicher in Erinnerung als alle anderen. An dem Tag wurde mir bewusst, dass ich Christian um seine Familie beneidete, wenn sich dieses Gefühl auch mischte mit der Dankbarkeit, teilhaben zu dürfen an einer Gemeinsamkeit, die mehr war als bloßer Familiensinn, wie ich ihn kannte.
Später, als Werner Grellmann wieder wissenschaftlich arbeiten durfte, zog die Familie nach Halle. Seitdem habe ich Werner und Ruth Grellmann nur einmal wiedergesehen. Aber die Freundschaft zu Christian blieb immer verbunden mit dem Gefühl intellektueller Geborgenheit, das ich im Haus seiner Eltern kennengelernt hatte.
Christian schweigt. Er spielt mit einem Blatt Papier, faltet es kunstvoll, glättet es wieder, zerknüllt es langsam. Nein, es ist nicht wie vorher, und es ist auch nicht anders. Nur beklemmende Unsicherheit statt unbekümmerter Vertrautheit. Vielleicht würde ein Satz ausreichen, um den alten Ton wiederzufinden; oder einen neuen. »Bleibst du hier?« Christian sieht mich an, blass und müde, graue Augen unter schmalen Brauen, kein Funken von Spott darin.
Ich fürchte, was immer ich antworte, ist falsch. Was suche ich hier und wen? Plötzlich ist Nähe wieder unvorstellbar, trotzdem der Wunsch zu bleiben, hier zu bleiben, wo ich bekannt bin, wo ich mich nicht immer aufs Neue erklären muss. Dann wieder die Angst, ein Vierbeiner zu sein, der Gedanke an den Milchautomorgen, an die Abende mit Werner Grellmann, wenn er seine Wetziner Geschichten erzählte, Kindheitserinnerungen, Christian, mein Bruder.
»Nein, ich weiß nicht, heute nicht.«
Ich will nach Hause.
Die Platzordnung während der Redaktionssitzungen wird streng eingehalten, und obwohl ich zu spät komme, ist mein Platz neben Luise noch frei. Rechts von ihr sitzt Günter Rassow, ein hagerer, kränklicher Mann, der, obwohl erst etwas über vierzig, in der gebeugten Haltung eines Greises läuft, wobei er sich mittels kleiner tapsiger Schritte vorwärtsbewegt, so, als würde er jeweils von einem Fuß auf den anderen fallen. Hin und wieder verfügt er über den skurrilen Humor eines alten Engländers. Während die dicke Elli Meseke sich mit mütterlicher Stimme gerade müht, die neueste Ausgabe der Illustrierten Woche einzuschätzen, schiebt Günter Rassow Luise die Zeitung zu, in der er mit Rotstift zwei Zeilen unterstrichen hat. »Hast du das gelesen?«, fragt er leise, die Empörung in der Stimme nur mühsam gedämpft. ›Wie Frankfurter Eisenbahner dem Frost das Spiel versalzen‹, stand da. Günter leidet unter solchem Missbrauch der Sprache fast physisch. Siegfried Strutzer als einziger Vertreter der Chefredaktion sitzt am Präsidiumstisch und klopft energisch mit dem Bleistift auf den Tisch. Luise senkt ihr grauhaariges Haupt schuldbewusst wie ein Schulmädchen, das beim Schwatzen ertappt wurde. »Wo ist Rudi?« – »Rudi hat Zahnweh, der kommt nicht«, flüstert Luise und verzieht dabei ihr Gesicht, als müsste sie ein lautes Lachen unterdrücken.
Rudi Goldammers Wehleidigkeit ist bekannt, wird von den meisten belächelt, aber kaum verübelt. Als ich Rudi Goldammers Geschichte erfuhr, konnte ich mir kaum vorstellen, wie dieser zierliche Mann mit dem weichen Gesicht, das durch die traurigen Augen und den vergrämten Zug um den Mund bestimmt wird, elf Jahre Konzentrationslager überstanden hatte. Er war neunzehn, als er verhaftet wurde, und als er mit dreißig wieder nach Hause kam, hatte er ein schwaches Herz, einen kranken Magen und konnte keine Nacht mehr schlafen. Mit siebzehn hatte er sich in ein Mädchen verliebt, das er aus der Arbeitersportbewegung kannte. Zwei Jahre nach seiner Verhaftung heiratete sie einen SA-Mann, nach dem Krieg ließ sie sich scheiden, kam mit ihrer Tochter zu Rudi Goldammer, und Rudi, der, als wäre er plötzlich erwacht, mit naivem Staunen seine Jugend suchte, die er hinter Stacheldraht verloren hatte, heiratete sie. Es ist eine merkwürdig schweigsame Ehe geworden, und Luise, die Rudi Goldammer zuweilen besucht, spricht von der Frau nie ohne eine Spur von mitleidigem Abscheu.
Rudi hat sich über die Katastrophen seines Lebens hinweg ein feinfühliges Verständnis für andere bewahrt und eine Güte, die die Grenze zur Schwäche oft überschreitet. Als wäre das Maß an Schmerz und Bösem voll, das er in seinem Leben zu ertragen fähig war, war er außerstande, Schmerzen oder Böses zuzufügen. Alles Gründe, Rudi zu lieben, für den Chefredakteur der Illustrierten Woche aber verhängnisvolle Eigenschaften, deren Konsequenzen Rudi Goldammer sich immer wieder durch Magenkrämpfe oder Zahnweh entzieht.
Dumpfes Geraune quillt aus der versammelten Runde. Offenbar ist man nicht einverstanden mit Elli Mesekes zufriedener Feststellung, die Kolumne sei diesmal besonders leserfreundlich, der Illustrierten Woche gemäß, und sie stehe uns gut zu Gesicht – stereotype Floskeln, die mit Sicherheit auf jeder Sitzung zu hören sind. Es erstaunt mich immer wieder, wie ein Mensch sie noch aussprechen kann, ohne zu lachen, wenigstens zu lächeln.
»Zur Diskussion später.« Siegfried Strutzer lässt seinen Bleistift klopfen. Sooft Rudi Goldammer unter Zahnweh oder Magenschmerzen leidet, amtiert Siegfried Strutzer, und fast immer zieht er dann ins Zimmer des Chefredakteurs. Angeblich, weil das Telefon besetzt sein muss. Eine scheinheilige Ausrede, denn die Anschlüsse von Rudi und Siegfried Strutzer laufen über dasselbe Sekretariat, und seinen direkten Apparat benutzt Rudi ausschließlich für private Gespräche.
»Pass auf, jetzt bist du dran«, flüstert Luise.
»… Reportage von Josefa Nadler«, höre ich Elli Mesekes mütterliche Stimme und zucke zusammen wie immer, wenn mein Name öffentlich genannt wird, ein eingeschliffenes Gefühl aus der Schulzeit, wo ich gelernt habe, vor meinem eigenen Namen zu erschrecken. Josefa Nadler, schwatz nicht! Josefa Nadler, kipple nicht mit dem Stuhl! … Josefa Nadler, warum kommst du zu spät!
»Josefa Nadler gibt mit ihrem Beitrag über das Berliner Stadtzentrum eine treffende Schilderung hauptstädtischer Atmosphäre«, sagt Elli Meseke und unterstreicht die Bedeutung ihrer Worte, indem sie langsam und gedehnt spricht, als müsste sie jedes einzelne Wort erst suchen. Sie habe sich gefreut über den herzerfrischenden Realismus, sagt Elli, obwohl – aha, jetzt kommt’s, hätte mich auch sehr gewundert – obwohl, das müsse sie der Wahrheit halber doch sagen, der Realismus manchmal etwas sehr weit gehe. Luise grinst mich mit schiefem Mundwinkel an und rollt die Augen.
»Ich denke da an die Sache mit dem Tunnel und ähnliche Anspielungen. Ich meine, das geht zu weit«, sagt Elli mit der milden Strenge einer Unterstufenlehrerin.
Ich hatte einen Beitrag über den Alex geschrieben und darin meinen Ärger über die zugigen, tristen Fußgängertunnel auf zehn Zeilen ausgebreitet, harmlos, ich hatte freiwillig darauf verzichtet, unsere Zukunft unter den gepanzerten Städten auszumalen, obwohl ich meine Visionen, die sich zeigten, sobald ich die Augen schloss und meiner Phantasie das Thema Städte und Autos in Auftrag gab, für durchaus mitteilenswert hielt. Auf der Erde dreistöckige Straßenzüge, in kunstvoller Statik über- und untereinander geleitet, Serpentinen um Hochhäuser, Parkplätze auf Korridoren, Autoschleusen, Autolifts, in den Fenstern der alten Häuser Luftfilter statt der Glasscheiben, die neuen Häuser fensterlos, an den Fahrbahnrändern auf den Balustraden aus Beton in hohen Steintöpfen kümmerliche Bäumchen, die jede Woche ausgewechselt werden, länger leben sie nicht. Auf den achtspurigen Fahrbahnen käferförmige Einmannautos mit Hängevorrichtung für ein Kind, ein neues Modell, das entwickelt wurde, um die katastrophale Parkplatzlage zu mildern. Die Statistik wies in den letzten beiden Jahren einen sprunghaften Anstieg der Tötungsdelikte aufgrund von Parkplatzstreitigkeiten auf. Außer den Einsitzern die alten Viersitzer, die nur noch zu offiziellen Zwecken und als Taxen benutzt werden. Kinder dürfen ausschließlich in Autos mit leuchtend roter Warnfarbe fahren. Kindern unter acht Jahren ist das selbstständige Führen eines Pkw gänzlich untersagt. Unter der Erde die Fußgängerkatakomben. Die Wände sonnengelb, die Decken himmelblau, der Fußboden grasgrün, es riecht nach Farbe. Überall Hinweisschilder auf Ausstiege, Geschäftstunnel, Arztpraxen, Großgaststätten, die auf allen ehemaligen U-Bahnhöfen eingerichtet wurden. Kinder toben in Spielzeugautos durch die Gänge, die kleinen Kinder haben Tretautos, die größeren fahren batteriebetriebene. Die Erwachsenen laufen langsam, sehr langsam, sie kriechen fast, manche tragen Stützschienen, andere stützen sich auf Krücken, viele haben krumme Rücken und muskellose hängende Bäuche. Alle hundert Meter ein Lift, der in eins der Parkhäuser führt. An einer gelben Wand steht in roter Farbe eine hastig gemalte Losung: Wir fordern ein öffentliches Verkehrsmittel!
Elli lächelt mir milde zu. »Josefa, sicher wären Rolltreppen schöner. Aber ob in diesem Zusammenhang wirklich von einer inhumanen Konzeption gesprochen werden kann?«
Rolltreppen, wer spricht von Rolltreppen. Da krauchen Menschen wie durch Madengänge von einer Straßenseite auf die andere, damit sie den Autos nicht vor den teuren Gürtelreifen herumspringen, und Elli Meseke will nur darüber nachdenken, wie man sie bequemer in ihre Kriechtunnel befördern kann.
Luise murmelt vor sich hin: »Die mit ihrem dicken Hintern kann ja ruhig Treppen steigen.«
Die »inhumane Konzeption« hat Luise schon ein knappes und denkwürdiges Telefongespräch eingebracht, obwohl Gespräch nicht die richtige Bezeichnung ist für einen Vorgang, der im Reden des einen und im Zuhören des anderen besteht.
Ich war gerade in Luises Zimmer, als das Telefon klingelte.
»Bezirksleitung«, zischelte Luise mir zu. Ein Ausdruck gespannter Konzentration breitete sich auf ihrem Gesicht aus und grub die Falten und Fältchen um eine Spur deutlicher in die Haut. »Am Apparat«, sagte sie.
Von der anderen Seite hörte ich nichts, offenbar sprach der Genosse oder die Genossin leise. Dafür lange. Ich beobachtete Luises Gesicht, in dem die Spannung langsam von einem renitenten Lächeln verdrängt wurde.
»Ist gut, Genosse … ist gut, wir werden darüber nachdenken.«
Sie legte den Hörer langsam mit spitzen Fingern auf die Gabel, drehte sich mit dem schwarzen Kunstledersessel auf dem metallenen Hühnerbein zu mir und sagte, breit lächelnd: »Der Genosse Kunze empört sich über deine inhumanen Tunnel.«
»Ich hab sie doch nicht gebaut.«
»Reg dich bloß nicht auf«, sagte Luise wie zu ihrer eigenen Beruhigung, »es ist gedruckt, das ist die Hauptsache.«
Luise kann rechnen wie eine Geschäftsfrau. Sie prüft genau, was eine Sache einbringt, wägt die Gewinnchancen, kalkuliert das Risiko, sichert den Ausgleich, vorher. Für die nächste Woche hat sie ein Interview mit dem Stadtarchitekten einer Bezirksstadt eingeplant, das den aufgeregten Genossen Kunze gewiss besänftigen und von unserer Einsicht überzeugen wird.
Luise holte eine Zellophantüte mit Lakritze aus ihrer Handtasche, steckte sich, nachdem sie es liebevoll betrachtet hatte, ein Stück in den Mund und reichte mir die Tüte hin, eine besondere Gunst, denn mit ihrer Lakritze ist Luise geizig.
Elli Meseke erklärt versöhnlich, sie halte meine Arbeit trotz dieser Einschränkung für sehr gelungen, und Luise sagt leise: »Na siehste.«
Das konnte heißen: Na siehste, jetzt haben wir’s hinter uns; oder: na siehste, es geht doch, man muss sich nur traun; oder: na siehste, so schlimm ist die Dicke doch gar nicht … Weiß der Teufel, was sich hinter Luises Nasiehste alles verbergen kann. In jedem Fall aber ist sie zufrieden.
Es war ja auch nur ein kleiner Seufzer, den ich über die Unterwelt der Fußgänger ausgestoßen hatte. Stell dir vor, Luise, ich hätte von meiner Begegnung mit dem Heizer Hodriwitzka aus B. berichtet. Aber davon habe ich bisher nicht einmal dir etwas erzählt, nur Christian. Der hat gelacht und gefragt, ob ich wirklich sicher sei, die Prinzipien der sozialistischen Demokratie richtig verstanden zu haben.
Der Heizer Hodriwitzka aus B. ist ein kleiner, breitschultriger Mann, der auf den ersten Blick viereckig aussieht. Der gedrungene, massige Körper, der große kantige Schädel auf dem breitnackigen Hals, selbst die Hände mit den kurzen Fingern wirken viereckig. Umso mehr verwundern dich die weichen Linien in seinem runden Gesicht. Freundliche, naive Augen, die er nie zusammenkneift, wenn er dich ansieht, eine kleine, knollige Nase, breite, nicht lange Lippen. Er ist über vierzig, aber du kannst dir genau vorstellen, wie er als Kind ausgesehen hat, als er mit seinen Eltern noch in den Sudeten lebte. Ich lernte den Heizer Hodriwitzka kennen, als der leitende Ingenieur mich durch das Kraftwerk führte. Wir hatten ihn auf unserem Rundgang nicht getroffen, aber der Ingenieur meinte, wenn ich den Hodriwitzka nicht kenne, kann ich nicht verstehen, warum das Kraftwerk noch nicht zusammengebrochen ist. Ich hielt diese Floskel für einen mageren Scherz des leitenden Ingenieurs. Ich konnte nicht verhindern, dass der Ingenieur den Hodriwitzka telefonisch suchen und in sein Büro bestellen ließ. Es war mir peinlich, weil er ihn vorlud, als wäre ich ein Vorgesetzter oder eine Amtsperson und als wollte der Heizer Hodriwitzka mit mir sprechen und nicht ich mit ihm. Nach fünf Minuten kam er, Gesicht und Hände schwarz von der grubenfeuchten Kohle, die hier verheizt wurde. Er wischte die rechte Hand an seiner dunkelblauen Montur ab, ehe er sie mir mit entschuldigendem Lächeln reichte. Plötzlich, Luise, sah ich auf meine rechte Hand. Im gleichen Moment hätte ich unsichtbar sein wollen vor Scham. Heimlich, wie zufällig, hatte ich einen Blick auf meine rechte Hand geworfen. Nicht, weil ich mich vor dem Dreck geekelt hätte. Das war frischer, sauberer Kohlendreck, nicht der unsichtbare Staub auf einer schwitzigen Bürohand. Nein, mehr aus Neugier guckte ich, ob der Händedruck des Heizers Hodriwitzka seine Spuren hinterlassen hatte. Ich versuchte, die Geste zu kaschieren, indem ich mich an dem Ärmel meiner Bluse zu schaffen machte, sagte irgendeinen Blödsinn von zu engem Bund, spürte, wie mein Gesicht eine andere Färbung annahm. Hodriwitzka hatte seine schwarzen rissigen Hände auf den Schreibtisch gelegt. Er nahm sie zögernd wieder weg und hielt sich an den Kanten seines Stuhls fest, sodass die Hände nicht mehr zu sehen waren.
»Also, Kollege Hodriwitzka«, sagte der Ingenieur, der von unserer Verlegenheit nichts zu bemerken schien, »das ist eine Kollegin von der Illustrierten Woche aus Berlin. Und wir haben Sie hergebeten, damit Sie der Kollegin von der Zeitung etwas über Ihre Arbeit hier im Kraftwerk erzählen. Nicht schöngefärbt. So, wie es ist.«
»Dreckig ist’s«, sagte Hodriwitzka und lächelte mich aus seinen blanken braunen Augen an.
Was sollte ich ihn fragen, Luise. Mir reichte, was ich gesehen hatte, uralte Anlagen, zugige Hallen, schwere, schmutzige Arbeit, gebeugte Männer in den Aschekammern, in denen nur Zwerge hätten stehen können, Frauen mit fünf Meter langen Feuerhaken vor den Öfen. Was hätte ich den Heizer Hodriwitzka fragen können?
»Wohnen Sie gern in B.?«, fragte ich.
Hodriwitzka saß verkrampft und plump auf seinem Stuhl, zuckte mit den Schultern, lächelte hilflos. Er sah mich an wie ein höflicher Chinese, mit dem man türkisch sprechen wollte. Ich hatte ihm wohl eine bemerkenswert dumme Frage gestellt.
Was kann ein Mensch auf diese einfältige Journalistenfrage schon antworten? Was könnte ich sagen auf die Frage, ob ich gern in diesem Land lebe.
»Wir haben gerade das Häuschen von den Schwiegereltern geerbt«, sagte Hodriwitzka, und damit schien für ihn die Frage, ob er gern oder ungern in B. lebe, beantwortet zu sein.
Und dann, Luise, hatte ich genug von dem peinlichen abgekarteten Arbeiter-Journalisten-Spiel. Der eine weiß, was der andere fragen wird, und der andere weiß, was der eine antworten wird, und der eine weiß, dass der andere weiß, dass der eine weiß.
Diese verkrampfte sinnlose Zirkusvorstellung, in der man sich gegenseitig begafft wie durch Gitter und jeder vom anderen denkt, der stünde im Käfig.
»Warum wehren Sie sich nicht?«, fragte ich, »Sie sind doch schließlich die herrschende Klasse.«
Für Hodriwitzka, der nichts ahnen konnte von meinem spontanen inneren Protest gegen die Journalistenrolle, in der ich mich befand, kam die Frage unvermittelt. Er sah überrascht auf. »Wehren? Wogegen?«
»Gegen das alte Kraftwerk. Warum fordern Sie nicht die Stilllegung?«
Der Ausdruck in Hodriwitzkas runden braunen Augen schwankte zwischen Unglauben, Belustigung und Interesse. »Das muss schon der Generaldirektor machen. Der soll wohl sogar schon einen Brief geschrieben haben«, sagte er und blickte sich dabei nach dem Ingenieur um, der schräg hinter ihm stand, an einen Schrank gelehnt, und die Auskunft durch Kopfnicken bestätigte.
»Ich bin hier nur ein kleines Licht«, fügte Hodriwitzka hinzu, nicht böse oder verbittert; eine Feststellung, bescheiden und sachlich. Aber zum Kombinat gehören tausend Kraftwerker. Du musst nicht erschrecken, Luise, ich wollte ihn nicht zum Streik aufrufen. Aber Hodriwitzkas Gelassenheit provozierte mich und regte mich auf. Später erst begriff ich, wie wenig dieser scheinbare Gleichmut mit Gelassenheit zu tun hatte. »Und wie meinen Sie denn, dass so ein Protest aussehen müsste?«, fragte Hodriwitzka lächelnd.
Sie müssten eine Erklärung verlangen, sagte ich, warum sie weiter in einem unsicheren, dreckspuckenden Kraftwerk arbeiten sollten, wenn ein neues gebaut wird. Und wenn der Betriebsleiter nicht antworten kann, müssten sie den Generaldirektor fragen. Und wenn der auch nichts weiß, sollten sie den Minister einladen, hierher, nach B.
Hodriwitzka rückte mit seinem Stuhl dichter an den Schreibtisch und stützte den Kopf in seine schwarzen Hände. »Man weiß ja nun nicht, was da alles reinspielt«, sagte er nachdenklich. »Wenn sie nicht stilllegen, werden sie wohl nicht können. Mit Absicht werden sie uns ja nicht im Dreck sitzen lassen.«
»Aber erklären muss man es Ihnen«, redete ich auf ihn ein, »das müssen Sie verlangen. Verstehen Sie doch, das ist nichts Verbotenes, mit Streik hat das nichts zu tun. Im Gegenteil: Sie verderben sonst die ganze Demokratie.«
Hodriwitzka musste lachen, und ich beteuerte ihm, wie ernst das sei. Seinen Generaldirektor könne der Minister mit ein paar Sätzen zur Ordnung und Disziplin rufen, ein Telefonat oder ein Brief, und dann ist Ruhe. Was soll ein Generaldirektor schon machen, wenn er Generaldirektor bleiben will. »Und was müssen Sie machen, wenn Sie Kraftwerker bleiben wollen?«, fragte ich Hodriwitzka. Ich hatte erwartet, er würde auf diese Frage ironisch reagieren, auf seine Dummheit anspielen, in einer solchen Bruchbude überhaupt seine Haut zu Markte zu tragen. Aber er sah mich aufmerksam an, fast verwundert, und sagte leise: »Ich muss ja hierbleiben. Die finden ja keinen für die Arbeit. Ist ja sowieso jeder vierte Arbeitsplatz unbesetzt.«
»Denken Sie, der Minister weiß das nicht? Und glauben Sie, er würde es wagen, nicht zu kommen, wenn tausend Kraftwerker aus B. mit ihm über ihre Zukunft sprechen wollen?«
Hodriwitzka antwortete nicht. Er sah verlegen auf seine Hände, hob plötzlich den Kopf, sagte mehr zu sich selbst als zu mir: »Ohne das Kraftwerk läuft ja keine Anlage, im ganzen Werk nicht.« Dann lachte er kurz auf, schüttelte seinen eckigen Kopf, meinte, noch halb ungläubig: »Vielleicht würde er wirklich kommen, wer weiß.« Diese Vorstellung schien ihn zu amüsieren. Vielleicht sah er in Gedanken alle Kraftwerker im großen Kulturraum sitzen, in blauen Monturen, mit schmutzigen Händen und Gesichtern, wie man eben aussieht, wenn man seinen Arbeitsplatz für eine Stunde oder zwei verlässt. Der Minister würde in seinem großen schwarzen Auto vorfahren, würde nicht im Präsidium Platz nehmen, denn sie hätten keins aufgebaut. Er würde an einem der Tische sitzen wie sie alle und ihre Fragen beantworten. Die Einschätzung der weltpolitischen Lage könnte der Minister sich diesmal sparen, die Würdigung der Erfolge auch. Er sollte ihnen nur erklären, welche Havarie in der staatlichen Planung verhinderte, ihr altes unsicheres Kraftwerk stillzulegen. Falls der Minister einen triftigen Grund nennen könnte, wollten sie mit sich reden lassen. Von Energieversorgung verstanden sie was, er würde ihnen nichts vormachen können.
Hodriwitzkas Wangen röteten sich, die Augen glänzten, wodurch er noch kindlicher aussah. »Aber es kann sich doch nicht einfach einer von uns hinsetzen und an den Minister schreiben«, sagte er. Ich wusste auch nicht, wie Hodriwitzka es machen sollte, was ich ihm in meiner Wut über diese dreckige Stadt vorgeschlagen hatte, ohne dass er konterrevolutionärer Umtriebe verdächtigt wurde. Ich war nur überzeugt, es musste möglich sein. Also sagte ich, diese Einladung an den Minister müsse die Gewerkschaft schicken.
»Ach so«, sagte Hodriwitzka ernüchtert. Du hättest seinem Gesicht ansehen können, wie er den Platz im großen Kulturraum ohne Präsidium verließ und sich auf dem nackten Bürostuhl im Zimmer des Ingenieurs wiederfand. »Ach so«, sagte er noch einmal, »na, dann wirds nichts. Unser Vertrauensmann traut sich nichts.«
Es war das alte Lied. Sie wählen den Dümmsten oder den Feigsten, weil der sich wählen lässt, und später, wenn der ein dummer oder feiger Vertrauensmann geworden ist, schimpfen sie auf die Gewerkschaftsfunktionäre, die alle dumm oder feige sind.
Warum sie ihn gewählt hätten, fragte ich.
»Der andere wollte nicht mehr«, sagte Hodriwitzka. Sie hätten einen gehabt, einen Rothaarigen mit Sommersprossen. »Der war ein richtiger Anarchist«, meinte Hodriwitzka. »Der hat was geschafft, warmes Essen in der Nacht, renovierte Waschräume und Garderoben. Aber dem haben sie ewig was am Zeuge zu flicken gehabt. Bis er die Nase voll hatte.«
Hodriwitzka sah auf die Uhr. Er müsse nun gehen, sagte er, stand langsam auf, rückte seinen Stuhl ordentlich an den Schreibtisch, stand unschlüssig im Raum. »Tja, dann werd ich mal.« Jetzt hat er genug von meinen Volksreden, dachte ich. Ich fühlte mich lächerlich. Was hatte ich mir eigentlich gedacht, kam aus meinem vollklimatisierten Großraum in diese Höhle und wollte den Leuten beibringen, wie sie zu leben haben. »Sonst verderben Sie die ganze Demokratie!« Dümmer ging es nicht. Als würden Hodriwitzka oder sein rothaariger Anarchist die Demokratie verderben. Hätte ich mich bloß nicht wie ein Wanderprediger aufgespielt, der gekommen war, die Auferstehung zu verkündigen.
Hodriwitzka reichte mir seine schwere, viereckige Hand. »Auf Wiedersehen«, sagte er, und plötzlich, als hätte er sich mühsam überwinden müssen, fügte er hinzu: »Ich wollte mich bei Ihnen bedanken.« In mir zog es sich schmerzhaft zusammen, vor Freude und Betroffenheit. Man sehe manches nicht mehr, sagte Hodriwitzka, wenn man jeden Tag den gleichen Weg gehe. Ich hätte ihn auf ein paar Gedanken gebracht. Ich hätte heulen können oder ihn umarmen, oder küssen. Er hatte mich richtig verstanden. Verdächtigte mich nicht, ein Spinner zu sein, ein neunmalkluger Angeber oder hirnverbrannter Weltverbesserer.
»Danke«, sagte ich. Dann verließ Hodriwitzka schnell das Zimmer.
Der Ingenieur stand still lächelnd am Schrank. »Glauben Sie jetzt, dass ohne Leute wie Hodriwitzka das Kraftwerk längst zusammengebrochen wäre?« Mich ärgerte der Zynismus, der sich hinter dieser Bemerkung verbarg.
Stell dir vor, Luise, Elli Meseke und Siegfried Strutzer erführen etwas von meinem Gespräch mit dem Heizer Hodriwitzka aus B. Was ist ein inhumaner Tunnel gegen einen Brief von tausend Kraftwerkern an den Minister? Oder ginge das selbst dir zu weit? Nein, sicher nicht. Ich werde dir die Geschichte erzählen, gleich nach der Sitzung, wenn Strutzer endlich seine letzten Bemerkungen zur Arbeitsdisziplin in unsere müden, gelangweilten Köpfe gehämmert hat.