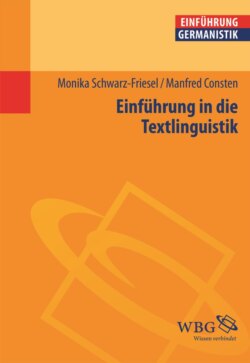Читать книгу Einführung in die Textlinguistik - Monika Schwarz-Friesel - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
2.3 Der funktional-kognitive Ansatz:
Texte als Spuren, Texte als Signale
Оглавлениеdeskriptive und explanative Textlinguistik
Während sich die textlinguistische Forschung in ihren Anfängen vor allem auf textinterne Eigenschaften und strukturorientierte Analysen zu Kohäsion und Kohärenz konzentrierte, integriert die Textlinguistik heute in der Regel interne, textzentrierte und externe, benutzerzentrierte Faktoren. Innerhalb der Textlinguistik jedoch gibt es auch heute noch gravierende Unterschiede, die sich auch methodisch festmachen lassen: So unterscheidet man eine Textlinguistik, die deskriptiv vorgeht und lediglich Struktureigenschaften (z.B. Wiederholungen, grammatische Verweise und syntaktisch-semantische Verknüpfungsrelationen) beschreibt, und eine explanative Textlinguistik, die neben der Beschreibung solcher textinternen Eigenschaften zugleich erklären will, wie die textuelle Kompetenz von Sprachbenutzern konstituiert ist.
Hier stoßen wir auch auf eine prinzipielle Kontroverse in der Linguistik: Man kann Sprache ausschließlich als formales, abstraktes System beschreiben und sie mit den Mitteln der Logik analysieren – dies haben Forscher schon in der Antike getan, und auch einige zeitgenössische Textlinguisten verstehen sich in einer solchen formal-logischen Tradition. Der menschliche Sprachbenutzer ist in solchen Ansätzen jedoch ausgeklammert, „die sprachliche Form geht gleichsam am Kopf vorbei“ (von Stutterheim 1997: 50). Methodisch ist für solch eine Herangehensweise eigenes abstraktes Denken das Wichtigste, mit dem – wie in der Mathematik – in sich stimmige Beschreibungsmodelle entwickelt werden. Andererseits konstituiert sich Sprache durch menschliches Denken und Handeln. Texte sind ein Mittel, mit dem Menschen außersprachliche Zwecke erreichen wollen, sei es überzeugen, gemeinsames Handeln planen, informieren oder unterhalten. Wer mit diesem Gedanken an Texte herangeht, wird den realen Sprachgebrauch von Menschen in ihrem sozialen und/oder emotionalen Handeln beobachten und datengeleitete (empirische) Erkenntnisse daraus ziehen. Dies ist der Ansatz des vorliegenden Buches; er ist „funktional“, da er Texte in ihrer kommunikativen Funktion fokussiert, und „kognitiv“, da er geistige Fähigkeiten und Denkprozesse als Grundlagen der Sprachproduktion und des Sprachverstehens beschreiben will. Den methodischen Erfordernissen eines solchen Ansatzes wird das Kap. 2.4 Rechnung tragen. Von formalen Ansätzen grenzt sich unsere Textlinguistik ab, indem sie nicht versucht, natürliche Sprache in das künstliche Korsett von Formeln zu zwängen, die letztlich nichts erklären, keinerlei heuristischen Wert haben, sondern nur Wissenschaftlichkeit vortäuschen, hinter der sich jedoch nichts Signifikantes verbirgt.
Die beiden Grundannahmen des funktional-kognitiven Ansatzes lassen sich wie folgt präzisieren:
Texte sind Spuren und zugleich Signale
konstruktivistische Sicht
Kognitionswissenschaft
textuelle Kompetenz
In der kognitiv-prozeduralen Textlinguistik werden aus Produzentenperspektive Texte als Spuren der kognitiven Aktivität ihrer Verwender betrachtet. Wir erfahren über die Textstrukturen etwas über die geistige Fähigkeit, die für die Hervorbringung eben solcher Strukturen verantwortlich ist. Zugleich rekonstruieren wir auch die kognitive Einstellung des Sprachproduzenten und erhalten unter Umständen Aufschluss über seine Beweggründe, seine Kenntnisse, seinen Stil (was sich als besonders relevant für die forensische Textlinguistik erweist; s. hierzu Kap. 6.3). Aus Rezipientenperspektive sind Texte Signale, mentale Handlungsimpulse, die aufgrund von Inhalt und Form des Textes im Kopf des Lesers geistige (und emotionale) Prozesse auslösen können. Entsprechend wird Textualität nicht nur als eine Eigenschaft von Texten, als etwas Beobachtbares, etwas Explizites, sondern auch als Leistung von Sprachbenutzern, als etwas konstruktiv zu Erschließendes betrachtet. In dieser konstruktivistischen Sicht wird ein Text nicht nur als Produkt, sondern auch als Prozess bzw. Ergebnis eines Prozesses gesehen. Dabei wird rekonstruiert, wie Texte im Produktionsprozess geplant und formuliert werden und wie sie im Rezeptionsprozess aufgenommen, verstanden (und unter Umständen interpretiert) werden, aber auch welche Wirkung sie auslösen können. Diese kognitive Ausrichtung in der Textlinguistik ist durch die Tatsache motiviert, dass sich auch das (textzentrierte) Phänomen der Kohärenz nur konstruktivistisch erklären lässt, d.h. wenn man die geistigen Prozesse seitens der Sprachbenutzer berücksichtigt, die zur Produktion und zum Verstehen von Texten führen. Die kognitiv-prozedurale Textlinguistik sieht sich als Teildisziplin der interdisziplinären Kognitionswissenschaft, die Einblick in die Strukturen und Prozeduren des menschlichen Geistes erhalten will. Da Texte als Mehrebenengebilde viele Dimensionen und Funktionen haben, ergibt sich auch nahezu zwangsläufig, dass die Textlinguistik profitiert, wenn sie Schnittstellen zu anderen Disziplinen berücksichtigt und sich als Teil einer umfassenden Textwissenschaft sieht, deren Relevanz van Dijk (1980b) vor 30 Jahren bereits betont hat. Sie will vor allem die Bedingungen und Prinzipien der Textkonstitution erklären und damit Aufschluss über die textuelle Kompetenz von uns Sprachbenutzern erhalten. Diese textuelle Kompetenz beinhaltet die Produktion und Rezeption von grammatisch korrekten, sinnvollen Texten sowie die Fähigkeit, zwischen zusammenhängenden und nicht-zusammenhängenden Texten zu unterscheiden. Zur textuellen Kompetenz gehören mehrere Teilfähigkeiten: Schreib- und Lesetätigkeit, die sich auf die graphemische, grammatische und semantische Dimension beziehen, Kohärenzetablierung, Textsortenerkennung, Themabestimmung. Diese Fähigkeiten sind grundlegend und weitgehend überindividuell zu verstehen, wenngleich es natürlich durchaus sehr individuelle und subjektive Faktoren beim Verfassen und Aufnehmen von Texten geben kann (wie u.a. die viel zitierten Pisa-Studien gezeigt haben). Die in didaktischen Prozessen oft erwähnte Textkompetenz als „die individuelle Fähigkeit, Texte lesen, schreiben und zum Lernen nutzen zu können“ (Portmann-Tselikas/Schmölzer-Eibinger 2008: 5–16) hängt von der allgemeinen Kompetenz ab.
Texte sind kommunikative Phänomene
Texte entstehen im Kommunikationsprozess, im „Gebrauch“, und mit Texten vollziehen wir verbale Handlungen. Damit sind Texte auch sozialkulturelle Phänomene, deren gesellschaftliche Einbettung stets zu beachten ist. Ein Großteil des „kollektiven Gedächtnis“ einer Gesellschaft ist zudem in Texten gespeichert und wird durch diese vermittelt. Dazu Antos (1997: 47): „Ein Großteil unseres Wissens wird nicht nur in Texten repräsentiert und archiviert, sondern konstituiert sich sprachlich überhaupt erst als Text“ (Herv. im Original). Texte sind aber nicht nur Träger von kollektivem Wissen, sondern fungieren auch als explizite oder implizite „Handlungsanleitungen“. Mit Texten greifen wir in die Welt ein, beeinflussen wir Einstellungen und Meinungen, üben Macht und Gewalt aus, machen Freude, bereiten Vergnügen, erzeugen wir neue Gedanken, beglücken oder beleidigen, überreden oder überzeugen andere Menschen.