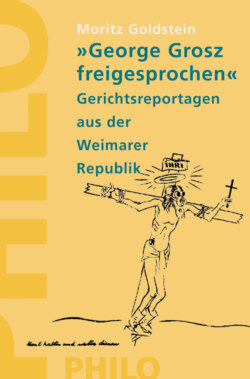Читать книгу "George Grosz freigesprochen" - Moritz Goldstein - Страница 6
ОглавлениеManfred Voigts VORWORT
In ruhigen Zeiten kommt ein durchschnittlicher Bürger eigentlich nicht vor Gericht. In unruhigen Zeiten ist das anders, die sozialen ebenso wie die poli tischen Bewegungen und Brüche bringen es mit sich, daß im Gerichtssaal ein fast vollständiger Querschnitt der Gesellschaft vor den Richter tritt. So war es in den späten 1920er und frühen 1930er Jahren: Der Existenzkampf breiter Schichten war durchzogen von kleinen und großen Straftaten, die Möglichkeiten eines steilen Aufstieges ermunterten zu Betrügereien, die politischen Auseinandersetzungen, oft handgreiflich ausgetragen, trafen oft genug Unbeteiligte. Die Berichte über Gerichtsverhandlungen konnten in diesen Jahren den Zustand der Gesellschaft in seiner extremen Zerrissenheit und Unruhe besser darstellen als eine soziologische Untersuchung – wenn sie so scharf beobachtend und zugleich mitfühlend waren wie die Gerichtsreportagen von Moritz Goldstein.
Moritz Goldstein war Jude, er war assimiliert, groß geworden im Kaiserreich Wilhelms II. Das war die Zeit, in der die Uniform, der Talar oder die Richterrobe noch Bedeutung hatten und soziale Distanz und obrigkeitliche Macht symbolisierten. Der Gehrock als Zeichen besonderer Würde und Verantwortung wurde noch von Konrad Adenauer getragen. Goldstein kritisierte 1931 in einem Artikel den „Uniformgeist“. Der demokratischen Weimarer Republik stand Goldstein zunächst kritisch bis abwartend gegen über, sein Begriff der hohen Kultur konnte sich mit den neu aufkommenden kulturellen Tendenzen nur langsam arrangieren. Moritz Goldstein war Jude, 1912 erschien sein aufsehenerregender Aufsatz „Deutsch-jüdischer Parnaß“, in dem er die Juden aufforderte, ihre eigene Kultur zu schaffen. „Warum gibt es so viele jüdische Journalisten?“ – fragte er dort.
Ein Journalist ist ein Spiegel: die Bilder des Tages auffangen und zurückwerfen, das ist seines Wesens. Ist es jüdisch, nur Spiegel zu sein, statt selbst zu schaffen? Ihr behauptet es, viele glauben es. Ich aber sage: nein! Sondern wer nichts war als ein Spiegel, anschmiegsam, gewandt, wer sich abzufinden, vorliebzunehmen wußte, der kam in unsrer jüdisch-halben Situation obenauf. So mußte man sein, um sich in einer Umgebung von Verächtern durchzusetzen.1
Ein Schaffender wollte Goldstein sein, er schrieb Erzählungen, Romane und Theaterstücke, der Erfolg aber blieb ihm versagt. Er wurde Journalist. Aber er wurde kein Spiegel. Fast als Gegenbild unterzeichnete er seine Artikel mit ‚Inquit‘ (er untersucht). In seiner Dissertation von 1906 taucht dieses lateinische Wort bei ihm erstmals auf und bezeichnet den Verzicht auf ästhetische Wirkung.2 ‚Er untersucht‘ – dies war sein Programm als Gerichtsberichterstatter an der Vossischen Zeitung. Er untersucht, das bedeu tet: Er untersucht in alle Richtungen, also etwas, das die Staats anwaltschaft in den Jahren, in denen er seine Artikel schrieb, nicht immer tat.
Die Justiz hatte am Aufstieg und am Sieg des Nationalsozialismus keinen geringen Anteil. Immer klarer wurde Goldstein, daß in der Weimarer Republik eine ‚politische Justiz‘ (Otto Kirchheimer) herrschte. Goldstein kannte Robert Kempner, den späteren Ankläger der Nürnberger Prozesse. Damals war Kempner Justitiar der Polizeiabteilung im Preußischen Innenministerium, Preußen war unter dem Ministerpräsidenten Otto Braun ein Bollwerk der Demokratie. Kempner gab 1929 unter dem Titel Richter und Gerichtete Gerichtsreportagen von Paul Schlesinger heraus, der vor Goldstein die Gerichtsreportagen für die ‚Vossische‘ unter dem Pseudonym ‚Sling‘ geschrieben und sie überhaupt erst zu einer anerkannten Institution gemacht hatte – Goldstein schrieb in „Sling in Moabit“ über dieses Buch. Im August 1930 wurde eine Denkschrift verfaßt, an der auch Kempner mitgearbeitet hatte, nach der die NSDAP als „staats- und republikfeindliche, hochverräterische Verbindung“ sofort zu verbieten sei.3 Der Reichskanzler Brüning weigerte sich, juristische Schritte vorzunehmen, man müsse sich „davor hüten, dieselben falschen Methoden gegen die Nationalsozialisten anzuwenden, welche in der Vorkriegszeit gegen die Sozialdemokraten angewendet worden seien“.4
Es gibt keinen Hinweis darauf, daß Goldstein von dieser Denkschrift Kenntnis hatte. Aber was ihm klar war und was er vielleicht gerade durch seine Skepsis gegenüber den neuen demokratischen Gesetzen und Institutionen deutlicher sah als andere war, daß geschriebenes Recht allein nie ausreicht, um Recht zu schaffen, daß vielmehr zuletzt immer und einzig der einzelne Mensch für das Recht eintritt oder nicht eintritt. Das galt besonders in jenen Jahren, in denen Goldstein aus den Gerichtssälen berichtete. Vor der Revolution war es ideell zuletzt die Person des Kaisers, die das Recht sichern konnte – wie Goldstein erinnert: „Ein jeder Richter sitzt an des Kaisers Statt.“ („Des Kaisers Gerechtigkeit“) Mit seinem Sturz brach für viele eine Welt zusammen, die in den wenigen krisenhaften Jahren der Weimarer Republik nicht wieder zusammengefügt werden konnte. Es gab keine demokratische Kultur, die demokratische Zivilcourage war schwach. „Ein jeder Richter sitzt an Volkes Statt.“ – dies war Goldsteins Hoffnung, nicht aber Realität. So beschäftigte er sich nicht nur mit den Angeklagten, sondern auch mit den Richtern, die in den zunehmend politischen Prozessen abnehmend das Gesetz vertraten.
Goldstein berichtete nicht nur über die großen Prozesse, die Schlagzeilen machten – die vielen im Guten wie im Schlechten großen Namen, die in seinen Gerichtsreportagen genannt werden, müssen hier nicht wiederholt werden. Genauso wichtig sind die Beiträge über Prozesse gegen den ‚Mann von der Straße‘, weil in ihnen die heute kaum mehr nachvollziehbare Härte des ‚normalen‘ Lebens zum Ausdruck kommt. Ihm, dem Normalbürger, galt Goldsteins Sympathie trotz seiner kritischen Anmerkungen. Ihm, dem Angeklagten, fühlte er sich verwandt, nicht dem Richter. Wegen Überfüllung des Gerichtssaales mußte Goldstein im April 1929 auf der Anklagebank Platz nehmen.
Da sitze ich auf demselben Platze, auf dem ich schon so manchen in seiner Schande habe sitzen sehen [...]. Ich entsinne mich ihrer, der Gestalten und der Gesichter, wie sie hier saßen, allein und in Gruppen, und ich entsinne mich der teilnehmenden Wißbegierde, mit der ich in ihren Mienen forschte, um dahinter zu kommen, wie es wohl in ihrer Seele aussehen mochte. [...] Aber wenn nun jemand den Saal heimlich photographierte, und das Bild käme in die Hände von fremden Leuten? Für sie wäre ich der Angeklagte. [...] Und vielleicht nähme er mich aufs Korn, unterstützte die Augen durch ein Glas, und suchte zu entziffern, was auf meinen Mienen geschrieben steht. Und er läse mir gewiß die Scham der Schande ab, die Angst vor der Strafe und die unverkennbar eingegrabenen Spuren der verbrecherischen Neigung. („Das Verbrechergesicht“)
Fast einhundert Jahre hat Moritz Goldstein gelebt. Mit einem Aufsatz, mit „Deutsch-jüdischer Parnaß“, hat er sich in die Geschichte eingeschrieben. Fünf Jahre nur hatte er eine ihm angemessene und ihn ausfüllende Tätigkeit. Das Hauptwerk jener Jahre wird hier der Öffentlichkeit zugänglich gemacht.
Ich danke Till Schicketanz für die umfangreichen Recherchen, die sachkundigen Anmerkungen und das Nachwort. Ich danke ebenso Frau Martina Flohr für die Textrevision anhand der Originale.
Manfred Voigts
Anmerkungen
1 Moritz Goldstein, „Deutsch-jüdischer Parnaß“, Der Kunstwart, Jg. 25, H. 11 (1. Märzheft 1912), S. 281–294; wieder in: Menora, Bd. 13 (2002), „Deutsch-jüdischer Parnaß. Rekonstruktion einer Debatte“, S. 39–59, hier S. 49.
2 Moritz Goldstein, Die Technik der zyklischen Rahmenerzählungen Deutschlands. Von Goethe bis Hoffmann. Berlin: B. Paul, 1906, S. 107.
3 Der verpaßte Nazi-Stopp. Die NSDAP als staats- und republikfeindliche, hochverräterische Verbindung. Preußische Denkschrift von 1930, hg. von Robert M. W. Kempner, Frankfurt a. M., Berlin, Wien: Ullstein, 1983 (Ullstein-Buch, 34159: Ullstein-Sachbuch).
4 Ebd. S. 10.