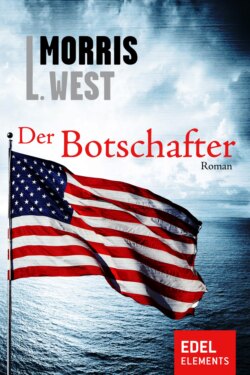Читать книгу Der Botschafter - Morris L. West - Страница 5
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Erstes Kapitel
ОглавлениеMeine Fähigkeiten als Diplomat sind anerkannt. In seinem Abschiedsschreiben bezeichnete der Präsident meine Karriere als glänzend und verdienstvoll, meine Arbeit als einen Gewinn für die Vereinigten Staaten von Amerika. Ich habe dieses Kompliment nicht ohne Ironie entgegengenommen, dennoch war ich mir bewußt, es verdient zu haben.
Fünfunddreißig Jahre lang war ich im Auswärtigen Dienst, zehn Jahre davon als Botschafter. Ich habe meinen Anteil an schwierigen Missionen geleistet und genug Kastanien aus dem Feuer geholt. Nicht einmal meine Gegner können mich offenkundiger Fehler zeihen. Ein oder zwei spektakuläre Erfolge sprechen für sich selbst.
Einige meiner Freunde halten meinen Entschluß, den Dienst mitten in einer aufsteigenden Karriere zu quittieren, für mein diplomatisches Meisterstück. Sie weisen darauf hin, daß der Präsident, dessen Wohlwollen ich in hohem Maße besitze, mich jederzeit zur Übernahme von Sonderaufträgen zurückrufen könne, andererseits hätte ich nun endlich die Hände frei, meine ehrgeizigen politischen Ziele zu verfolgen.
Meine Freunde setzen voraus, daß ich politischen Ehrgeiz besitze. Man kennt mich als einen kühlen Rechner und hartgesottenen Verhandlungspartner – ein Ruf, der einer diplomatischen Karriere nur förderlich sein kann. Sollte ich mich geändert haben, so hatten meine Freunde bisher wenig Zeit und Gelegenheit, es wahrzunehmen. Das Gewissen, das Maxwell Gordon Amberley – wie sollten sie davon wissen, da doch Maxwell Gordon Amberley selbst es erst vor kurzem entdeckt hat? Ich habe mich, was meinen Abschied betrifft, peinlich genau an die Gepflogenheiten des Staatsdienstes gehalten. Nach Phung Van Cungs Tod blieb ich noch volle zwölf Monate im Dienst – mehr als genug, um die Regierung von jeglicher Verantwortung für diesen Tod und seine Folgen zu entbinden. Dann fuhr ich zu einem Routinebesuch nach Washington, gab Handküsse und absolvierte Besprechungen über den nächsten Auftrag. In einer New Yorker Klinik unterzog ich mich einer Generaluntersuchung. Drei Wochen später reichte ich mein Rücktrittsgesuch ein – aus Gesundheitsrücksichten.
Die wahren Gründe? Sie zu suchen, bin ich hier, in dem alten Zen-Heiligtum von Tenryu-ji: dem Tempel des Himmlischen Drachen bei Kioto in Japan.
Es ist Herbst. Der heilige Ahorn am Tor flammt rot vor der dunklen Mauer der Pinien. Der Himmel hat den heimlichen Glanz von Perlen. Still liegen die abgefallenen Blätter auf den Teichen und den geharkten Sandwegen, auf den Steinen und dem lebendigen Grün der Moosflecken. Auf meinen Spaziergängen sehe ich den Mönchen bei der Pflege ihres Gartens zu. Sie arbeiten stetig, mit Geduld und Hingabe für das einzelne; aus jeder Pflanze, jedem Grashalm lassen sie einen Goldenen Buddha erstehen.
Mit gekreuzten Beinen sitze ich auf der Strohmatte in Muso Sosekis Haus und trinke Tee, den er mir nach den vorgeschriebenen Zeremonien bereitet hat. Von Muso Soseki lasse ich mich durch einen der meditativen Dialoge führen, die Mondo genannt werden.
»Warum kommst du hierher?«
»Ich suche Erleuchtung.«
»Warum hast du sie nicht gefunden?«
»Weil ich sie suche.«
»Wie wirst du sie finden?«
»Indem ich nicht suche.«
»Wo wirst du sie finden?«
»Nirgendwo.«
»Wann wirst du sie finden?«
»Niemals.«
Der Dialog gleicht der Anlage des Tempels, des Gartens, des Hauses. Hier ist alles sparsam und karg, voller Bedeutung, ins Unendliche weisend. Die Matte, auf der ich sitze, scheint sich über den Sand der Pfade und die vom Flossenschlag der Karpfen gekräuselten Teiche fortzusetzen.
Muso Soseki ist ein Mönch des Zen-Kultes. Er ist auch Wächter, Gärtner, Meister der Kalligraphie und der Kunst des Drückens mit Holzblöcken. Die Pinselstriche seines Namens bedeuten: Fenster, das sich auf einen Traum öffnet. Er ist fünfundsiebzig Jahre alt, stämmig, braun, verwittert wie altes Gestein. Sein Gesicht hat die Stille der Güte und einen Schimmer von Humor. Er hat eingewilligt, mein Lehrer zu sein, und bedient sich der Methoden des Zen, um mich dem Augenblick der Einsicht und Erleuchtung entgegenzuführen, der Satori heißt.
Ich bedarf der Erleuchtung. Vor drei Jahren schon hätte ich bleiben und sie erwarten sollen, damals, kurz nach dem Tode meiner Frau, als George Groton mich zum erstenmal hierherbrachte.
Zu dieser Zeit war ich amerikanischer Botschafter in Japan, eine wichtige Figur auf der politischen Bühne Ostasiens. Ich glaube, ich spielte meine Rolle nicht schlecht. Ich habe eine Begabung für Sprachen, viel Geschmack an exotischen Gebräuchen und ein feines Ohr für Zwischentöne. Alles andere war nicht mein Verdienst, sondern Zufall – mir zugefallen als Geschenk von Gabriele, meiner Frau.
Sie hatte Charme, Taktgefühl, Humor und eine mühelose Harmonie, die sich, solange sie bei mir war, auch meinem Leben mitteilte. Als sie starb, zersprang die Harmonie mit einem Mißklang. Jeder Bruch in meinem Wesen öffnete sich, und die alten Fehler traten von neuem hervor.
Ich habe nie die Fähigkeit des Glaubens besessen und sie auch nicht vermißt. Die Liebe meiner Frau war mir genug. Gewiß hatte ich das, was man religiöse Gefühle nennt. Ich besuchte Gottesdienste, wenn das Protokoll es erforderte, und es gelang mir sogar, Gefallen daran zu finden. Im übrigen genügte mir der Trost meiner Hausgötter und der Priesterin, die ihnen und mir diente.
Ihr Tod stürzte alle meine Heiligtümer. Ich vergrub sie, versteckte ihre Trümmer vor dem Tageslicht. Jedes Mitgefühl stieß ich zurück, wurde abweisend, arbeitswütig, kleinlich: ein unerträglicher Chef meiner Mitarbeiter, die sich mehr und mehr von mir zurückzogen. Nur die Japaner, dieses schizophrene Volk, schienen mein Bedürfnis nach einer Periode heilsamer Raserei zu akzeptieren, von meinen Landsleuten lediglich George Groton, ein junger Botschaftssekretär. Er begriff offenbar, was in mir vorging, und ließ sich weder durch meine Zornausbrüche noch durch Arroganz brüskieren. Nach wie vor war er fleißig, gut gelaunt und furchtlos: ein langer gutgewachsener Kerl, Brillenträger, mit abfallenden Schultern und einem Schopf sandfarbenen Haares. In schwachen Stunden ertappte ich mich bei dem Wunsch, einen Sohn zu haben wie ihn.
Eines Nachts – er versah Spätdienst am Funkgerät – holte er mich aus dem Bett, um mir die letzten Code-Telegramme auszuhändigen. Ich hatte vor dem Schlafengehen getrunken, meine Laune war entsprechend, und ich ließ es ihn spüren. Als ich fertig war, holte er tief Luft, baute sich breit vor mir auf und sagte: »Sir, Sie machen sich und uns kaputt. Wenn Sie nicht wollen, daß wir Ihnen helfen, dann lassen Sie uns wenigstens unsere Arbeit tun, so gut es geht.«
Sprachlos starrte ich ihn an. Er zuckte die Schultern und bedachte mich mit einem entwaffnenden Grinsen.
»Wenn Sie wollen, Sir, können Sie mich nach Hause schicken, aber einer mußte es Ihnen sagen.«
»Warum ausgerechnet Sie, Groton?«
»Mrs. Amberley war sehr freundlich zu mir. Vor ihrem Tode mußte ich ihr versprechen, auf Sie aufzupassen.«
Ich schämte mich. Schweigend nahm ich die Telegramme an mich, schloß mich in mein Zimmer ein und weinte wie ein Kind.
Am nächsten Morgen sandte ich Groton eine förmliche Notiz, in der ich mich entschuldigte und bedankte. Eine Woche später lud er mich zu einem Ausflug des Botschaftspersonals ein. Es ging nach Kurama, zum jährlichen Feuerfest, und da Kurama nicht weit von Kioto entfernt liegt, schien es die natürlichste Sache der Welt, den Tempel des Himmlischen Drachens in Kioto zu besichtigen. Dort traf ich Muso Soseki.
Wenn Groton Zeit gehabt hätte, wäre er ein großer Diplomat geworden. Er war ein Mann von einfachem, klarem Denken, das unmittelbar zum Kern eines Problems vorstieß. Dabei besaß er genug Feinfühligkeit und guten Willen, sich den Denkvorgängen seines Gegenübers anzupassen. Nach seinem gewaltsamen Tod in Saigon habe ich noch einmal geweint. Dann nie wieder.
Muso Soseki empfing mich mit der selbstverständlichen Höflichkeit eines Menschen, der mit sich, seiner Vergangenheit und seiner Welt in Einklang steht. Während er mich durch den Tempelgarten führte, erklärte er mir seine Anlage in der Weise des Zen: nicht als zufällige Ansammlung von Schönheit, sondern als ein sinnvolles Kunstwerk aus harmonischen Verbindungen und enthüllenden Kontrasten – eine Stätte spiritueller Ereignisse, ein Mittel der Erleuchtung, wirksamer als Bücher und Diskussionen.
Er hielt mir keinen Vortrag; er sprach über diese Dinge in einer natürlichen, intimen Weise, liebevoll, mit tiefer Anteilnahme, wie ein Freund zum Freunde. Große Mühe gab er sich, mir den Begriff Satori klarzumachen. Ein Satz ist mir im Gedächtnis geblieben:
»Die Wurzel aller menschlichen Verzweiflung, Amberley-san, ist das Gefühl der Entfremdung von der natürlichen Ordnung des Weltalls. Satori bewirkt eine Erleuchtung des Geistes, in der das Wesen des Ichs und des Universums in Klarheit erscheint und das Gefühl für die Verwandtschaft und Einheit aller Dinge sich enthüllt.«
Meine eigene Verzweiflung war noch so jung und schmerzhaft, daß ich bei diesen Worten aufhorchte und ihn bat, sie deutlicher auszulegen. Lächelnd lehnte er ab.
»Kommen Sie wieder, dann trinken wir Tee und sprechen in Ruhe.«
Ich kehrte nach Tokio zurück, befangen in diesem Erlebnis wie im Nachklang eines schönen stillen Traumes. In einem Brief dankte ich Muso Soseki für seine Freundlichkeit und bat ihn um ein Wiedersehen. Zehn Tage später erhielt ich seinen Brief, ein Meisterwerk der Schönschreibkunst auf handgeschöpftem Papier. Er bot mir sein Haus und seine Freundschaft und was er »die spärlichen und unwürdigen Früchte meiner Winterernte« nannte. Ich könne jederzeit kommen und als sein Gast bei ihm bleiben.
Ich besuchte ihn, sooft mein Dienst es erlaubte, manchmal allein, manchmal mit Groton, der eine ähnliche Verbindung mit einem anderen Mönch eingegangen war. Groton war fortgeschrittener als ich, vielleicht weil er jünger war oder einfacheren Wesens, formbarer, den Ordnungen des Zen zugänglicher als ich.
Seltsam – ich hatte während dieser Besuche nie das Gefühl, religiöse Übungen im üblichen Sinne des Wortes zu betreiben. Die Ausübung des Zen wurde mir als Teil der natürlichen Ordnung dargestellt, als Vorbereitung des menschlichen Organismus für eine höhere Bewußtseinsstufe. Auf diesem Wege, wenn ich ihn in der richtigen Weise ging, würde ich die Schwächen überwinden können, die der Verlust meiner Frau verursacht hatte, so verhieß mir Muso Soseki.
Ich nehme es als ein Zeichen für Grotons fortgeschrittene Weisheit, daß er nie, auch dann nicht, wenn er mich zu meinem Lehrer begleitete, auf unsere beiderseitigen Verbindungen zu sprechen kam. Er sagte: »In Tokio trennen uns die Formalitäten des Dienstes, hier in Kioto trennt uns eine nicht mitteilbare Erfahrung.« Wenn ich versuchte, ihm zu danken, lächelte er nur und antwortete mit einer Bemerkung, die für Zen typisch ist: »Wenn wir schweigen, sind wir eins. Wenn wir sprechen, sind wir zwei.«
An diese Worte erinnerte ich mich später in Saigon, während unserer bitteren Auseinandersetzungen über den von mir eingeschlagenen Weg.
Für mich bedeuteten die Besuche in Kioto zunächst nichts weiter als Augenblicke der Stille, ein oder zwei Tage Befreiung von dem Druck und der Hetze meines Amtes. Ich genoß den Garten und das durchsichtige Dahinfließen der Gespräche. Sie kamen meiner Arbeit zugute. Das japanische Denken in seiner so schwer faßbaren Verfeinerung begann sich mir langsam zu erschließen. Ich bekam ein Gespür für das Emotionelle, das jede, auch die sachlichste Äußerung in eine Art Nebel hüllt. Ich begriff, daß dieser intuitive Weg zur Erleuchtung nicht notwendig den Verstand ausschaltete, im Gegenteil: Auf den Wegen zu diesem Ziel erschlossen sich die geheimsten Vorgänge des menschlichen Geistes im Bereich des Unterbewußten.
Muso Soseki machte nie den Versuch, mir eine bestimmte Disziplin aufzudrängen. Oft tranken wir Tee und unterhielten uns wie Freunde. Manchmal führte er mich durch einen Mondo – Dialog. Dann wieder gab er mir als Gegenstand der Meditation eine der scheinbar sinnlosen Aufgaben, die Koan genannt werden.
Eine davon, zu der er immer wieder mit sanfter Inständigkeit zurückkam, war folgende:
»Was werden Sie tun, wenn man Ihnen befiehlt, den Kuckuck zu töten?«
Beim erstenmal fragte ich nach den Regeln der Aufgabe. Wer ist »man«? Wer ist der Kuckuck? Warum sollte man mir befehlen, ihn zu töten? Muso verweigerte lächelnd die Auskunft.
»Sie, Amberley-san, Sie müssen mir sagen, was ich meine.«
Die Frage begann mich zu verfolgen. Sie brachte Verwirrung in die starre, manchmal furchterregende Logik praktischer Diplomatie. Sie bedrückte mich wie ein surrealistisches Bild, dessen einzelne Symbole klar sind und das dennoch dunkel bleibt, bis man den Schlüssel erhält. Aber nach und nach erkannte ich, wie und wohin ich geführt wurde: in einen Zustand des Mißtrauens gegen mich selbst, der Unzufriedenheit mit dem Offenbaren, in einen Bereich wortloser Verständigung. Im. Verlauf dieses Verstehens kam mir auch die Erkenntnis, wie weit ich noch vom Ziel entfernt war.
Plötzlich, ohne Warnung, wurde dieser Prozeß langsamen Wachstums unterbrochen. Festhammers Ankunft warf mich in die Wirklichkeit der Diplomatie zurück – in eine Wirklichkeit, die mir inzwischen schon fast als Illusion erscheinen wollte.
Er überbrachte eine Anfrage des Außenministers in Washington, begleitet von einem überaus freundlichen Schreiben des Präsidenten: Ob ich bereit sei, mein Amt in Tokio aufzugeben, um als Botschafter in Südvietnam Sonderaufgaben zu übernehmen.
Kein Mensch auf der Welt hat weniger mit Zen zu schaffen als Raoul Festhammer. Er ist der Pragmatiker schlechthin. In seiner Hand verwandeln sich Fakten in Degenspitzen. Manche bezeichnen ihn als den perfekten Opportunisten; ich achte ihn zu sehr, als daß ich ihn so billig klassifizieren könnte. Er hat die Gabe, eine Situation völlig kühl und objektiv zu betrachten und abzuschätzen. Seine Lageberichte sind Lehrbuchübungen in taktischer Logik. Er ist Nichtraucher und trinkt wenig, sein Appetit auf schöne Frauen ist unstillbar. Er gilt als unsicherer Freund und gefährlicher Feind. Seine Arbeit tut er exakt wie ein Bankier. Im Privatleben schätze ich ihn wenig, aber was das Berufliche betrifft, so würde ich meine Karriere ohne Bedenken auf einem seiner Berichte aufbauen. Genau das verlangte er von mir.
»… ein gottloser Verhau, Max, undankbar bis dort hinaus. Wir nennen das eine Rebellion – im Grunde ist es ein Bürgerkrieg: Bruder gegen Bruder, Sohn gegen Vater. Und wir stecken drin. Wir brauchen einen militärischen Stützpunkt in Südostasien und müssen um jeden Preis verhindern, daß China nach den Reisschüsseln des Südens und den Seewegen nach Afrika greift. Wenn Südvietnam verlorengeht, ist Thailand von der Flanke her bedroht und Singapur in Gefahr. Wir haben dreißigtausend Mann und Gott weiß wieviel Millionen Dollars da hineingesteckt und sind immer noch Berater ohne Entscheidungsgewalt in der Führung der Kampfhandlungen.
Wir haben Phung Van Cung und seine Familie unterstützt, weil sie die besten und mächtigsten Leute in der Verwaltung waren, wahrscheinlich sind sie es immer noch, aber sie hören nicht mehr auf uns. Sie benehmen sich, als hätten sie eine Telefonverbindung zum Heiligen Geist persönlich. Die Cungs gehören zu einer Minorität von Katholiken in einem buddhistischen Land. Statt sich mit den Buddhisten zu vertragen, setzen sie sie bei jeder Gelegenheit unter Druck. Sie verhaften Studenten und Studentinnen und stecken sie in Zwangsarbeitslager. Sie verbrauchen unser Geld für ihre Zwecke. Die Kontrolle über die ländlichen Gebiete geht mehr und mehr verloren. Der militärische Oberbefehl ist gespalten. Trotz der zehntausend befestigten Dörfer und einer gewaltigen Überlegenheit an Waffen und Ausrüstung gewinnen die Vietcong jede Runde … McNally hat sein Bestes getan, aber wir haben ihn auf einen falschen Kurs gesetzt. Durch Überredung und Charme sollte er sich mit Phung Van Cung anfreunden. Das geht jetzt nicht mehr. Mit der sanften Tour ist es vorbei. Wir müssen die Regierung durch wirtschaftliche Sanktionen gefügig machen.
Ich habe hier einen Haufen Papier. Lies das durch, Max, dann weißt du, daß auf diesen Posten ein starker Mann gehört. Es gibt. keine Oscars zu verdienen. Was du auch anstellst – ein Verhau ist und bleibt es. Alles, was du dabei ernten kannst, sind Kopfschmerzen. – Zu Hause beten sie, daß du ja sagst …«
Ich brauchte zwei Tage, um die Papiere durchzulesen. Dann nahm ich an. Als ich später daranging, mein Schuldkonto zusammenzustellen, fragte ich mich, was davon auf diesen Augenblick zurückzuführen sei.
Natürlich war Stolz im Spiel. Wer empfände nicht Stolz, wenn er sagen könnte: Hier stehe ich im Namen eines großen Volkes, das mich geschickt hat, weil ich ein kluger und starker Mann bin. Man hüte sich, mich herauszufordern!
Angst war auch dabei. Gabrieles Tod hatte mir meine Schwächen enthüllt, Muso Soseki meine Selbstkritik aufgerufen; George Groton gegenüber hatte ich mich schämen müssen. Aber unter Stolz und Angst regte sich noch etwas anderes, ein Drang, Kontemplation mit Aktion zu vertauschen, die eigene Entscheidung aufzuschieben, indem ich mir das Recht nahm, Entscheidungen über Millionen Namenloser zu fällen.
Immerhin hatte ich einen Eid im Hinblick auf einen solchen Einsatz geleistet. Es war mein Beruf. Mein oberster Chef gab mir diesen besonderen Auftrag. Woher sollte ich das Recht nehmen, meine eigenen Probleme für wichtiger anzusehen als das Allgemeinwohl? Ich hatte mich wohl damit abzufinden, daß zwei Wesen in mir Platz hatten: Eins wandelte immer noch im Garten von Tenryu-ji, das andere war im Begriff, sich in das gefährliche Spiel der Mächte zu stürzen. Keine Chance, die beiden in eins zu bringen!
Ich kann nicht behaupten, daß ich mich wohl dabei fühlte. Unsicherheit und böse Vorahnungen bedrängten mich. Wie lange würde dieser Balanceakt den Erschütterungen einer feindlichen Umgebung standhalten? Muso Soseki hatte mich gelehrt, mein verborgenes Ich zu achten. Aber Gabrieles Liebe war nicht mehr da, um die innere und äußere Welt harmonisch zu verbinden.
In meiner Unsicherheit wandte ich mich an George Groton und fragte ihn, ob er Lust hätte, als mein persönlicher Mitarbeiter mit mir nach Saigon zu gehen. Er grinste auf seine jungenhafte Weise, dankte für das Vertrauen und sagte zu. Dann fragte er, ganz beiläufig, ob ich nicht vorhätte, vor meiner Abreise Muso Soseki zu besuchen. Im Wirbel der Gespräche mit Festhammer und der Washington-Telefonate hatte ich daran nicht gedacht. Groton erinnerte mich an jene besondere Art von Ehrerbietung des Schülers für den Meister, die der des Sohnes für den Vater gleicht. Wieder einmal schämte ich mich meiner Gedankenlosigkeit und versprach, einen letzten Tag mit Muso Soseki zu verbringen, sobald der Turnus der diplomatischen Verabschiedungen vorüber sei.
Als ich den Garten betrat, war schon etwas von der Frische des kommenden Winters in der Luft. Das Feuer des Ahorns am Tor war erloschen. Die Blätter faulten in die Erde hinein. Grau und abweisend lagen zwischen kahlen Felsen die Teiche. Muso Soseki empfing mich in seinem Haus. Er schloß die Wände, und wir blieben allein in einem winzigen Raum voller Licht und Wärme. Als ich ihm von meiner Versetzung berichtete, nickte er und sagte:
»Jeder Mensch trägt seine eigenen Schuhe. Er muß gehen, wohin seine Schuhe ihn tragen. Dennoch halte ich es für ein Wagnis, in dieser Phase Ihres Lebens einen solchen Auftrag zu übernehmen.«
Ich lachte ihm zu. Ein solches Wagnis gehöre nun einmal zur diplomatischen Karriere, sagte ich.
Er schüttelte den Kopf. »Ich dachte weniger an Ihre Karriere als an Ihre Person«, sagte er. »Sie sind sich der Unvollkommenheit in Ihrem Leben bewußt geworden, das mag Sie verführen, der Situation, die sie dort vorfinden, eine unmögliche Vollkommenheit aufzwingen zu wollen. Die Sie geschickt haben, erwarten Erfolge. Welcher Art sollen diese Erfolge sein? Das Ende des Bürgerkrieges? Das Ende des Kommunismus in Südvietnam? Das Ende des jetzigen Regimes?« Mit seiner kleinen schmalen Hand hielt er meine Antwort zurück: »Antworten Sie nicht, Amberley-san! Auf den Wegen der Erleuchtung sind Sie mein Schüler. Auf den Wegen der Welt sind Sie Botschafter der Vereinigten Staaten von Amerika. Lassen Sie uns nicht über Politik miteinander reden. Nur das eine: Die politischen Probleme sind im Grunde nichts anderes als die vervielfachten Probleme des einzelnen. Wir versuchen, sie in der gleichen Weise zu lösen, indem wir uns ein begrenztes Ziel setzen und von ›Erfolg‹ sprechen, wenn das erreicht ist. Ein General sagt: Wenn ich den Krieg gewinne, habe ich Erfolg und bin erfolgreich. Es kümmert ihn nicht, daß der Krieg eine Zerstörung ohne Grenzen ist und daß nach jedem Krieg ein neuer Schöpfungsakt Ordnung in das Chaos der Vernichtung bringen muß, damit zwischen Trümmern neue Saaten aufgehen und aus der Asche der Traurigkeit ein neues Leben geboren werden kann. Verstehen Sie mich, Amberley-san?«
»Ich verstehe Sie schon, aber Ihre Worte geben mir keine Erleuchtung. Es ist nicht meine Aufgabe, die Ziele meines Handelns zu bestimmen. Ich kann nur mein Bestes tun, die Ziele zu erreichen, die mir gesetzt sind.«
Wiederum schüttelte er den Kopf.
»Was Sie sagen, ist nur ein Teil der Wahrheit. Man erwartet von Ihnen eine Beurteilung der Lage und Rat. Auf diese Weise könnten Sie dazu beitragen, die Ziele zu formen, die Ihnen später gesetzt werden.«
»Mag sein, aber vergessen Sie nicht, daß meine Beurteilung vom Druck der Tagesereignisse beeinflußt sein könnte, von Naturkatastrophen, Hungershot, Krieg und den Schwankungen der Börse. Ich und alle, die mit mir zu tun haben, wir müssen uns ständig vor Augen halten, daß ein Wechsel nicht notwendigerweise Besserung bedeutet. Wenn es mir nicht gelingen sollte, Cung zu überzeugen, könnte vielleicht von mir verlangt werden, einen neuen Kurs einzuschlagen, von dessen Richtigkeit ich nicht überzeugt bin. Andererseits besteht die Möglichkeit, daß der Kurs, den ich verfolge, weitere Katastrophen und Kriege nach sich zieht.«
»Und doch akzeptieren Sie diese Situation, die ein getreues Spiegelbild Ihres Metiers ist?«
»Ich nehme sie als eine Tatsache, als die notwendige Tatsache meiner Existenz schlechthin. In diesem Sinne muß ich sie annehmen.«
»Ist sie notwendig, weil sie nun einmal so ist oder weil Sie, Amberley-san, sie so wollen?«
»Ich wünschte, ich wüßte die Antwort.«
»Der Wunsch genügt nicht. Man muß sich in die Lage versetzen, in der man die Antwort finden kann.«
Das war ein Tadel. Ich wußte es und ich mußte ihn annehmen, weil ich der Schüler war und er der Lehrer. Aber das fiel mir schwer, weil ich auf einer anderen Ebene ein wichtiger Mann war, den der Präsident einer großen Nation beauftragt hatte, in den Lauf der Geschichte einzugreifen. Mein Stolz verlangte nach Befreiung vom suggestiven Einfluß des alten Mystikers. Aber es gab noch eine andere Stimme, die sagte: Bleib hier. Ohne ihn wirst du dich selbst zerstören.
Mein Lehrer schwieg. Seine Augen ruhten auf einem Garten, der mir verborgen war. Die Stille der Kontemplation lag auf seinem Gesicht. Auch ich fühlte mich körperlich und geistig in die Haltung der Meditation versetzt. Meine Aufmerksamkeit richtete sich auf den kleinen Wirbel warmer Luft über dem Holzkohlenbecken. Allmählich löste sich mein Geist von der vorausgegangenen Unterhaltung und erhob sich ins freie Reich der Assoziation. Plötzlich hörte ich ihn wieder:
»Schade, daß Sie die Frage vom Kuckuck noch nicht beantwortet haben.«
»Ich habe viel über sie nachgedacht, aber ich verstehe sie immer noch nicht.«
»Auch jetzt nicht?«
»Auch jetzt nicht.«
»Lassen Sie uns von neuem nach der Antwort suchen. Warum kommen Sie zu mir?«
»Um das Schweigen zu hören.«
»Haben Sie das Schweigen gehört?«
»Manchmal.«
»Haben Sie den Kuckuck gehört?«
»Wie könnte ich. Der Kuckuck schweigt, wenn der Winter kommt.«
»Aber Sie sind gekommen, um das Schweigen zu hören. Warum läßt sich das Schweigen des Kuckucks nicht hören?«
»Ich hatte keine Möglichkeit, ihn zu fragen.«
»Aber Sie haben das ganze Jahr auf sein Lied gewartet?«
»Ja.«
»Und wenn Sie es hören, werden Sie wissen, daß der Frühling gekommen ist?«
»Ja.«
»Also verstehen Sie den Kuckuck?«
»Ja.«
»Fürchten Sie, daß er Sie nicht verstehen könnte?«
»Ich weiß, daß er mich nicht verstehen wird.«
»Wissen Sie es wirklich oder sträuben Sie sich nur, es zu erfahren?«
»Ich sträube mich, es zu erfahren.«
»Warum?«
»Weil ich dem Kuckuck nie vertraut habe.«
»Glauben Sie, daß der Kuckuck Ihnen vergeben wird?«
»Ich hoffe es.«
»Was werden Sie tun, wenn man Ihnen befiehlt, den Kuckuck zu töten?«
»Warum sollte man mir befehlen, den Kuckuck zu töten?«
»Weil er im Winter nicht singen will.«
Da stand ich wieder, ganz am Anfang, vor dem Tor, das ich längst durchschritten zu haben glaubte. Meine Enttäuschung blieb dem alten Mann nicht verborgen. Er gab den feierlichen Tonfall des Mondo auf. Seine Stimme klang freundlich und natürlich, als er sagte:
»Vergessen Sie nicht, daß das, was Sie suchen, ein ›Inneres‹ ist. Es wird keine genauen Antworten für das ›Äußere‹ haben, in dem Sie befangen sind. Was Sie tun müssen, um als Botschafter erfolgreich zu sein, wird es Ihnen nicht sagen können, auch nicht, wie man Probleme löst, indem man sie in andere verwandelt. Nur eins kann es Sie lehren: daß das Geheimnis des Lebens, Überlebens und Freiwerdens im einzelnen Menschen liegt und nicht in der Masse. Das bedeutet, daß alles, was Sie oder irgendeiner tun kann zur Besserung der Welt, durch das ›Innere‹ geschehen muß …« Hier brach er ab und lächelte mich an.
»Ich will Sie nicht verwirren«, sagte er, »Weisheit wächst wie eine Blume, die aufblüht, wenn wir nicht hinschauen. Schreiben Sie mir! Ich werde an Sie denken. Und wenn Sie zurückkommen, besuchen Sie mich!«
»Ich werde zurückkommen. Ich danke Ihnen.«
Immer noch war die Frage unbeantwortet. Keine Erleuchtung war mir zuteil geworden, nur tiefere Unzufriedenheit und dunkle Ahnung. Aber eins hatte ich begriffen: Meine Beziehung zu Muso Soseki war Wirklichkeit. Er, der Meister, nahm teil an meinem Leben wie ich an dem seinen. Er fühlte Verantwortung für mein Ergehen und Handeln. An mir war es, ihm Ehre zu erweisen. Seit jenem Winter ist viel Wasser, blutiges Wasser, unter den Brücken dahingeflossen. Ich bin zurückgekehrt in den Garten von Tenryu – ji und habe versucht, den Sinn meiner öffentlichen Triumphe und meines privaten Verrats zu ergründen. Noch jetzt kann ich nicht begreifen, warum die phantastische Frage nach dem Kuckuck mich so tief erregen konnte, während Festhammers Schlußworte vor meiner Abreise nach Saigon mich kaum berührten.
»Nicht mehr lange, Max«, sagte er, »dann wird jemand Phung Van Cung und seinen Clan stürzen und eine neue Regierung bilden. Vor dem Aufstand wird man dich fragen, was du davon hältst und ob du die neuen Leute im Namen der Vereinigten Staaten zu unterstützen bereit bist. Du wirst ihnen antworten müssen, Max, und du wirst die Antwort vor deinem Minister und dem Präsidenten verantworten müssen. Viel Glück und angenehme Reise!«
Hundert Meilen vor der Küste Vietnams empfing uns ein Geschwader von Kampfbombern und nahm uns in die Mitte. Wir überflogen das riesige Delta des Mekong-Flusses, der sich in breit ausgefächerten Wasserläufen zwischen weiten Reisfeldern und Plantagen, verstreuten Attap-Dörfern und einem Gewirr von Dämmen und Kanälen ins seichte Gewässer der Astrolabe-Banks ergießt.
Man flog diese Route, um mir erste Eindrücke von der militärischen Lage zu vermitteln. Im Deltagebiet fanden die härtesten Kämpfe dieses Krieges statt. Der Mekong war die Hauptversorgungsader der Guerillas im Inland. Er trug, unter Reissäcken und Bananenbündeln verborgen, Waffen und Ausrüstungsgegenstände aus Laos und Kambodscha landeinwärts. Frauen und Kinder, Stammesälteste und Khmers von der Grenze paddelten die Kähne durch das Gewirr der Wasserstraßen. Zu Wasser kamen und gingen auch Guerillakämpfer, frei wie die Fische in ihrem Element. Was in den Köpfen der kleinen braunen Menschen vorging, die ihren Reis pflanzten, Matten aus Palmfasern flochten und auf dem Dorf markt Zuckerrohr verkauften – wer wollte das ergründen?
Unter den Strohdächern der Dörfer, innerhalb des engen Familienverbandes, wütete der Bürgerkrieg mit seiner ganzen Gemeinheit und Brutalität. Nachts verschanzten sich die Dorfbewohner mit ihren Vorräten hinter Bambuswällen. Jede Familie stellte eine Laterne und einen Wächter. Durch Bambusgehölze und Reisfelder schlichen sich die Vietcongs heran. Oft waren der Mann auf der Schanze und der unten im Morast Brüder oder Vettern, und so kam es vor, daß eine Laterne erlosch und eine Hand verstohlen dem Feind über den Wall half. Reis und Medikamente für die Verwundeten gelangten nach draußen, und es gab Nächte, in denen der Gottesfrieden der Untätigkeit Freund und Feind gleichermaßen beschützte. Im Bananendickicht schliefen die Vietcongs ebenso friedlich wie die Bauern hinter ihrem Bambuswall. Militärisch gesehen war das Ganze ein Alptraum. Was die Landbevölkerung betraf, so paßte sie sich den wechselnden Umständen an, um wenigstens das Leben zu retten, das einzige, was geblieben war, nachdem der Bürgerkrieg die jahrtausendealte Ordnung der Familie gesprengt hatte.
In der sicheren Höhe der fünftausend Meter zogen wir unsere Kreise über dem Deltagebiet. Ein Major der Luftwaffe zeigte uns eine kleine Stadt, die er Tran Vinh nannte. Über ihr hingen wie rüttelnde Raubvögel die Hubschrauber. In der Tiefe erschienen die Kondensstreifen der Raketen und hier und da das Aufblitzen von Einschlägen. Aus winzigen Baumgruppen stiegen Wolken schwarzen Rauches. Menschen sahen wir nicht, nur ein wimmelndes Durcheinander, und wir hörten keinen Laut außer dem hohen Heulton unserer Düsenmotoren.
Zehn Minuten später drehten wir nach Norden ab und glitten sachte in Richtung Saigon nieder. Als wir uns dem Flughafen näherten, löste sich die Eskorte, und wir tauchten ungemütlich rasch und steil dem Rollfeld entgegen. Der Luftwaffenmajor hatte dafür eine trockene Erklärung: Es war vorgekommen, daß landende Flugzeuge von Vietcongs in den Vororten Saigons mit Gewehren beschossen wurden.
Während die Maschine aufsetzte und der Halle entgegenrollte, wurde uns klar, daß wir uns inmitten eines bewaffneten Lagers befanden. Rund um den Flugplatz standen Hubschrauber und Kampfbomber. Zu meinem Empfang waren eine US-Ehrengarde und eine Einheit vietnamesischer Fallschirmjäger in Tarnanzügen und Baretts angetreten. Generale in voller Uniform eskortierten den Außenminister. Auch die Beamten unserer Botschaft befanden sich in militärischer Begleitung, an der Spitze der Chef unserer Streitkräfte, General Tolliver. »Man empfängt Sie wie einen General, nicht wie einen Botschafter«, flüsterte George Groton mir zu, »möchte nur wissen, wer diese Show aufgezogen hat.«
Ich tippte auf Raoul Festhammer. Diplomatisches Theater war seine Stärke. Aber man ließ mir keine Zeit, diesen Gedanken weiter zu verfolgen. Der Protokollchef hatte sich meiner bemächtigt und steuerte mich im Eiltempo durch die Empfangszeremonien, die bei aller Herzlichkeit kurz, fast gehetzt wirkten. Ich spürte die Spannung und den unausgesprochenen Wunsch, mich so schnell wie möglich vom Flugplatz wegzukomplimentieren. Wohin ich mich wandte, überall war ich von Bewaffneten umgeben. General Tolliver saß neben mir im Auto, und während wir den breiten Boulevard hinauffuhren, der vom Flugplatz zur Stadt führt, waren wir an allen Seiten von bewaffneten Fahrzeugen umgeben. Nach dem gedämpften Zeremoniell meines Dienstes in Japan traf mich dieser Empfang wie ein Schock. Ich reagierte auf eine Weise, die mir selbst unerwartet kam: mit einer Erregung fast sexueller Art. Als enthielte diese Schaustellung militärischer Macht, dieser Geruch nach Gefahr und physischer Bedrohung einen direkten Appell an meine Männlichkeit. Es machte mir tatsächlich Spaß, wie ein hoher Offizier und nicht wie ein Zivilist empfangen zu werden. Schließlich war ich hier, um zu handeln, um Kräfte in Bewegung zu setzen und zum Erfolg zu führen. Ein Schwindel überkam mich. Ich hatte Lust, aufzustehen, mich über Tollivers Leute, die mich in ihrer Mitte wie ein Heiligtum behüteten, zu erheben, dem Volk auf der Straße als Befreier zu erscheinen, als einer, der ausgesandt war, ihre Ketten zu zerbrechen.
Ein Blick auf dieses Volk ernüchterte mich augenblicklich. Die Passanten hatten kaum einen Blick für mich und meine waffenstarrende Eskorte. Sie drängten sich nicht an den Straßenrand, schwenkten keine Fähnchen, schrien dem neuen Erlöser kein Hosianna entgegen. Sie sahen nur einmal kurz herüber, dann wandten sie die Blicke ab. Ihre kleinen intelligenten Gesichter blieben starr, wie aus Holz geschnitzt. Gleichmütig trotteten Kulis mit ihren an Bambusstangen baumelnden Körben vorüber. Ein kahlrasierter Mönch im safranfarbenen Kleid trug die Bettelschale vor sich her, eine Frau legte Reiskuchen und Früchte hinein. Eine alte chinesische Amah zog eine Traube hübscher, aufgeputzter Kinder hinter sich drein. Die Polizisten an den Kreuzungen zeigten leere Gesichter und viel Geschick im Dirigieren des Verkehrs. Wie leuchtende Vögel huschten auf dem Rücksitz von Motorrollern Mädchen im Damensitz vorüber, gekleidet in seidene Hemden und Hosen. Die Damen in den Rikschas hielten sich steif und vornehm wie Prinzessinnen aus uraltem Geblüt, sie zeigten unbewegliche, fast finstere Gesichter unter Hüten aus geflochtener Palmfaser.
Sie wirkten nicht feindlich, eher vorsichtig oder desinteressiert, gleichgültig gegen Eindringlinge, die an den uralten Überlieferungen ihres Lebens doch nur wenig ändern würden. Viele Herren waren gekommen und gegangen: Chinesen, Mongolen, Portugiesen, Holländer, Engländer, Franzosen, Japaner – nun also die Amerikaner. Auch sie würden gehen wie alle anderen. Nichts war endgültig in diesem gewaltigen, ständig in Umwälzung und Neugestaltung befindlichen Erdteil Asien. Immer noch waren die Menschenströme in Bewegung, wanderten die Stämme aus öden Gebirgen und Wüsten in die Täler hinab, verlockt von den Reisfeldern des Deltas, von den Wasserstraßen, von den Inseln mit ihren kostbaren Gewürzen und Edelsteinen.
Immer wieder würde es ein Morgen geben in diesem Asien, in dem die Männer sich ihrer Zeugungskraft rühmten und die Frauen es für eine Ehre hielten, fruchtbar zu sein. Trotz Hunger, Cholera, Ruhr und Pocken wuchsen die Stämme von Jahr zu Jahr. Das Reich der Mitte drängte von innen gegen seine Grenzen und streckte gierige Fühler nach den Reisfeldern und den Straßen aus, die zur Südsee führten.
Im Zeichen dieses Morgens erschien mir Saigon mit seinen schattigen Boulevards, den luxuriösen Villen und diesem Hauch französischer Eleganz ebenso flüchtig und fehl am Platze wie ich selbst. Plötzlich drang ein Schwall bewegter Farbigkeit in mein Blickfeld. Drei Mönche traten vor den Eingang einer Pagode mit leuchtendblauen Platten, geschwungenen Dachrändern und goldenem Schnitzwerk. Zwei von ihnen, junge Männer, führten einen Alten zwischen sich zum Rand des Gehsteiges. Dort breiteten sie einen kleinen Teppich aus und halfen ihm beim Niedersetzen. Einer von ihnen stellte ein großes irdenes Gefäß neben ihn. Sie verbeugten sich ehrfürchtig und zogen sich ins Innere der Pagode zurück. Uns entgegenblickend, erstarrte der alte Mönch zu statuenhafter Unbeweglichkeit.
Wir waren noch nicht auf seiner Höhe angelangt, als er das Gefäß mit beiden Händen ergriff und über seinen Kopf entleerte, als vollführte er eine rituelle Waschung. Die Füssigkeit floß ihm über Gesicht und Schultern auf sein gelbes Gewand und die Matte, auf der er saß. Er stellte das Gefäß behutsam nieder, griff in die Falten seines Gewandes und zog ein Feuerzeug heraus. Als er es betätigte, gab es eine dumpfe Explosion, und sein Gewand ging in Flammen auf.
In diesem Augenblick hatten wir ihn erreicht. Ich spürte die Glut der Flammen und roch verbranntes Fleisch. Menschen rannten schreiend vorüber. Die Polizei trieb sie mit Stöcken und Gewehrkolben zurück. Unser Wagen tat einen Sprung vorwärts. Als ich zurückblickte, hielt ich das Gesicht des Mannes einen letzten schwebenden Moment mit den Augen fest. Es war mit Flammen bedeckt und von Flammen gekrönt. Seine Augen waren geschlossen. Das Lächeln Buddhas lag auf seinen Lippen. So wartete er, ohne Laut und Bewegung, daß das Feuer ihn verzehre.