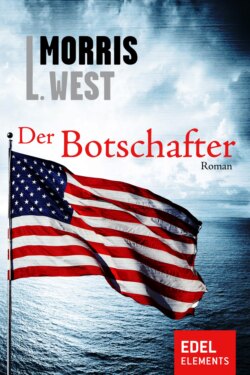Читать книгу Der Botschafter - Morris L. West - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Drittes Kapitel
ОглавлениеImmer noch dröhnte der Gong, als wir mit flatternder Botschaftsstandarte durch die nächtliche Stadt rasten. Wenn der Wagen hielt, hörten wir von fern Gewehrfeuer. Mel Adams wies auf Militärlastwagen an allen Kreuzungen und auf die Posten, die in kurzen Abständen die Straße entlang aufgestellt waren.
»Cung ist ein guter Taktiker. So wie hier ist ganz Saigon mit Militär gespickt.«
Am Tor der Botschaft wartete Harry Yaffa. Er schlüpfte in den Wagen und schlug die Tür hinter sich zu. Sein Gesicht wirkte verfallen vor Müdigkeit und Überanstrengung.
»Sie stürmen die Xa-Loi-Pagode und drei, vier andere Pagoden in der Stadt, das gleiche geschieht in Hue, Dalat und Da Nang. Sie sollten sich das ansehen, Sir!«
»Gut.«
Zum erstenmal seit meiner Ankunft wurde Mel Adams lebendig. »Ich halte das für undiplomatisch, Sir!« sagte er scharf. »Wenn Sie sich hier zum Augenzeugen machen, müssen Sie die Vorgänge ohne diplomatische Vorbehalte öffentlich verurteilen, und damit haben Sie sich festgelegt. Die Presse wird zur Stelle sein. Man wird Sie fotografieren, und in den Zeitungen erscheinen Sie dann als passiver Zuschauer eines Terroraktes der Polizei.«
»Ist das vielleicht schlimmer, als morgen mit Informationen aus zweiter Hand im Palast zu erscheinen?« fragte Yaffa. »Cung hat diese kleine Show zu Ehren unseres Botschafters aufgezogen. Seien Sie doch nicht so zimperlich, Mel. Weiße Handschuhe sind hier nicht am Platze. Wir sind im Krieg.«
»Ich habe meine Meinung gesagt«, sagte Mel Adams steif. »Auch im Krieg braucht man Raum zum Taktieren, aber wir sind eben im Begriff, ihn zu verspielen.«
Ich mußte mich einschalten, um zu verhindern, daß sich beide Männer in diesem Streit kompromittierten.
»Sie haben recht, Mel, es ist ein Risiko. Ich nehme es auf meine Kappe. Fahren wir!«
Sogleich trat Bill Slavich auf den Gashebel, der Wagen kurvte um die nächste Ecke und schoß mit höchster Geschwindigkeit in Richtung der Xa-Loi-Pagode.
Das Gewehrfeuer wurde stärker. Als wir näher kamen, vernahmen wir Schreie, Ausrufe und das zornige Gemurmel einer Menschenmenge. Hinter den Barrikaden, die alle Zugänge des Tempels sperrten, hatten sich Polizisten des Überfallkommandos mit automatischen Gewehren und Gaspistolen verschanzt. Sie trieben die vordringende Menge mit Kolben zurück.
Als unser Wagen schleudernd zum Stehen kam, stürzten zwei Polizisten auf uns zu, entdeckten plötzlich die Standarte und zogen sich rasch zurück. Yaffa und ich kletterten auf das Wagendach.
Über die Köpfe der Menge hinweg sahen wir, daß die Tore der Pagode aufgebrochen waren; die Polizisten hatten ihre Wagen davor aufgestellt. Eben stießen sie eine Gruppe gelbgekleideter Männer ins Freie. Die Mönche waren böse zugerichtet, einer blutete aus einer schweren Schädelwunde. Hinter ihnen schleifte ein junger Polizeioffizier eine kreischende, um sich schlagende Nonne herbei.
Plötzlich gellte ein Schrei aus dem oberen Stockwerk. Ein Mönch taumelte aus dem Fenster und stürzte in den darunterliegenden Hof. Im Inneren der Pagode hallten Schüsse und die dumpfen Explosionen der Tränengasgeschosse. Die Menge brach in Drohungen und Flüche aus. Aus ihrer Mitte lösten sich zwei Presseleute und rannten zu uns herüber. Einer von ihnen hob die Kamera und schoß eine Blitzlichtaufnahme von mir auf dem Wagendach. Sein Begleiter stellte sich vor: »Cavanna, Associated Press. Sie sind Mister Amberley, nicht wahr?«
»Der bin ich.«
»Können Sie einen Kommentar zu diesem Vorfall abgeben?«
»Ich sehe brutale Gewalt und beklage sie in meiner Eigenschaft als Vertreter der Vereinigten Staaten von Amerika. Kein weiterer Kommentar, bis ich die Angelegenheit mit Präsident Cung besprochen habe.«
»Heute morgen hat sich ein buddhistischer Mönch verbrannt, heute nacht stürmt man die Pagoden, beides am Tage Ihrer Ankunft. Haben Sie einen Kommentar für die Wahl des Zeitpunktes?«
»In meiner Pressekonferenz um zwei Uhr nachmittags werde ich eine Erklärung abgeben. Für jetzt ist das alles.«
An den Barrikaden brachen neue Unruhen aus. Eine Flasche flog durch die Luft, dann folgte ein Regen von Stöcken und Steinen. Die Polizisten brachen aus der Deckung hervor und trieben die Menge brutal zurück. Schädel krachten unter Gewehrkolben. Ein junges Mädchen fiel und wurde von den Zurückweichenden überrannt. Ein Polizist hob sie auf und trug sie zum Polizeiwagen. Immer weiter rückwärtsflutend näherte sich die Menge unserem Wagen.
»Wir müssen hier weg!« schrie Yaffa. Wir flüchteten ins Innere des Wagens, der mit kreischenden Reifen eine Ecke nahm. Dann waren wir in Sicherheit auf dem Gelände der US-Aid-Mission, das direkt an das Grundstück der Pagode anschloß. Das ganze Personal war in Morgenröcken und Pyjamas auf den Beinen. Eine junge Frau versorgte die Wunden eines Mönches, dem ein Bajonett das Gesicht aufgeschlitzt hatte. Ein anderer Mönch krümmte sich an der Gartenmauer und betastete wimmernd seine zerschmetterte Kinnlade. Einer vom Pflegepersonal hielt mich auf. »Das ist Mord«, rief er, »blutiger Mord. Können Sie nichts dagegen tun, Sir?«
»Nein!« schrie Yaffa ihn an. »Nehmen Sie sich zusammen. Schaffen Sie die Mönche ins Haus und sagen Sie den Posten: Wenn jemand versucht, hier einzudringen, sofort schießen! Rufen Sie General Tolliver an. Sagen Sie ihm, was passiert ist. Er soll einen Arzt und ein Sonderkommando zur Verstärkung der Wachen schicken.« Dann wandte er sich an mich: »Wenn Sie genug gesehen haben, fahren wir Sie zur Botschaft zurück.«
Ich hatte genug gesehen. Die Sinnlosigkeit der Szene versetzte mich in Wut. »Sie bleiben hier«, sagte ich zu Mel Adams. »Besorgen Sie sich alle Informationen über den Vorfall und berichten Sie mir, sobald Sie in die Botschaft zurückkommen. Die beiden Priester stehen unter dem Schutz unserer Regierung. Auskünfte erteilt nur die Botschaft.«
Adams nickte und sagte: »Am besten benachrichtigen wir alle anderen Botschaften.«
»Das mache ich schon«, sagte George Groton. »Brauchen Sie noch jemanden in der Botschaft?«
»Schicken Sie mir Miß Beldon und die Ressortchefs. In den nächsten Stunden gibt es eine Masse zu tun. – Kommen Sie mit, Mr. Yaffa?«
»Ich habe selbst genug am Hals«, sagte er grimmig. »Bill Slavich fährt Sie zurück. Sobald ich mich frei machen kann, komme ich vorbei.«
Auf der Fahrt durch die von Militär wimmelnden Straßen versuchte ich, meiner Wut Herr zu werden und die Ereignisse der letzten zwölf Stunden zu überdenken. Zweifellos hatte man diesen Zeitpunkt gewählt, um meinem Ansehen zu schaden und meine Verhandlungsposition dem Präsidenten gegenüber zu schwächen. Ich hatte lange genug im Osten gelebt, um zu wissen, was es bedeutet, das Gesicht zu wahren oder zu verlieren. Meine Berufung hatte Cungs Ansehen beeinträchtigt. Als echter Orientale konnte er gar nicht anders reagieren als durch den Versuch, auf meine Kosten sein Prestige wiederherzustellen. Aber zweifellos waren noch andere Dinge im Spiel, die ich jetzt noch nicht überblicken konnte. Jedenfalls durfte ich mich in dieser Sache nicht zu rasch festlegen.
Präsident Cung war als Politiker zu klug, als daß er eine solche Schaustellung der Macht nur um seiner eigenen Geltung willen inszeniert hätte. Was er auch unternahm, es würde immer den Stempel des Mannes tragen, der sein Land aus der Katastrophe von Dien Bien Phu herausgeführt hatte, der fast eine Million Flüchtlinge angesiedelt, die Wirtschaft stabilisiert, die Macht der Flußpiraten gebrochen hatte – jener Binh Xuyen, die seinerzeit mit fünftausend Soldaten und der ganzen Polizeimacht Saigons operierten. Er hatte ein Dutzend Konspirationen überlebt und eine abenteuerliche Sammlung von bewaffneten Sektierern, kriegerischen Aristokraten und militärischen Verschwörern unter seiner Herrschaft vereinigt. Er hatte es erreicht, daß die Vereinigten Staaten Material für seinen Krieg gegen Ho Chi Minh lieferten, daß sie seine Armee ausbildeten und zu einer schlagkräftigen Truppe machten.
Cung war Philosoph und Politiker zugleich. Er ließ sich in seinen Entschlüssen nicht von primitiven Beweggründen leiten. Kein Mensch mit gesundem Menschenverstand würde doch versuchen, einen Krieg zu gewinnen, indem er achtzig Prozent seines Volkes unterdrückte. Cung mußte schon einen glaubhaften Grund für die Repressalien haben, die in den Mönchen die Elite des buddhistischen Glaubens trafen.
Unter Festhammers Papieren war ein Bericht der CIA gewesen, in dem vom Einsickern kommunistischer Agenten in den buddhistischen Mönchsorden Sangha die Rede war, und zwar sowohl in Thailand, Laos, Kambodscha als auch in Südvietnam. Es hieß darin, daß in Thailand, wo der Buddhismus des Hinayana – des »Kleinen Fahrzeugs« – gelehrt wurde und der Orden Sangha unter dem Patronat des Königshauses stand, die Infiltration von oben gesteuert werden könne. Viel schwieriger war die Kontrolle bei der lockeren, verschwommenen Disziplin des Mahayana – des »Großen Fahrzeugs« –. Junge aggressive Kräfte gewannen mehr und mehr die Oberhand über die kontemplativen älteren Mönche. Das gelbe Gewand bot sichere und leicht zu erlangende Tarnung für umstürzlerische Elemente, die sich frei in den Pagoden und inmitten des Volkes bewegten.
Das war Cungs Argument, das er vor jedem Forum erfolgreich ins Feld führen konnte. Nach den Unruhen in Hue, bei denen neun Menschen ums Leben gekommen waren, hatten buddhistische Mönche in öffentlichen Versammlungen gegen die Regierung polemisiert. Das konnte in einem Lande, das sich im Kriegszustand befand, nun einmal nicht geduldet werden, und scharfe Sicherheitsmaßnahmen schienen durchaus berechtigt. Andererseits war ein Terror, wie der an der Xa-Loi-Pagode, eine politische Fehlleistung, von der ich mich als Botschafter der Vereinigten Staaten distanzieren mußte.
In der Botschaft erwartete mich eine neue Überraschung. Ein älterer Mönch war seinen Verfolgern knapp entkommen und hatte, gedeckt von den Gewehren der amerikanischen Marineposten, in unserer Botschaft Schutz gesucht. Er sprach nicht englisch, und wir unterhielten uns fast eine Stunde auf französisch. Anne Beldon schrieb seinen Bericht über den Sturm auf die Xa-Loi-Pagode mit.
Ich fand diesen Mann nicht sehr überzeugend. Er war schlecht informiert, und was er zu sagen hatte, erschien mir unsachlich und oberflächlich. Die Pagodenrazzia schilderte er genau, aber als ich ihn über den Charakter des vietnamesischen Buddhismus, seine Geschichte und Organisation, seine Haltung und seine Probleme befragte, antwortete er mit allgemeinen Phrasen, die mit wilden Anwürfen gegen die Familie Cung gewürzt waren. Er schien mir weit besser in die Rolle eines Agitators als in die eines religiösen Märtyrers zu passen. Vergleiche zwischen seiner hemmungslosen Wut und Muso Sosekis eherner Selbstbeherrschung drängten sich auf. Immerhin lieferte er mir zwei wichtige Informationen. Die Polizei hatte bei ihrer Razzia eine Liste mitgeführt, auf der die Namen kommunistischer Verschwörer im Mönchsgewand verzeichnet waren. Die Asche des Mönches, der sich am Morgen verbrannt hatte, war beschlagnahmt worden, das Gefäß mit dem verkohlten Herzen war jedoch verschwunden. Als versierter Christ konnte Cung keine Märtyrer brauchen.
Inzwischen kamen Anrufe aus anderen Gegenden des Landes. In Hue hatten die Soldaten eine Pagode überfallen und den Tempelschatz geraubt. Um die Brücke zu einem anderen Tempel war eine regelrechte Schlacht entbrannt, in der dreißig Personen getötet und einige hundert verwundet wurden. Man schätzte die Zahl der im ganzen Land Inhaftierten auf etwa tausend.
Ich verfaßte einen Bericht für Washington und weitere Berichte für die Vertreter der Vereinigten Staaten in Laos, Kambodscha und Thailand. Um sechs Uhr morgens, wir waren immer noch an der Arbeit, kam plötzlich die Stimme Präsident Cungs über Radio Saigon. Er verhängte Belagerungszustand und Kriegsrecht über das ganze Land und gab der Armee die Vollmacht, verdächtige Personen zu durchsuchen und zu verhaften. Eine Sperrstunde wurde festgesetzt, und alle Nachrichten wurden einer staatlichen Zensur unterworfen.
Bevor Cung seine Rede beendet hatte, erschien Harry Yaffa mit der Nachricht, daß Saigon in der Gewalt der Regierungstruppen sei. Die Ausfahrtswege seien gesperrt, die Telefonverbindungen unterbrochen. Unser Draht war noch frei, aber offiziell war Südvietnam von der übrigen Welt abgeschnitten. Raschheit und Gründlichkeit der Aktion ließen keinen Zweifel an dem Schluß zu, daß sie lange vor meiner Ankunft geplant War, um eventuellen Angriffen von unserer Seite gegen Cung zuvorzukommen. Die Folgen waren unübersehbar. Es mußte sofort etwas unternommen werden. Anne Beldon brachte mir das Frühstück, bestehend aus schwarzem Kaffee und Keks. Ich rasierte mich rasch mit einem geliehenen Rasierapparat und begab mich mit Mel Adams und dem Protokollbeamten der Botschaft zum Palast. Alle Zugänge waren mit Barrikaden versperrt. Wir brauchten eine Viertelstunde, bis wir die ersten Kontrollen hinter uns hatten.
Die Atmosphäre im Innern des Palastes war still und feierlich. Ein vietnamesischer Sekretär bat uns mit betonter Höflichkeit, eine Weile zu warten, der Präsident sei mit Arbeit überlastet, und es sei noch eine Stunde bis zum vereinbarten Termin. Kühl gab Mel Adams zurück, daß aus Gründen des nationalen Notstandes, der auch die Vereinigten Staaten als Bündnispartner Vietnams beträfe, der verfrühte Besuch des Botschafters eine besondere Höflichkeit gegen den Präsidenten bedeute. Der Sekretär versicherte, daß der Präsident diese Höflichkeit zweifellos zu schätzen wisse und sobald wie möglich erscheinen werde.
Grüner Tee und Zigaretten wurden gereicht. Natürlich hatte auch diese Wartezeit mit dem Wahren des Gesichtes zu tun. Ich setzte uns eine Frist von zehn Minuten. Wenn der Präsident mich bis dahin nicht rufen ließ, würden wir aufbrechen.
Nach acht Minuten fünfzehn Sekunden durchschritt ich die Tür des Audienzzimmers und stand dem Präsidenten zum erstenmal gegenüber, einem zierlichen dunkelhäutigen Mann in einem rohseidenen Anzug, der eine Brillantnadel im grauen Seidenschlips trug.
Er begrüßte mich in einem stark akzentgefärbten Französisch. Der Diener brachte den unvermeidlichen grünen Tee. Unentwegt lächelnd erkundigte sich der Präsident nach meiner Gesundheit und ob ich eine gute Reise gehabt hätte. Seine glänzenden dunklen Augen durchforschten mein Gesicht nach Zeichen innerer Erregung, während er mit herzlichen Worten meines Vorgängers gedachte und mich bat, ihm Grüße und Wünsche auszurichten. Über meine Tätigkeit in Japan äußerte er sich anerkennend und sprach mir zum Tode meiner Frau sein Beileid aus.
Es habe ihn besonders interessiert, zu hören, daß ich ein Schüler des Zen sei, sagte er, zweifellos würde diese Tatsache mir zu einem besseren Verständnis der Situation in Südvietnam verhelfen.
Der Schuß saß! Ich hatte nicht erwartet, ihn so gut informiert zu finden. Meine Betroffenheit entging ihm sicherlich nicht, aber er ließ sich keine Spur von Triumph anmerken, sondern fuhr ruhig fort: er hoffe, daß die neue Tätigkeit mir Befriedigung verschaffen werde. Wenn ich persönliche Dienste irgendwelcher Art benötige, bäte er mich, ihn oder seinen Stab davon in Kenntnis zu setzen. Er bedauere es tief, daß meine Ankunft nicht auf einen glücklicheren Tag gefallen sei, doch sei er sicher, daß ich Verständnis für den gegenwärtigen Notstand aufbrächte.
Ich sagte, dessen sei ich durchaus nicht so sicher, jedoch verspräche ich mir von unserer Unterhaltung Aufklärung und Erleuchtung.
Damit hatten wir die Höflichkeitsbezeigungen absolviert und konnten zur Sache kommen. Cung lehnte sich im Stuhl zurück, faltete die Hände vor der Hemdbrust und lieferte mir eine beredte Darstellung der Lage:
»Herr Botschafter! Sie kommen aus einem friedlichen Land in ein Land, das Krieg führt. Bei uns findet keine japanische Teezeremonie statt. Es geht um das Überleben dieses Volkes, das von außen und von innen bedroht ist. Innerhalb unserer Grenzen befinden sich schätzungsweise dreißigtausend voll ausgebildete Vietcong, die von etwa sechzigtausend Partisanen und Untergrundagenten unterstützt werden. Die Agenten sind angewiesen, jedes Mittel zu gebrauchen, um in Schlüsselstellungen einzudringen und Verwirrung zu verbreiten. Von gewissen buddhistischen Klöstern aus wird Spionage betrieben und eine Rebellion vorbereitet. Was würden Sie tun, wenn Sie in meiner Lage wären: Würden Sie einfach zusehen, wie Agenten im Schutz des Mönchsgewandes für Ho Chi Minh arbeiten? Wie sie in ihren Bettelschalen Pistolen, Munition und Botschaften herumtragen? Für so naiv halte ich Sie nicht, Herr Botschafter. Ich weiß, daß ich in der ausländischen Presse als Despot dargestellt werde. Das entspricht nicht der Wahrheit. Ich wäre doch ein Narr, wenn ich in einem Land, das sich im Krieg befindet, Religionsstreitigkeiten unterstützen würde. Ich gebe zu, daß von Beamten und anderen Fehler gemacht wurden, wie zum Beispiel die Gewaltmaßnahmen in Hue, aber ich war bereit, sie zu korrigieren und mit der Generalversammlung der Buddhisten in freundschaftliche Verhandlungen zu treten. Ich forderte sie auf, mir ihre Beschwerden und das, was sie für ihre rechtmäßigen Ansprüche halten, vorzulegen. Aber was geschah? Als Vorleistung verlangten sie von mir ein demütigendes Eingeständnis persönlicher Verantwortlichkeit, dessen einziger Zweck war, mich in Mißkredit zu bringen. Ich weigerte mich, war aber weiterhin entschlossen, mit ihnen im Gespräch zu bleiben, und während diese Verhandlungen noch im Gang waren, hielten Mönche in öffentlichen Versammlungen aufrührerische Reden und forderten den Sturz der Regierung. Nicht einmal in Friedenszeiten kann eine Regierung so etwas durchgehen lassen. Duldet man bei Ihnen dergleichen in Little Rock, Birmingham und Washington? Was erwarten Sie von mir in einem Lande, das von einem Rebellenkrieg bis in die Grundfesten erschüttert ist? Ich wäre der falsche Mann am Platz, wenn ich tatenlos zusehen würde.«
Ich hatte gewußt, daß er diese Stellung beziehen würde, und aus seiner Perspektive erschien sie auch durchaus verständlich. Aber es gab eine andere Seite des Problems, und ich versuchte, sie ihm so ruhig wie möglich darzulegen.
»Im allgemeinen stimme ich mit Ihnen überein, Herr Präsident. In Kriegszeiten können öffentliche Unruhen nicht geduldet werden. Aber was ich gestern an der Xa-Loi-Pagode gesehen habe …«
»Ich erfuhr in der nächsten halben Stunde, daß Sie dort waren, und bedaure, Ihnen sagen zu müssen, daß ich Ihr Erscheinen für eine diplomatische Indiskretion halte.«
»Im Gegenteil, Herr Präsident, ich war dort als Vertreter meiner Regierung, die in diesem Krieg Ihr Verbündeter ist. Es ist meine Pflicht, mich so genau wie nur möglich zu informieren. Ich mußte Ausschreitungen schlimmster Art mit ansehen, berechnete, unnötige Brutalität. Das war für meine Begriffe politische Indiskretion: Sie hat sich in den letzten zehn Stunden über das ganze Land ausgebreitet. Die Reaktion der Außenwelt ist noch nicht abzusehen.«
»Lassen Sie die Außenwelt aus dem Spiel, Herr Botschafter, sie ist für uns so fern wie der Mond. Unser Land ist eine Halbinsel Südostasiens, unser Volk ist geteilt. Seit Jahrhunderten verdunkelt der Schatten Chinas unseren Himmel. China hat uns einmal erobert und will uns wieder erobern. Die Grenzen unserer Welt setzen das Meer und China. Im Westen sehen wir bis Burma, weiter nicht. Wer weint um uns in Sydney, Paris oder London?«
»Die Amerikaner weinen, Herr Präsident«, sagte ich bitter, »und sie schwitzen, um Ihre Rechnungen zu bezahlen. Sie sterben für Sie, in Ihrem Land. Was Sie gesagt haben, ist eine Beleidigung für unsere Soldaten.« Meine Worte hatten ihn beschämt, und er war klug genug, es zuzugeben. »Verzeihen Sie«, sagte er leise, »ich habe mehr gesagt, als ich wollte. Ich weiß, was wir den Vereinigten Staaten schuldig sind. Sie bringen uns Hilfe, aber sie sollten nicht versuchen, die Herrschaft an sich zu reißen oder uns nach ihrem Maß zu messen.«
»Wir sind Verbündete, Herr Präsident, das Urteil der Welt trifft uns gemeinsam. Ihr eigenes Volk wird uns für die Bluttaten der vergangenen Nacht verantwortlich machen.«
Plötzlich packte ihn die Wut. Er ergriff eine Mappe mit Fotos und stieß sie über den Schreibtisch zu mir herüber.
»Können Sie kein Blut sehen, Herr Botschafter? Dreht sich Ihr empfindlicher Magen um? Sehen Sie nur richtig hin, da ist auch Blut! So sieht es aus, wenn eine kommunistische Bombe auf einem Marktplatz explodiert, und so traktieren die Vietcong ganze Familien, wenn sie nicht tun, was sie von ihnen verlangen. So sieht es aus, wenn man schwangere Frauen mit dem Bajonett entbindet. Soll ich Leute mit Samthandschuhen anfassen, die solche Dinge anzetteln, um sich dann hinter Buddha zu verkriechen? Wir sind in Asien, Herr Botschafter, nicht in Genf oder Manhattan. Hier kann nur der die Macht behalten, der vergossenes Blut mit Blutvergießen sühnt. Als Christ verabscheue ich Gewalt, aber ich kenne mein Volk besser als Sie.«
Der Anblick der Fotos drehte mir tatsächlich den Magen um. Ich klappte die Mappe zu und gab sie ihm zurück. Gewiß wäre es das bequemste gewesen, ihm zuzustimmen, aber ich tat es nicht, konnte es nicht tun. Es galt, ihn von diesem unheilvollen Weg abzubringen, koste es, was es wolle.
»Eben weil Sie Christ sind, Herr Präsident, können Sie sich keine Brutalität erlauben. Sehen Sie nicht, daß Sie damit den Vietcong eine Waffe in die Hand spielen? Eine religiöse Minorität verfolgt die Majorität! Wollen Sie mit jedem Buddhisten Asiens einen Heiligen Krieg ausfechten? Das können Sie haben. Und für die Welt sind und bleiben Sie der starrköpfige Fanatiker.«
»In der Presse wird viel gelogen, Herr Botschafter. Und wenn sie die Wahrheit sagt, vergißt sie, die Folgen zu bedenken.«
»Sie wird nicht lügen, was die Vorgänge der vergangenen Nacht betrifft, Herr Präsident, ebensowenig wie ich lügen werde. Wenn die Presse mich heute nachmittag befragt, werde ich die Wahrheit sagen müssen, und die Wahrheit wird Sie und Ihre Regierung verurteilen. Ein einziger Entrüstungsschrei wird durch mein Land gehen: Warum sollen wir diesem Mann Waffen bezahlen und unsere Söhne für ihn in den Kampf schicken? Was soll ich ihnen antworten, Herr Präsident? Was antworte ich meinem Ministerium und meinem Präsidenten?«
»Sagen Sie ihnen die ganze Wahrheit. Lassen Sie diese Fotos veröffentlichen. Sagen Sie ihnen, daß Ihr eigener Geheimdienst einen Teil der Namen von in Klöstern versteckten Agenten geliefert hat. Setzen Sie sich in einen Hubschrauber und sehen Sie mit eigenen Augen, wo dieser Krieg ausgefochten wird: in den Dörfern und den befestigten Weilern, bei den Gebirgsbewohnern im Norden und den Deltabauern im Süden. Lassen Sie die Städte ruhig beiseite. Die Leute in den Städten sind korrumpiert. Sie kranken immer noch an den von den Franzosen zurückgelassenen Ideen oder entlehnen ihre Meinung aus der amerikanischen Presse. Wenn Saigon, Hue und Dalat über Nacht verlorengingen, würden wir dennoch weiterkämpfen. Täuschen Sie sich nicht! Ich bin immer noch Herr der Lage und habe keine Angst. Allen Zeitungen der Welt zum Trotz werden wir unsere Krankheiten überleben. Ich habe dieses Land nach Dien Bien Phu wieder aufgebaut und ich werde weiter daran bauen, mit Ihnen oder ohne Sie.«
Gegen meinen Willen beeindruckte mich der hartnäckige Mut dieses Mannes. Er saß auf dem Pulverfaß. Bajonette bedrohten ihn von allen Seiten, doch immer noch war er bereit zu kämpfen. Aber ich hatte eine Warnung zu übermitteln. Klar und präzise legte ich ihm meine Botschaft auseinander:
»Lassen Sie es nicht zur Katastrophe kommen, Herr Präsident. Ich bin beauftragt, Ihnen folgende Botschaft meiner Regierung zu überbringen: Wenn Sie nicht bereit oder imstande sind, die Spaltungen zwischen Christen und Buddhisten und zwischen Ihren Generalen und der Regierung zu beheben, werden Sie allein kämpfen müssen, ohne Geld und Waffen, ohne amerikanische Truppen.«
Zu meiner Überraschung blieb er ganz ruhig, nur seine Lippen verzogen sich zu einem dünnen Lächeln. Mit sanfter Stimme fragte er:
»Wollen Sie tatsächlich so weit gehen, Herr Botschafter? Wenn Sie sich hier zurückziehen, fallen Kambodscha, Laos und Thailand um wie die Kartenhäuser. Wir sind Ihr letzter Stützpunkt in Asien. Wollen Sie ihn preisgeben, weil ich Ihnen nichts Unmögliches versprechen kann? Sie verlangen Einigkeit, Schluß mit den Spaltungen. Mein Gott, Herr Botschafter, so naiv können Sie doch nicht sein. Wir sind als Nation zwar tausend Jahre älter als die Vereinigten Staaten, aber eine Einheit sind wir nie gewesen. Das Wesen unserer Gesellschaft ist Zersplitterung. Unser Sinn für nationale Einheit ist genausowenig entwickelt, wie er es bei den Italienern vor Garibaldi war. Unsere Bevölkerung zählt vierzehn Millionen Menschen: Viets, Thai, Muong, Yao Miao, Chinesen, Khmers und Chams. Erwarten Sie Wunder von mir? Wollen Sie mein Volk im Stich lassen, wenn ich sie nicht vollbringe?«
»Ich bin beauftragt, Ihnen zu erklären, daß wir darauf vorbereitet sind.«
Er zuckte die Schultern und lächelte wieder. »Wenigstens wissen wir jetzt, wo wir stehen. Teilen Sie Ihrer Regierung mit, daß ich die von Ihnen übermittelte Botschaft auf das ernsteste in Erwägung ziehen werde, daß ich jedoch eine Haltung, die praktisch auf ein politisches Ultimatum hinausläuft, ablehnen muß. Teilen Sie ihr weiterhin mit, ich hätte sichere Informationen, daß Ihre CIA in täglicher Verbindung mit Elementen steht, die die rechtmäßige Regierung dieses Landes stürzen und eine Militärjunta an ihre Stelle setzen wollen. Ich bitte Ihre Regierung um offiziellen Bescheid, wer hier der rechtmäßige Vertreter der Vereinigten Staaten ist: der Botschafter oder die CIA.«
Der letzte Schlag traf aus dem Hinterhalt. Scharf gab ich zurück:
»Die Antwort auf die letzte Frage können Sie sofort haben, Herr Präsident. Ich und niemand anders ist der offizielle Vertreter meiner Regierung.«
»Das freut mich zu hören. Vielleicht interessieren Sie sich dann für einen Bericht über die Tätigkeit der CIA, den ich Ihnen übermitteln werde.«
»Ich werde ihn lesen und meinen Vorgesetzten in Washington unverzüglich eine Kopie zusenden.«
»Ich bin gespannt auf Ihre und Washingtons Reaktion. Noch etwas, Herr Botschafter! Soviel ich weiß, haben drei Mönche der Xa-Loi-Pagode bei den Amerikanern Schutz gesucht. Was haben Sie mit ihnen vor?«
»Wir werden ihnen Schutz gewähren, bis wir die offizielle Zusicherung erhalten, daß sie nach dem Verlassen unseres Grundstücks in keiner Weise behelligt werden.«
»Ich werde es mir überlegen, Herr Botschafter, möglicherweise lasse ich sie wirklich bei Ihnen, was für Sie, wie Sie sehen werden, eine ziemliche Belastung bedeutet. Eine letzte Frage. Sie haben für heute nachmittag eine Pressekonferenz einberufen: Wollen Sie bei dieser Gelegenheit die Bedingungen Ihres Ultimatums bekanntgeben?«
»Noch nicht, und es wäre uns lieber, wir müßten es nie bekanntgeben. Sie haben gewiß den Wunsch, sich in Ruhe damit zu befassen. Wenn Sie mich rufen wollen – ich stehe Ihnen jederzeit zur Verfügung.«
»Ich danke Ihnen, Herr Botschafter.« Er stand auf und streckte mir die Hand entgegen. »Es war mir eine Freude, Sie kennenzulernen. Ich hoffe, daß dieses Gespräch den Anfang eines besseren Verständnisses zwischen unseren beiden Ländern darstellt.«
»Das ist auch meine Hoffnung, Herr Präsident.«
Ich verließ den Palast in einem Zustand tiefer Beunruhigung. Was mir fehlte, war Zeit zum Nachdenken und der Rat eines Mannes, der die verwirrten Verhältnisse, von denen ich soeben eine Kostprobe erhalten hatte, länger und gründlicher kannte als ich. Auf dem Heimweg ließ ich an der Botschaft halten und bat Mel Adams zu einem vertraulichen Gespräch in mein Haus. Todmüde von der durchwachten Nacht, gingen wir beide erst einmal unter die Dusche, und Mel Adams zog eines meiner frischen Hemden an. Dann setzten wir uns in mein Arbeitszimmer und gingen die Unterhaltung mit Cung Punkt für Punkt durch.
Adams erwies sich als nüchterner, urteilsfähiger Ratgeber. Er gab zu, wenn er sich unsicher fühlte, und erwog jeden einzelnen Punkt mit bewundernswerter Objektivität;
»In einer Sache stimme ich mit Cung völlig überein, Sir, es hieße tatsächlich Unmögliches voraussetzen, wenn man eine Einigung des Landes von ihm verlangte. Wenn Sie die ländlichen Gebiete kennenlernen, werden Sie verstehen, wie eng und ausschließlich die Familien- und Stammesstrukturen angelegt sind. Es besteht ein tiefverwurzeltes Mißtrauen gegen alle Außenseiter, seien es Generale, Beamte oder Ausländer wie wir. Der Buddhismus ist keineswegs eine einigende Religion. Er erlaubt den verschiedensten Lehren und Disziplinen, nebeneinander zu existieren, ohne ihre Eigenart aufzugeben. Wir im Westen halten den gesamten Buddhismus für kontemplativ und quietistisch und übersehen die gewalttätigen Tendenzen, die er ebenfalls umfaßt. Es hat innerhalb des Buddhismus auch Sekten gegeben, deren militanter Fanatismus seltsame Blüten trieb. Denken Sie nur an Soka Gakkai in Japan …
Es stimmt tatsächlich, daß die Unruhen zum Teil in den Pagoden ausgebrütet werden. Aber was bedeutet überhaupt Rebellion. Für eine große Anzahl der Vietnamesen ist Ho Chi Minh einfach Onkel Ho: ein Edelpatriot und ein erfolgreicher Revolutionär, Phung Van Cung dagegen ein vom kapitalistischen Amerika gestützter Reaktionär.
Auch wir Amerikaner tragen zur Uneinigkeit dieses Landes bei. Wir verhalten uns stur pragmatisch, verlangen kurzfristige Resultate, ohne die Konsequenzen vorher zu bedenken. Es ist uns ein Bedürfnis, präzise zu definieren, und dann hängen wir an unserer eigenen Definition fest und können uns nicht mehr rühren. Genauso steht es doch mit Quemoy und Matsu und der Legende von den beiden China. Diese Legende haben wir geschaffen, und nun kommen wir nicht mehr davon los.
Aus diesem Grunde ist mir Harry Yaffa zuwider. Er ist ein erstklassiger Geheimdienstmann, aber er handelt mir zu schnell, ohne einen Sinn für geschichtliche Entwicklungen, Kontinuität und Konsequenzen. Stellen Sie ihn vor eine beliebige Situation, er wird sich verpflichten, sie zu ändern. Das ist sein Job. Wenn eine Sache nicht klappt, startet er unverzüglich die nächste.
Handeln, handeln! Von Kind auf wird uns das eingehämmert. Steh auf, Junge, zieh gen Westen, mach dein Glück! Gold steckt in jenen Hügeln.
Sie kennen den Osten, Sir. Er scheint sich unserer Aktivität anzubieten, aber der Schein trügt. Was bedeutet dem Reisbauern Aktion? Auch der Kommunismus hat seine Philosophie. Wenn die Gewehre schweigen – was haben wir dann zu bieten? Demokratie? Selbstbestimmung? Die Stämme werden von den Ahnen beherrscht. Wie stellt man Ahnen zur freien geheimen Wahl?
Ich frage mich immer wieder, was ich tun würde, wenn ich an Cungs Stelle wäre. Ehrlich gestanden – ich weiß es nicht. Wie treibt man den Generalen die Herrschaftsansprüche aus? Wer ein Stück bekommt, verlangt sofort den ganzen Kuchen. Mit einer gleichmäßigen Verteilung von Macht und Einfluß werden diese Leute sich nie zufriedengeben. Jeder von ihnen wird unablässig versuchen zu beweisen, daß ihm mehr, daß ihm alles zukommt. Politisch gesehen ist Cungs Methode die aussichtsreichste: teilen und herrschen. Militärisch führt sie genau dorthin, wo wir uns jetzt befinden.
Nehmen wir die Buddhistenfrage. Ich bin sicher, daß Cung tatsächlich verhandeln will. Seine Bedenken sind etwa: Wenn ich ihnen den kleinen Finger gebe, reißen sie mir den Arm aus. Die Pagodenmönche sind vom Kampf mit der Waffe entbunden. Also, argumentiert Cung, haben sie kein Recht, im Rücken der kämpfenden Truppe Unruhe zu stiften. Ich finde das gar nicht so unvernünftig.«
Er lächelte bedrückt und goß sich noch eine Tasse Kaffee ein. »Mein Urteil ist nicht besonders konstruktiv, Sir«, sagte er, »aber bevor wir uns auf einen Umsturz einlassen, sollten wir uns darüber klarwerden, was wir jetzt haben. Das Ultimatum haben Sie überreicht. Was geschieht weiter?«
»Cung will mit mir in Verbindung treten, sobald er einen Entschluß gefaßt hat.«
»Was wird er tun?«
»Wenn Sie mich direkt fragen, Mel, dann kann ich es nur so formulieren: Cung muß die Buddhisten mit einer unmißverständlichen Geste in aller Öffentlichkeit zu freundschaftlichen Verhandlungen auffordern; er muß berechtigten Beschwerden stattgeben, Mißstände beseitigen, die gefangenen Mönche und Studenten freilassen. Danach steht es ihm eher zu, Gesetz und Ordnung durchzusetzen.«
»Ich glaube nicht, daß er das tun kann, Sir, jedenfalls nicht alles auf einmal.«
»Warum nicht?«
»Weil die Unruhen noch nicht vorüber sind. Im Palast erfuhr ich, daß weitere Aufstände erwartet werden.«
»Von wem? Von den Buddhisten?«
»Nein, diesmal von den Studenten. Sie wollen noch vor Einbruch der Nacht demonstrieren, und das wird nicht ohne Blutvergießen abgehen: mehr Prügel, mehr Schüsse, mehr Verhaftungen. Und was dann?«
»Die Vereinigten Staaten werden wiederum protestieren.«
»Und dann werden Tollivers Offiziere vietnamesische Truppen einsetzen, Buddhisten und Katholiken, deren Söhne und Töchter im Gefängnis sitzen. Hübsch, nicht wahr?«
»Also gut, Mel, betrachten wir Yaffas Plan. Wir unterstützen einen Staatsstreich. Cung geht. Wer wird regieren?«
»Eine Militärjunta.«
»Also wiederum die Generale. Juntas pflegen nicht sehr stabil zu sein.«
»Yaffa meint, die Generale würden eher zusammenhalten, wenn Cung verschwindet.«
»Was glauben Sie, Mel?«
»Ich zweifle daran.«
»Würde es den Generalen gelingen, die Armee zusammenzuhalten?«
»Auch daran glaube ich nicht.«
»Die Moral zu heben?«
»Schwer zu sagen.«
»Könnten Sie das Land auf die Dauer regieren?«
»Mit der Armee könnten sie Ordnung halten, aber ob sie es fertigbrächten, das Volk zu leiten, ihm neue Hoffnung und Tatkraft einzuflößen – ich weiß es nicht. Keiner von ihnen, auch nicht sie alle zusammen hätten Cungs Arbeit nach Dien Bien Phu leisten können. Keiner ist so zielbewußt, und keiner, ob Sie es glauben oder nicht, hat seine moralischen Qualitäten. Onkel Hos Erfolg im Norden ist zum Teil auf seine zugkräftige Ideologie zurückzuführen. Cungs Auffassung vom Personalismus, die er von den Franzosen übernommen hat, kann hier nicht populär werden. Das sind doch gallische Spitzfindigkeiten, die Masse der Bevölkerung begreift kein Wort davon. Wäre Cung ein genialer Politiker mit genug persönlicher Ausstrahlung, um Menschen an sich zu fesseln, dann könnte er ihnen Kant, Hegel, Thomas von Aquin und was Sie noch wollen verkaufen, einfach weil sie ihn und seine Leistung kennen und respektieren. Aber diese Art von Magnetismus fehlt ihm vollständig. Er ist ein selbstherrlicher, zurückhaltender Mensch, Junggeselle und Christ, was es auch nicht gerade leichter macht.«
»Also wählen Sie, Mel: Cung oder die Militärjunta?«
»Ich weiß es nicht, Sir«, sagte er leise, »ich wünschte, ich könnte Ihnen einen besseren Rat geben. Ich bin wohl schon zu lange hier, bin angesteckt von der schleichenden Resignation der Viets. Harry Yaffa hält mich für wankelmütig und handlungsunfähig. Mag sein, daß er recht hat, aber mit Angst hat das nichts zu tun, Sir. Ich kann mich einfach des Gefühls nicht erwehren, daß all unser Handeln zwangsläufig in Sackgassen führt.
Er brach ab und betrachtete schweigend seine langen Hände. Ich fühlte eine Welle herzlichen Mitgefühls in mir aufsteigen. Sein Dilemma war dem meinen verwandt. Ich empfand Hochachtung vor seinem Mut, die Verantwortung für die eigene Unsicherheit selber zu tragen. Schließlich hob er den Kopf und maß mich mit einem schwermütigen Blick.
»Ich will etwas sagen, Sir, Sie werden vielleicht meinen Kopf verlangen, und Sie können ihn haben, auf einem silbernen Tablett: Tolliver ist der einzige Amerikaner in diesem Land, der einen einfachen Auftrag zu erfüllen hat, nämlich einen Krieg zu führen, den er nicht gewinnen kann; kein Mensch erwartet von ihm, daß er ihn gewinnt. Für ihn und das Pentagon geht es einfach um das Halten eines Stützpunktes. Wenn die Viets gespalten sind, kämpft er eben mit einer gespaltenen Armee. Nicht er, sondern das vietnamesische Oberkommando trägt die letzte Verantwortung. Bei uns ist das anders. Wir sind von Washington beauftragt, in die Regierung dieses Landes einzugreifen. Sie sind hier mit einem Ultimatum angekommen, das praktisch nichts anderes sagt als: Tut dies, laßt das, sonst machen wir euch bankrott und entziehen euch unsere Militärhilfe.
Auf einer anderen Ebene hat die CIA ihre Finger drin: alles im Namen von Demokratie und Selbstbestimmung. Im Grunde steckt doch nichts weiter dahinter als ein politischer und militärischer Versuch, Chinas Kräfte zu binden und die Ausbreitung von Revolutionen einzudämmen, die ihre Ursachen in kolonialistischer Ausbeutung, Feudalherrschaft und korrupter Verwaltung haben.
Ich will Ihnen was sagen, Sir, die einzigen in diesem Land, die wirklich wissen, wofür sie kämpfen, sind die Katholiken. Sie sind sich klar darüber, daß ihre Gemeinde in einer halben Generation erledigt ist, wenn Südvietnam kommunistisch wird, während der Buddhismus sich anpassen und überleben wird, wie das chinesische Beispiel zeigt. Darum habe ich Verständnis und Sympathie für Cung, obwohl ich seine Fehler sehe. Auch wir machen einen Fehler, wenn wir nach einem neuen Mann und einer neuen Politik Ausschau halten, ohne zu wissen, was wir eigentlich wollen.
Wir unterstützen den Jockey statt des Pferdes, und weil wir es so eilig haben, unterstützen wir auch noch den falschen Jockey. Das sind die Gründe, warum ich mit der Richtung unserer Politik in Südostasien nicht einverstanden bin. Es ist mein Beruf, dieser Politik zu dienen, ich tue es so gut und aufrichtig ich kann, aber an sie glauben kann ich nicht mehr.«
Für einen Mann, der den größten Teil seines Lebens im Auswärtigen Dienst verbracht hatte, war das ein bitteres Eingeständnis. Daß er es mir anvertraute, nahm ich als einen Beweis von Sympathie. Die nächste Frage stellte ich so unverfänglich wie möglich:
»Wenn man Sie fragen würde, Mel, was für eine Politik würden Sie verfolgen?«
»Neutralisieren, solange wir noch in der Lage sind zu verhandeln. Und dann würde ich mich zurückziehen und das Volk selbst über seine Zukunft entscheiden lassen.«
»Damit in ein bis zwei Jahren Onkel Ho das Ruder ergreift?«
»Das tut er jetzt schon. Und wissen Sie, warum? Weil der einzige Mann, der den ehrlichen Wunsch hat, dieses Volk hochzubringen, einfach nicht das Zeug dazu hat. Und weil wir bankrott sind, Sir, weil wir außer Waffen, Geld und Soldaten nichts zu bieten haben. Weil der Bauer im Reisfeld keinen Hoffnungsschimmer sieht. Das wär's, Sir. Wenn Sie wollen, daß ich mein Amt niederlege – bitte sehr.«
»Wollen Sie gern ausscheiden, Mel?«
»Nein.«
»Was wollen Sie dann?«
»Ich glaube, daß ich hier nützlich sein kann, wenn auch nur als Stimme der Opposition. Es gibt eine winzige Möglichkeit, Cung von der Notwendigkeit einer Umstellung zu überzeugen, ohne das bereits Erreichte in Frage zu stellen. Für Sie, Sir, wird es nicht leicht sein. Man wird Ihnen nicht von den Fersen gehen mit der Forderung, einen Staatsstreich zu inszenieren und eine neue Regierung in den Sattel zu heben. Ich möchte ein wenig Gewissen spielen. Ich möchte die Geschichte hören, die man Ihnen auftischt, und Ihnen zeigen, wo die Wahrheit steckt.«
»Eine verdammt undankbare Rolle, Mel. Nicht einmal ich kann für Dankbarkeit garantieren.«
»Hat mit Dankbarkeit nichts zu tun, Sir, es ist eine Frage der Selbstachtung. Cung stürzen heißt ihn töten. Und lieber spiele ich die Rolle des Gewissens als die des politischen Mörders.«