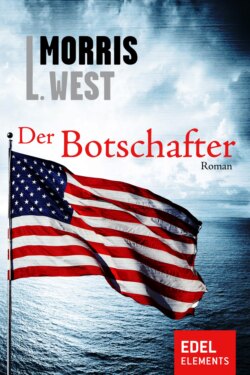Читать книгу Der Botschafter - Morris L. West - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Zweites Kapitel
ОглавлениеSo war ich nun Zeuge eines Märtyrertodes geworden, und das Bild des alten Mannes, der inmitten eines lärmenden Aufruhrs lächelnd den Flammen standhielt, verfolgte mich mit Schrecken und Unbehagen. Eine ungewöhnliche Geistigkeit mußte in dieser Ekstase liegen, die ihm die Kraft gab, seinen Körper bis in den letzten Nerv zu beherrschen. Bei dem Gedanken, daß dieser rituelle Selbstmord für mich veranstaltet worden sei, überkam mich Übelkeit.
Noch nicht eine Stunde war ich in diesem Land, hatte noch keinen Fuß in meine Botschaft gesetzt, und schon war ich öffentlich und unwiderruflich in die religiösen Kämpfe Südvietnams verwickelt, Die Presse würde von mir eine Erklärung über den Vorfall erwarten, noch ehe ich mein Beglaubigungsschreiben überreicht hatte.
Aber noch eine andere Seite meines Wesens war durch dieses Erlebnis berührt: Muso Sosekis Schüler, der auf einem der acht Pfade zu dem barmherzigen Buddha unterwegs war, schauderte vor der primitiven Frömmigkeit des vietnamesischen Mahayana. Ich hatte den Weg des Zen gewählt, auf dem es gilt, den egozentrischen Geist Stück für Stück abzutöten. Daß ein Mensch versuchen wollte, durch Auslöschen seiner physischen Existenz Erleuchtung zu erreichen, versetzte mir einen schweren Schock, der sich in zornigen Bemerkungen gegen General Tolliver Luft machte:
»Wer, zum Teufel, hat mir das eingebrockt? Wer ist verantwortlich für die Sicherheitsmaßnahmen?«
Er antwortete ebenso barsch und mißgelaunt:
»Die Botschaft, CIA und der Palast. Meine Sache war lediglich die Bereitstellung der Fahrzeugkolonne und des Personals zu Ihrer Bewachung. Für die Sicherheit der Straßen sind die Viets und, als Berater, die CIA verantwortlich. Die CIA kannte die Vorbereitungen der Viets und billigte sie.«
»Aber jeder weiß, daß die Buddhisten eine derartige "Demonstration seit Wochen angekündigt haben. Die Presse und die Botschaftsnachrichten waren voll davon. Irgend jemand muß sich ausgerechnet diesen Tag für die Eröffnung seiner Show ausgesucht haben.«
»Sie waren alle gewarnt«, sagte Tolliver bitter, »Presse, Palast, CIA. Bei den letzten Besprechungen wurde die Frage ganz offen diskutiert. Harry Yaffa erklärte sich bereit, die Garantie für die Sicherheitsmaßnahmen zu übernehmen. Yaffa ist der Mann in der CIA, gegen ihn kann ich nichts machen. Abgesehen davon, daß ich mit meinem eigenen Krieg genug zu tun habe – zu viele Fronten …!«
»Aber wer sollte Interesse haben, mich in eine buddhistische Verbrennung zu verwickeln?«
»Jeder«, sagte Tolliver, »die Buddhisten, weil sie das ihnen widerfahrene Unrecht zur Schau stellen wollen; die Palastclique, weil man annimmt, Sie würden sich vom primitiven Fanatismus dieser Demonstration abgestoßen fühlen, die Presse, weil sie endlich einmal eine wahre Geschichte braucht, nachdem man den Presseleuten vorgeworfen hat, sie dramatisierten den Krieg vom Barhocker aus, und die CIA, weil sie eine neue Regierung will und eine für die beste Chance hält, Ihnen diese Idee zu verkaufen.«
»Und die Armee?« fragte ich. »Ihre Armee, General, wo steht die?«
»Knietief im Deltasumpf«, seine Stimme war jetzt hart von unterdrückter Leidenschaft, »in einem Kampf, den sie nicht gewinnen kann und nicht verlieren darf. Wir haben hier nicht die Befehlsgewalt, sind nur ›Berater und Materialverwalter‹. Theoretisch können wir nicht einen einzigen Schuß abgeben, es sei denn, unsere persönliche Sicherheit sei direkt bedroht. Wenn wir den Oberbefehl an uns zögen, würde man uns zu kapitalistischen Kolonialisten stempeln wie die Franzosen. Ein massierter Vorstoß nach Nordvietnam könnte zu einer Berührung mit den Chinesen führen. Gewinnen wir hier, so sind wir Sieger in einem politischen und sozialen Vakuum. Wenn wir uns zurückziehen und die Viets ihren eigenen Krieg kämpfen lassen, verlieren wir das Gesicht und den Stützpunkt und alle südlichen Halbinseln Asiens. – Auch für mich hat der Märtyrer eine Bedeutung, nämlich als Symbol der Feindschaft und Uneinigkeit in unserem eigenen Lager. Jedenfalls habe ich die Sache nicht aufgezogen. Mein Bedarf an Märtyrern ist gedeckt.«
Ais ich mich entschuldigte, zuckte er nur die Schultern und lächelte müde.
»Jeder hat seine eigene Version der Wahrheit. Wenn Sie die ganze Wahrheit wissen wollen, dann müssen Sie sie aus den Deltasümpfen herausfischen, und die sind verdammt dreckig um diese Jahreszeit.«
»Und blutig, sagt man.«
»Auch blutig. Vielleicht kommen Sie einmal herüber und sehen sich das an?«
Wir fuhren durch die Tore der Botschaft, die sich hinter uns schlossen. Hier war ich sicher – sicher wie ein Tyrann – hinter den Bajonetten meiner Wachtposten.
George Groton charakterisierte den Empfang mit einem einzigen lakonischen Satz: »Dem neuen Kunden wird Maß genommen fürs Leichentuch.« Auch ich verspürte den kalten Hauch im Nacken – nur daß ich besser als Groton darauf vorbereitet war.
In unserem Dienst sind die Besserwisser und Windmacher, die sogenannten »neuen Besen«, höchst unbeliebt, vor allem, wenn sie vorher bessere oder bequemere Positionen innehatten. Mein Vorgänger war ein freundlicher Mann, geschätzt von seinen Mitarbeitern, ich dagegen galt als ein kühler Vorgesetzter und hatte mir überdies in letzter Zeit den Ruf übermäßiger Strenge und Genauigkeit zugezogen. So war es ganz natürlich, daß das Botschaftspersonal mir mit Vorbehalten begegnete.
Aber es stand weit mehr auf dem Spiel als die gute oder schlechte Laune des Botschafters. Hier war vorderste Front. Die Angestellten der Botschaft und ihre Angehörigen befanden sich ständig in Lebensgefahr. Täglich gab es Krawalle auf den Straßen. Bomben explodierten in Bars, Kinos und Geschäften. Jedes in einem Torweg abgestellte Fahrrad konnte mit Plastikbomben bepackt sein. Die Kinder wurden auf vorbestimmter Route unter bewaffnetem Schutz zur Schule gefahren. Bei Nacht wurden Türen und Tore verschlossen. Familienväter schliefen mit der geladenen Pistole unter dem Kopfkissen. Ein Sonntagsausflug fünf Meilen vor der Stadt konnte in einem Hinterhalt der Vietcong sein Ende finden. Jeder Reiskuchenverkäufer war ein potentieller Vietcong-Kundschafter, konnte ein bewaffneter Rebell sein.
Aus dieser Perspektive betrachteten die Botschaftsangestellten Neuankömmlinge, die sich einbildeten, durch große Gesten und eine neue Politik aus Washington das Gesicht Asiens ändern zu können.
Sie alle trugen schwer an den Folgen einer verfehlten Politik und würden ebenso die Folgen des neuen Kurses zu tragen haben. Es war ihr gutes Recht, mich in die Zange zu nehmen. Ehe ich ihre Loyalität in Anspruch nahm, mußte ich meine Person auf irgendeine Weise legitimieren. Ich kam mir ziemlich hilflos vor, als ich meinen Platz am Kopf des Konferenztisches einnahm und wartete, bis die Kollegen sich niedergelassen hatten. Diese Männer hatten in vorderster Linie gekämpft, zu einer Zeit, als ich meditierend durch Muso Sosekis Garten spazierte. Die Stimme, die ich als Chef dieses Amtes erhob, konnte ihnen sehr wohl wie die Stimme eines naiven Wirrkopfes klingen.
Während des letzten vorbereitenden Räusperns ließ mir George Groton einen mit Kanji-Zeichen beschriebenen Zettel zugehen: Starker Mann ist Harry Yaffa, CIA. Bruch zwischen ihm und Mel Adams, Erster Botschaftssekretär. Meinung der übrigen geteilt. Ich zerknüllte den Zettel und steckte ihn in die Tasche.
Melville Adams saß rechts von mir: ein dürrer, kahler, akademisch wirkender Spätvierziger. Er war schon lange Jahre im Dienst. Es gab Leute, denen er, seiner Trockenheit wegen, für einen höheren Posten ungeeignet erschien. Ich hatte ihn in Helsinki und Argentinien arbeiten sehen und schätzte seinen unpersönlichen Fleiß und die Hartnäckigkeit, mit der er seine Überzeugungen vertrat.
Ein Stück zur Mitte des Tisches hin saß Harry Yaffa, dem Typ nach eher Modearzt als Chef der Central Intelligence Agency für Südvietnam, Laos und Kambodscha: klein, rund, flink, verbindlich, mit weichen, tadellos manikürten Händen und einem eleganten Seidenhemd, das links unter der Brust ein dunkelblaues Monogramm trug. Seine Stimme war sanft, sein Benehmen charmant und eher nachgiebig. Er galt als unaufrichtig, hart und absolut skrupellos. Um seiner sicher zu sein, hätte ich ihn besser kennenlernen müssen, aber schon jetzt war mir klar, daß ich an einer näheren Beziehung wenig Geschmack finden würde.
Ich warf einen Blick über die Tischrunde. Alle studierten angelegentlich die getippten Berichte, die vor ihnen lagen. Es war Zeit, das Spiel zu eröffnen.
»Ich möchte uns Formalitäten ersparen, meine Herren, Sie kennen diesen Laden länger als ich. Ich werde mich auf Ihre Informationen, Ihren Rat und Ihre Hilfe verlassen müssen. Ich hoffe, Sie werden mir gegenüber offen sein, und verspreche Ihnen meinerseits Offenheit.«
Ihre Augen blieben gesenkt, ihre Gesichter leer: eine Runde erfahrener, im Dienst mißtrauisch gewordener Beamter. Dies war das übliche Vorspiel. Sie glaubten kein Wort davon. Was sie erwarteten, war der Wortlaut meiner Instruktionen von Washington. Sie sollten ihn haben.
»Ich vertrete hier eine neue Politik in bezug auf die Regierung in Südvietnam. Das State Department hat mich beauftragt, im einzelnen folgende Forderungen zu stellen: Die Verfolger der Buddhisten und die Repressalien gegen Studenten müssen unverzüglich eingestellt werden. Phung Van Cung muß alle nötigen Zugeständnisse machen, um die politische und militärische Einheit wiederherzustellen. Er und die Mitglieder seiner Regierung müssen sich hinfort jedes Angriffs auf die Politik der Vereinigten Staaten enthalten. Sollte Phung Van Cung nicht bereit sein, diese Forderungen zu erfüllen, bin ich beauftragt, unverzüglich Sanktionen einzuleiten: Sperrung der amerikanischen Hilfsfonds und allmähliche Zurückziehung der hier stationierten US-Streitkräfte.«
Eine Bewegung ging um den Tisch. General Tolliver fragte:
»Und wenn Cung sich nicht fügt, werden die Sanktionen tatsächlich in Kraft treten?«
»Ich gebe Ihnen mein Wort darauf, General. In wenigen Tagen werden Sie vom Pentagon genaue Instruktionen für einen eventuellen Rückzug unserer Truppen erhalten.«
Er dankte und versank in Schweigen, zu klug, als daß er sich als Soldat mit einem Diplomaten auf politische Erörterungen eingelassen hätte. Seinen Part hatte er hinter sich. Alles übrige hatte gute Weile, bis ich begriffen hatte, daß ich ohne seine Leute nichts machen konnte. Die nächste Frage stellte Mel Adams.
»Werden wir diese Forderung veröffentlichen, Sir?«
»Das hängt davon ab, wie mein Gespräch mit Phung Van Cung verläuft.«
»Was für Informationen bekommt die Presse?«
»Gar keine, bis ich das Beglaubigungsschreiben im Palast des Präsidenten überreicht habe. Ich habe erfahren, daß Sie für fünf Uhr heute nachmittag eine Pressekonferenz einberufen haben. Lassen Sie sie absagen.«
»Geben wir irgendwelche Erklärungen?«
»Ja. Sagen Sie ihnen, es sei eine Frage der diplomatischen Höflichkeit. Morgen um zwei Uhr nachmittags stehe ich den Herren zu einer offiziellen Pressekonferenz zur Verfügung. Apropos Presse: Man wird von mir erwarten, daß ich einen Kommentar zu dem heute erfolgten Selbstmord des buddhistischen Mönches abgebe. Im Moment weiß ich nicht, was ich der Öffentlichkeit dazu sagen sollte, aber für Sie, meine Herren, habe ich eine private Bemerkung zu diesem Vorfall. Er scheint mir ein Beweis für den kläglichen Zustand unserer Sicherheitsvorkehrungen. Ich möchte wissen, wer dafür verantwortlich ist.« Eine ungemütliche Stille breitete sich aus, die schließlich Harry Yaffas weiche Stimme durchbrach:
»Ich habe bereits Nachforschungen angestellt, Sir. Nach meiner Meinung tragen die Viets alle Verantwortung. Wir wußten, daß etwas Derartiges vorbereitet wurde. In den letzten zwei Wochen war die Stadt voller Gerüchte. Wir besprachen die Sicherheitsmaßnahmen in allen Einzelheiten mit dem Palast. Es wurde angeordnet, daß die Viets eine Wache von vier Mann am Tor der Pagode aufstellen sollten. Zwei meiner Leute postierte ich auf der gegenüberliegenden Straßenseite. Fünf Minuten vor Ankunft Ihres Wagens verließ die Woche ihren Posten. Einer meiner Leute folgte ihnen. Er stritt sich immer noch mit ihnen herum, als der Mönch aus der Pagode gebracht wurde. Dann war nichts mehr zu machen. Es ging einfach zu schnell.«
»Und Ihr zweiter Agent, Mr. Yaffa?«
»Das war ein Mann ohne militärische oder polizeiliche Vollmacht, Sir. Wenn er sich eingemischt hätte, wäre es möglicherweise zu schlimmeren Verwicklungen gekommen.«
»Also darum hat der Botschafter der Vereinigten Staaten am Morgen seiner Ankunft das Gesicht verlieren müssen, und der Palast hat wieder einmal Gelegenheit gehabt, seine gleichgültige Haltung den Buddhisten gegenüber zu demonstrieren. Ist das die Lage?«
Yaffa bedachte meine Naivität mit einem blassen Lächeln. »Nicht ganz so einfach, Sir. Die Buddhisten betrachten das als einen Sieg ihrer Sache.« Er suchte in seinen Papieren und zog ein Dokument hervor, das von Hand zu Hand weitergereicht wurde, bis es mich erreichte. »Die Übersetzung des letzten Briefes, den unser Märtyrer geschrieben hat«, sagte er. »Im Bereich der Pagoden und innerhalb der buddhistischen Gemeinden ist er bereits in Umlauf.«
Ich las den getippten Text. Die anderen warteten schweigend. In diesem Falle war dies ein bemerkenswertes Dokument. Das Testament eines Mannes vom Vorabend seines freiwilligen Scheidens aus der Welt. Wiederum sah ich ihn vor mir: seine unbewegliche Gestalt, sein Buddhalächeln zwischen Flammen. Gegen meinen Willen rührte mich die Inbrunst dieser Worte: »Ehe ich zu Buddha eingehe, nehme ich mir die Ehre, Präsident Cung eine letzte Bitte zu unterbreiten: Er möge seinem Volke Freundlichkeit und Toleranz erweisen und ihm echte religiöse Gleichberechtigung gewähren.«
Ich ließ das Blatt sinken und richtete den Blick von neuem auf Yaffa.
»Ein aufrührerisches Dokument, Mr. Yaffa.«
»Sehr wohl, Sir.« Seine Stimme klang sachlich, aber ein Unterton von Ironie entging mir nicht. »Es rührt an eine Frage, die früher oder später in dieser Konferenz gestellt werden muß: Wieweit hat Washington die Folgen des Ultimatums an Präsident Cung einberechnet?«
Nun war es heraus, lag mitten zwischen uns auf der Tischplatte: eine Herausforderung, die nicht unbeantwortet bleiben durfte. Ich war erstaunt, daß ausgerechnet dieser kleine runde, weichliche Mann als einziger den Mut oder die Berechnung aufbrachte, diese Frage zu stellen. Hatten ihn einige seiner Kollegen zu ihrem Sprecher gemacht? Oder hielt er sie alle als Vertreter geheimer Machtbefugnisse in Schach? Mir war zumute, als wiche der feste Boden unter meinen Füßen, als bewegte ich mich, getäuscht von Irrlichtern, durch trügerischen Morast. Ich entschloß mich zu einem vorübergehenden Rückzug, um diesen ersten Strauß auf vertrautem Boden auszufechten.
»In Washington hat man gewisse Berechnungen angestellt, Mister Yaffa, aber der Minister hat mich beauftragt, sie mit den Ansichten der Leute an Ort und Stelle zu vergleichen. Lassen Sie mich also jedem von Ihnen die gleiche Frage stellen: Was wird geschehen, wenn ich unsere Forderungen im Palast vorlege?«
Am Ende der Konferenz war ich völlig erledigt und einsam wie nie zuvor. Ich hatte den Eindruck, mit einem einzigen Zug die Grenze meiner geistigen und körperlichen Kräfte erreicht zu haben. Ich fühlte mich müde und alt. Mein Urteil war getrübt, mein Wille geschwächt. Ich verabscheute Raoul Festhammer, der mich so leichthin auf diesen Richterstuhl gesetzt hatte, und ich verabscheute die Erinnerung an Muso Soseki und seine Warnung vor meiner Unausgeglichenheit. Ich verabscheute meine Kollegen, die an den Streitigkeiten der Viets herumnörgelten und sich selbst untereinander nicht einig werden konnten. In diesem Augenblick hatte ich nur den einen Wunsch: alle Verantwortung abzuwerfen und diesen Ort der Spannungen und Intrigen zu verlassen.
Nach der rasch entflammten männlichen Erregung des Einzuges wirkte diese Stimmung wie die Traurigkeit nach dem Liebesakt, nur daß sich unter Traurigkeit und Ermattung immer noch der Schrecken rührte, eine Art von Verzweiflung, die mich eines Tages vielleicht in die Aktion treiben würde, einfach damit etwas geschähe und diese traurige Komödie ein Ende hätte. Einen Augenblick lang überblickte ich das ganze Ausmaß der Gefahr, dann schob ich sie beiseite. Ich mußte lächeln und den Kollegen danken, ich mußte diese Konferenz mit Worten der Höflichkeit und des Vertrauens beschließen.
Ich hatte nur ein Bedürfnis: zwei Stunden Ruhe bis zum Dinner, und verlangte einen Wagen, der mich unverzüglich nach Hause fahren sollte. Groton würde in der Botschaft warten, bis das Protokoll der Konferenz getippt war, dann sollte er es mir bringen. Mel Adams hatte ich aufgefordert, mit uns zu essen. Er sollte kurz über die Tätigkeit der Botschaft berichten.
Als ich den Raum verlassen wollte, hielt Yaffa mich auf und bat mich um ein paar Worte unter vier Augen. Er hatte ein Geschenk für mich: eine automatische Pistole, die in einem Halfter aus schwarzem Leder unterhalb der Schulter getragen wurde. Er riet mir, sie immer bei mir zu tragen, sie tagsüber in meiner Schreibtischschublade und nachts unter meinem Kopfkissen zu verwahren. Er riet mir weiterhin, mich von offenen Fenstern fernzuhalten und auf Reisen eine Leibwache mitzuführen, die er mir stellen würde. Ich durchforschte sein glattes Gesicht nach einer Spur von Ironie, fand aber nichts. Seine letzten Worte klangen nüchtern und respektvoll:
»In diesen Dingen müssen Sie sich auf mich verlassen, Sir. Sicherheit ist mein Job. Für Ihre Sicherheit bin ich persönlich verantwortlich. Wir befinden uns unter Mördern. Ich bitte Sie, meinem Rat zu folgen.« Ich dankte ihm und versprach, mich daran zu halten. Er bat, mich heimbringen zu dürfen. Es seien im Hause Sicherheitsvorrichtungen installiert, die er mir erklären wolle. Ich konnte nicht ablehnen, ohne undankbar zu sein. Davon abgesehen, reizte mich ein rascher Wechsel in seinem Benehmen.
Während der Konferenz hatte er sich ironisch gegeben, mit einem verdeckten, aber spürbaren Geltungsanspruch: ein Mann des Widerspruchs. Mit mir allein war er höflich und ehrerbietig. Die ironische Miene fiel von ihm ab wie eine Maske. Ich sah, was Groton gesehen hatte: den starken Mann, der Achtung oder Mißtrauen einflößte. Auf unserer Fahrt durch den trägen Abend hielt er mir einen knappen Vortrag über die Stadt Saigon.
»Sie hat Charme, nicht wahr? Eine französische Provinzbühne mit orientalischen Schauspielern. Aber das Stück ist rein asiatisch. Niemand meint, was er sagt. Nichts ist so, wie es aussieht. Sehen Sie sich diese Straße an. Da sind drei Polizisten und vier Leute von der Miliz, aber das ist noch nicht alles. Der da, mit dem Handkarren, ist einer von Cungs Sicherheitsleuten, ein anderer steht hinten an der Ecke. Die Frau da oben am Fenster arbeitet für mich. In dieser Stadt ist die Schraube so fest angezogen, daß Sie nicht einen Schluck Wasser nehmen können, ohne über einen Sicherheitspolizisten zu stolpern. Das sieht so ruhig aus, was? Aber unter der Oberfläche kocht es. Der Kerl auf dem Fahrrad ist vielleicht ein Vietcong, und der Taxifahrer da drüben kann leicht eine Bombe unter dem Fahrersitz versteckt haben. So oder anders, auf irgendeine Weise befindet sich dieses Volk schon seit zweitausend Jahren im Krieg. Sie sind überkultiviert – und zäh dabei: chinesischer Lack auf vietnamesischem Bambus, die Franzosen gaben den Firnis darauf. Da drüben ist Cholon, die Chinesenstadt: Das treibt Handel und vermehrt sich und verleiht Geld und vermehrt sich weiter, immer in der stillen Hoffnung, eines Tages neben den Gräbern der Ahnen bestattet zu werden. Einen von ihnen sollten Sie kennenlernen – den Chinesen Nummer Eins. Man sieht ihn selten, und sein Name wird nicht ausgesprochen. Er hält seine Leute zu Geduld und Stille an und horcht, woher der Wind weht.« Ohne seinen Ton zu ändern, fügte er hinzu: »Ich wünschte, Sir, Sie täten das gleiche. Horchen Sie eine Weile auf den Wind. Er spricht eine andere Sprache, als Sie soeben am Konferenztisch vernommen haben.«
Ehe ich antworten konnte, fuhr er fort: »Der Feuertod des Buddhisten war nur der Anfang. Es ist etwas Großes im Gange, ich weiß nicht genau, was. Es kann heute nacht passieren oder in ein paar Tagen. Ich werde es eine halbe Stunde im voraus wissen, dann rufe ich Sie an.«
Als ich nach Einzelheiten fragte, wich er aus. Ich war beunruhigt, und er wußte es.
»Wir wollen offen miteinander reden«, sagte er ernst. »Es ist notwendig, unsere Funktionen auseinanderzuhalten. Sie sind der offizielle Vertreter der Vereinigten Staaten. Ich diene meinem Land auf andere Weise: als politischer Opportunist. Ich muß Dinge tun, die Sie nicht billigen können, und darum ist es besser, wenn Sie nichts davon wissen. Ich muß Männer beseitigen und Frauen bestechen. Ich muß einen Anschlag anzetteln, um einem anderen zum Erfolg zu verhelfen. Und ich muß mich gegen Ihren Erfolg ebenso wie gegen Ihr mögliches Versagen sichern. Wenn Sie es vorziehen, Ihr Gewissen rein zu halten, ist es mir ein leichtes, Sie zu belügen. Ich lüge nicht ungeschickt, aber es wäre mir lieber, wenn es nicht nötig wäre. Ich hoffe, daß Sie jetzt klarsehen, Sir.«
»Absolut klar, Mr. Yaffa, bis auf eins: Was ist mit Ihrem eigenen Gewissen?«
»Gewissen ist Luxus, Sir. Ich bin mir schon lange klar darüber, daß ich mir keins leisten kann.«
Hier endete unser Gespräch, zwangsläufig. Wir hatten das Haus erreicht, eine weitläufige Villa mit viel Stuck, umgeben von einer hohen, mit Stacheldraht und Glasscherben gesicherten Mauer. Zwei Posten in Marineuniform hielten Wache an dem Eisentor. Zwei andere patrouillierten an der Mauer entlang. Hinter dem Tor stand ein Schilderhaus. Als der Fahrer hupte, ließ ein weiterer Marinesoldat das Gitter zurückschwingen. Die Posten standen stramm, während wir in den Hof einfuhren. Ein Rausch tropischer Farben überfiel mich. Schwer und süß dufteten die Frangipani. Nach der klaren, sparsamen Ordnung meines japanischen Gartens erschien mir dieser Ort wüst und überladen wie eine heruntergekommene, einstmals schöne Frau. Ich fühlte mich nicht aufgenommen, fand keine Ruhe für Augen und Geist. Hier würde ich immer nur Gast sein, ein unerwünschter Eindringling. Nichts lockte mich, etwas von meinem innersten Selbst daranzusetzen, das mein einziger wahrer Besitz war.
Yaffa kam zum Ende seiner Ausführungen: »Ihr Personal besteht zur Hälfte aus Amerikanern. Anne Beldon ist Ihre Privatsektretärin, Hanson der Hausmeister, ein alter Virginier, tüchtig in seinem Fach. Mrs. Brendon ist die Haushälterin. Die anderen werden Sie nach und nach kennenlernen. Küchenpersonal, Putzer und Gärtner sind Vietnamesen, Angehörige dreier Familien, die auf einem Gelände am Rande des Grundstücks untergebracht sind. Auf diese Weise haben wir sie unter Aufsicht, und sie sind weder Bedrohungen noch Verführungen ausgesetzt. Die Fenster Ihrer Privaträume öffnen sich auf den Fluß. Wir haben das Schußfeld überprüft. Die Möglichkeit, daß Sie aus dieser Entfernung abgeknallt werden, ist äußerst gering. Immerhin existiert diese Möglichkeit, vergessen Sie das nie! Das ganze Haus ist von Alarmanlagen umgeben. Die Wachen befolgen ihren Routinedrill, mit dem ich Sie jetzt nicht langweilen will. Ihr persönlicher Leibwächter ist Bill Slavich, Scharfschütze und Meister im Judo. Er wohnt im Hause. Darf ich Sie bitten, einzutreten, Sir.«
Die Begrüßungszeremonien waren kurz. Ich bemerkte mit Befriedigung, daß Miß Anne Beldon hübsch und freundlich aussah und daß mein Leibwächter eher einem ehemaligen Westpointler als dem Boxertyp glich, den ich vorzufinden gefürchtet hatte. Man mag mich für einen Snob halten: Ich habe eine fast körperliche Abneigung gegen jede Kraftmeierei. Es hätte meinen Stolz verletzt, von einem Kerl bewacht zu werden, der wie ein Bulle aussah.
Endlich war ich allein in einem großen luftigen Schlafraum, aus dessen Fenstern ich über den Fluß hinweg in die grünen Ebenen des Deltas blicken konnte. Im letzten Tageslicht wirkte die Landschaft still und schön, unwirklich wie die gemalte Kulisse einer Ballettszenerie. Undenkbar, daß vor einer Woche nur zehn Meilen von hier – ich hätte es von diesem Fenster aus sehen können – ein Kampf stattgefunden hatte, in den fast tausend Mann, Vietcong, Cungs Leute und Amerikaner, verwickelt waren. Noch unwahrscheinlicher erschien es mir, daß im Schutz der rasch einfallenden tropischen Nacht die Vietcong aus ihren Verstecken krochen, Dörfer überfielen, ihren Tribut an Reis, Hühnern und Munition einzogen und durch Drohung oder Versprechungen neue Verbündete gewannen. Irgendwo da draußen hatten sie einen amerikanischen Offizier in einen Käfig gesteckt und nackt, mit verbundenen Augen, von Dorf zu Dorf geschleppt, als Kinderschreck und Weiberspott. Der nächste Morgen sah vielleicht einen widerspenstigen Bauern mit durchschnittener Kehle einen Kanal abwärtstreiben oder einen anderen, der gepfählt und geknebelt auf den Spitzen eines Bambuszaunes gestorben war. Bevor die Sonne kam und die Hubschrauber aufstiegen, würden die Vietcong verschwunden sein, untergetaucht im Dschungeldickicht oder unter die Käufer und Verkäufer eines Dorfmarktes gemischt. Während ich noch zum Fenster hinausblickte, fiel die Nacht wie ein Vorhang, und der erste schwache Sternenschimmer erschien in den Lücken zwischen Wolkenbänken.
Das war die Stunde der Umdüsterung, Stunde der Untätigkeit, des Zweifels und des Mißtrauens, Stunde der Angst vor der kommenden Nacht. Um es offen zu sagen, ich habe immer zu den Männern gehört, die Frauen zum Leben brauchen. Wenn mein Leben bisher in Ordnung und Regelmäßigkeit verlaufen war, so lag das an der glücklichen Verbindung mit Gabriele. Nach ihrem Tode gab ihr Andenken mir Halt, und eine wählerische Eitelkeit hinderte mich daran, schmutzige oder flüchtige Affären anzufangen. In diesem Augenblick erkannte ich, daß dieser Schutz unmerklich abgebröckelt war. Ich fragte mich nicht ohne Angst, wie ich die Belastungen dieser neuen Arbeit allein durchstehen sollte. Auch die Hilfe der asketischen Übungen, die Muso Soseki mir auferlegt hatte, war mir jetzt versagt. Der Garten von Tenryu-ji hatte seine Tore für mich geschlossen. Auf dem Weg, den ich zu gehen hatte, mußte ich vor meinen eigenen Leidenschaften ebenso auf der Hut sein wie vor Verrat und einer mörderischen Kugel.
Im Bad rief ich mir noch einmal die Konferenz dieses Nachmittags in die Erinnerung zurück und suchte unter den verwirrten Fäden der Diskussion den einen, der mich durch das Labyrinth zu dem Untier in seiner Mitte leiten könne – falls es dieses Untier gab –, aber jeder dieser Fäden endete in einer Sackgasse, so daß mir nichts anderes übrigblieb, als zurückzukehren und von vorn zu beginnen.
General Tollivers Vorstellung der Situation war einfach end präzise: Es war ein Krieg, den er führen mußte, aber nicht gewinnen konnte. Am Ende würde er einen neuen Stern auf den Schulterstücken tragen und seiner Regierung eine Truppe kampferprobter Veteranen zurückgeben. Die amerikanischen Verluste waren gering. Sie wurden durch einen bedeutenden Zuwachs an Kampferfahrung aufgewogen. Für Tolliver waren die Viets nichts weiter als eine militärische Belastung. Politische Intrigen hatten ihren Oberbefehl gespalten, die Offiziere waren mangelhaft ausgebildet, die kämpfende Truppe war mutlos und demoralisiert. Dieser ganze Krieg war ein Krebsgeschwür, eine sinnlose Verschwendung von Material, Menschenleben und Kampfgeist.
Mel Adams dachte nicht weniger pessimistisch. Die politische Situation war in unübersehbarer Verwirrung. Die morsche Diktatur der Cungs stützte sich auf alte Mandarin-Ordnungen, auf Kriegsintrigen, die Geheimpolizei und einen konservativen Katholizismus altfranzösischer Prägung. Cung selbst war zweifellos ein fähiger Politiker, aber die Sympathie der Stadtbevölkerung gehörte ihm nicht mehr, und um das Landvolk um sich zu sammeln, fehlte es ihm an persönlicher Ausstrahlung. Er hatte sich isoliert und mit Schmeichlern umgeben, die ihm für jede Narrheit Beifall spendeten. Er hielt sich für einen guten Katholiken und den lieben Gott für seinen Verbündeten. Daß er sich den Buddhisten gegenüber ins Unrecht gesetzt hatte, konnte er nicht zugeben, ohne das Gesicht zu verlieren. Darum schlug er diesen halsbrecherischen Kurs der Unterdrückung und Aufspaltung ein. Mein Ultimatum würde ihm einen schweren Schock versetzen. Wenn er Vertrauen faßte, könnte es möglicherweise eine Änderung bewirken. Wenn nicht, mußte er wohl oder übel abtreten. In den Kulissen wartete Harry Yaffa mit dem zu diesem Zweck vorgefertigten Werkzeug. Die Generale waren reif für die Revolte. Sie warteten nur noch auf ein Zeichen unseres Einverständnisses, um Cung über Nacht zu stürzen. Wenn die Generale zusammenhielten, sollte es möglich sein, eine von militärischer Macht gestützte stabile Regierung zu bilden. Dann konnte der Krieg eine ganz andere Wendung nehmen. Aus diesen Gründen solle mein Ultimatum im gleichen Augenblick veröffentlicht werden, in dem ich es dem Präsidenten überreichte. Der Text war so formuliert, daß die Generale es als eine Billigung ihrer Pläne auffassen konnten. Es gab also wirklich das Untier inmitten dieses Labyrinthes. Sein Name war Cung. Wenn ich dieses Land retten und den Krieg gewinnen wollte, brauchte ich nichts weiter zu tun, als es zuzulassen, daß die Generale ihn über die Klinge springen ließen … Diese Lösung hatte die Schlichtheit eines Märchens, und wie ein Märchen schuf sie ihre eigene Wirklichkeit. Aber die Wahrheit? Tolliver hatte mir geraten, im Deltasumpf nach ihr zu fischen. Muso Soseki suchte sie im Inneren der Dinge.
»Was werden Sie tun«, hatte er gefragt, »wenn man Ihnen befiehlt, den Kuckuck zu töten?«
Jetzt verstand ich die Frage, aber eine Antwort wußte ich noch immer nicht. Ich löschte das Licht, trat zum Fenster und blickte noch einmal in die Richtung des Deltas. Dort, in den Attap-Hütten und Dschungellagern, würde das Urteil über mein Handeln gefällt werden.
Dort war beides, die eindeutige Außenseite und das vielfältige Innere der Dinge. Der Dorfälteste war König, Priester und oberster Richter. Der Clanälteste führte den Ahnenkult fort, pflegte die Gräber, hielt die Altäre rein. Er zeichnete die Chronik der Familie auf und verwaltete das unveräußerliche Eigentum. Drei Generationen einer Familie lebten unter einem Dach, und jeder steuerte sein Teil für die gemeinsame Reisschüssel bei. Sie lebten in Gruppen, die mit einer Wurzel im Erdboden verankert waren wie der Bambus, und wie der Bambus schwankten sie hin und her im Wind, beugten sich vor Stürmen und richteten sich wieder auf: ein Volk der Anpassung mit Sitten von archaischer Höflichkeit.
Ob christlicher Priester oder Buddhistenmönch, Gelehrter des Konfuzianismus oder taoistischer Magier – sie hatten ihnen Reiskuchen angeboten und jedem zugehört, vielleicht ein wenig gelernt. Dann tauchten sie wieder hinab in ihre Welt voller Geister und wandernder Seelen und Wächter für Baum und Fels und Lilienteich.
Sie kannten kein Untier inmitten des Labyrinthes, nur den Mandarin in seinem Palast im fernen Saigon, dessen Erlasse sie höflich in Empfang nahmen und höflich vergaßen, bevor die Sonne unterging. Oder waren wir für sie die Untiere: die großen weißen Barbaren mit den langen Nasen und den hellen Augen, die keine Geister kannten, die mit Pulvern und Tränken zur Vertreibung von Würmern handelten – und mit Gewehren, die ihren Brüdern den Tod brachten.
Es klopfte an die Tür. George Groton brachte die Abschriften der Konferenz. Rot und aufgeregt wie ein Schuljunge platzte er in die düstere Stimmung dieses Abends. Es tröstete mich, seine lebendige Stimme zu hören.
»… genau wie die Räuberpistolen, die sie heut nicht mehr schreiben, weil kein Mensch daran glaubt, Caravelle-Bar heißt der Laden. Sah genauso aus, als ob aus irgendeiner Ecke Papa Hemingway persönlich auftauchen müßte. Ich ging hin, um was zu trinken, solange sie mit den Abschriften beschäftigt waren. Die Jungs von der Presse tuschelten in den Ecken herum und führten geheimnisvolle Telefongespräche in miserablem Französisch. Irgendeiner ließ im Flur eine Sodaflasche fallen, und sofort griffen zwei Viets nach den Gewehren. Dann fing alles an zu lachen, und es gab eine Menge dämlicher Gesichter. Irgend etwas tut sich in dieser Stadt, aber keiner will mit der Sprache herausrücken. Einer von Harry Yaffas Leuten wir hinter mir her und versuchte mich auszuholen, über Sie und was Sie vorhätten. Ich sagte, ich sei Bürobote und wisse von nichts. Sir, ich habe eben Ihre Sekretärin kennengelernt, wenn das nicht eine süße …« Er errötete und sah nun selber ziemlich dämlich aus. »Verzeihung, Sir, ich schwätze mir da was zusammen. Diese Stadt – das wirkt auf mich wie Pervitin.«
Wir lachten, dann fragte ich:
»Hat dieser Mann von Harry Yaffa Ihnen auch eine Waffe gegeben?«
»Nein, Sir, er hat mir die Bars aufgezählt, wo es die besten Drinks gibt, und wenn ich was mit den hiesigen Girls anfangen wollte, soll ich mir besser eine Flak-Jacke anziehen.«
»Ein kenntnisreicher Mann!«
»Auf eins legte er besonderen Wert, das rieb er mir richtig unter die Nase: Wir sind die neuen Besen, Sir. Wir sollen den alten Mist fegen und denen, die nach uns kommen, einen feinen sauberen Stall hinterlassen. Wenn der Herr Botschafter und die CIA miteinander Pingpong spielen, wird alles, alles wieder gut.
Übrigens soll ich Ihnen von Mel Adams bestellen: er möchte einen Gast zum Dinner mitbringen, den Apostolischen Delegaten. Sie haben ihn nach Rom zurückberufen, damit er dem Vatikan über die hiesigen Zustände berichtet. Morgen früh fliegt er ab. Mel Adams meint, eine Unterhaltung mit ihm sei die beste Vorbereitung auf das Treffen mit Cung. – Ich mag Adams. Er gab mir einen kurzen Überblick. Er läßt sich nicht einschüchtern.«
Auf diese unzusammenhängende Weise unterhielten wir uns, während ich mich ankleidete. Wieder einmal faszinierte mich der Gegensatz zwischen seinem knabenhaften Temperament und der durchdringenden Schärfe seiner Einsichten. Er hatte einen unfehlbaren Sinn für das Angemessene. Es wäre mir nie in den Sinn gekommen, die Intimität unserer privaten Gespräche in irgendeiner Weise auszuspielen. Wenn wir in Gesellschaft waren, begegnete er mir mit Bescheidenheit und Ehrerbietung. Seine Loyalität war für mich von unschätzbarem Wert. Ich hoffte, ihm einen Gegenwert in Form weiterer Ausbildung und Arbeitserfahrung vermitteln zu können.
Als wir zum Essen hinuntergingen, trafen wir Mel Adams mit einem kleinen Italiener im Priestergewand: Hochwürden Monsignore Angelo Visconti, Apostolischer Delegat in der Republik Südvietnam.
Er war der ideale Gast, geistsprühend und beredt. Sein Akzent verlieh der englischen Sprache, die er völlig beherrschte, eine abenteuerliche Eleganz. Als perfekter Diplomat der Kurie war er von dem Bewußtsein durchdrungen, daß Probleme nicht durch Hast und nicht durch Worte am falschen Ort und zur falschen Zeit zu lösen waren. Er unterhielt uns mit zahlreichen Anekdoten aus den verschiedensten Ländern, und solange die Mahlzeit dauerte, waren wir durch sein Verdienst der Spannung dieses Tages entronnen. Plötzlich, fast abrupt, unterbrach er das Geplauder und forderte mich auf, ihm Fragen zu stellen. Meine Fragen waren offen, um nicht zu sagen grob. Er beantwortete sie mit theologischer Präzision. Ich habe diesen Dialog in meinem Tagebuch festgehalten:
»Wieweit, Euer Exzellenz, kann man die katholische Kirche in Südvietnam für die Akte der Unterdrückung und Grausamkeit verantwortlich machen, die gegen die Buddhisten, also achtzig Prozent der Bevölkerung, begangen wurden?«
»Der Erzbischof von Hue und der Präsident, mit dem der Erzbischof in enger Verbindung steht, tragen die direkte Verantwortung. Der Erzbischof beging eine unfaßliche Torheit, als er die Regierung zwang, das Zeigen von Fahnen zu Gautama Buddhas Geburtstag zu verbieten. Es kam zu Unruhen. Die Polizei tötete neun Menschen. Der Erzbischof und der Präsident dachten nicht daran, nachzugeben. Die Unruhen nahmen zu und mit ihnen die Verhaftungen. Und jetzt haben wir die buddhistischen Märtyrer. Der Vatikan und die Kirche von Südvietnam haben sich auf das entschiedenste von den Maßnahmen der Unterdrückung distanziert. Diese Haltung kam sowohl in einem Hirtenbrief des Erzbischofs von Saigon als auch in einem direkten Schreiben von Papst Paul VI. deutlich zum Ausdruck. Es mag unter dem niederen Klerus auf dem Lande einige wenige Ausnahmen geben, aber ich bin ganz sicher, daß die große Mehrheit der Katholiken die Zwangsmaßnahmen verabscheut und ablehnt. Auf der anderen Seite«, fügte er rasch hinzu, »sollte man nicht alle Buddhisten für Heilige halten. Es gibt auch unter ihnen gewalttätige Elemente, die unter Umständen Schwierigkeiten machen können.«
»Wie würden Sie die Lage der katholischen Kirche in Südvietnam definieren?«
»Im Volk lebt ein echter, tiefer Glaube, aber die Ausbildung der Priester ist unzureichend und reformbedürftig. Die unnachgiebige Haltung des Erzbischofs von Hue den Anweisungen des Heiligen Stuhls gegenüber hat die priesterliche Autorität schwer erschüttert.«
»Cung gibt vor, ein guter Christ zu sein. Er stützt seine Politik auf die Lehre des Personalismus, die in ihrer praktischen Anwendung an die Wurzel der individuellen Freiheit rührt. Alles das im Namen Christi.« Er lächelte ein wenig. Seine Hand beschrieb eine römisch anmutende Geste der Resignation. »Was wollen Sie?« sagte er. »Der beste Schlachtruf der Welt war das französische: Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit. Eine glorreiche Lüge. Es kann nur Unsinn dabei herauskommen, wenn man versucht, einen Staat auf einem philosophischen Lehrsatz aufzubauen. In meinem letzten Bericht gebrauchte ich das Wort ›Maritain und Mandarinismus‹. Ich fürchte, daß man in unserem Sekretariat nicht viel Geschmack daran fand. Die Wahrheit ist: Cung ist ein Katholik des Mittelalters. Er verhält sich wie ein Mandarin. Seine Regierungsweise ist autoritär und totalitär. Im Grunde seines Wesens ist er hundertprozentiger Marxist. Aus Südvietnam könnte man über Nacht ein marxistisches Land machen, einfach indem man die Flaggen austauscht.«
»Und wie sollte das zugehen?«
»Der ganze Apparat totaler politischer Kontrolle ist ja bereits vorhanden. Die ländlichen Gebiete sind in strategische Zentren eingeteilt, die gegenwärtig militärische Funktionen haben, aber ebensogut politische übernehmen können. Jeder Einwohner ist mit Namen, Alter, Beruf und Personalbeschreibung registriert. Das ganze Land, vor allem die Städte, wird ständig von der Geheimpolizei überwacht. Die Organisation entspricht etwa der Gaueinteilung im Nazireich und dem marxistischen Zellensystem. Sie kann für jeden Zweck benutzt werden.«
Bei diesen Worten fiel mir Harry Yaffa ein, der Opportunist, der ebenfalls bereit war, jedes System für die widersprechendsten Ziele zu benutzen. Auf die Einteilung in Zellen ging ich nicht weiter ein, weil ich wohl wußte, daß wir dabei die Hände mit im Spiel hatten. Also begnügte ich mich mit einer weniger politischen Frage.
»Worin sehen Sie die größten Gefahren für den Katholizismus in Südvietnam?«
»Ich sehe eine ständig wachsende Gefahr für die ganze Bevölkerung, Christen und Buddhisten. Sie beginnt mit der Apathie derer, die in der Unterdrückung leben, ohne ihre Klagen anbringen zu können. Daraus ergibt sich eine Haltung passiver Entrüstung. Und eines Tages werden sie sich in einem verzweifelten Dilemma befinden, in einer Situation, in der es ihnen gleichgültig ist, ob sie sich für eine extrem rechte oder eine extrem linke Regierung entscheiden.«
»Was rät die Kirche in dieser Situation?«
»Wir bereichern das geistliche Leben des Volkes durch Missionen, verbessern die Ausbildung der Priester und versuchen die Kirche aus der Politik der Machtblöcke herauszuhalten, indem wir jedem Glied unserer Gemeinden die Freiheit geben, seine eigene politische Wahl zu treffen. Was auch politisch oder militärisch geschieht, unser Kirchenvolk hat die Möglichkeit, seine Gemeinschaft des Geistes als eine Einheit fortzusetzen.«
Ich begriff diese Einstellung, aber als ein Mensch ohne Glaubensüberzeugung konnte ich mich eines gewissen Zynismus nicht erwehren. Ich glaubte keinen Augenblick daran, daß sich die christlichen Minoritäten in Südvietnam unter einem christenfeindlichen Regime länger halten würden als beispielsweise im kommunistischen China. Immerhin interessierte mich die Meinung dieses klugen, vorausschauenden Römers über den Ausgang dieses Dilemmas.
»Glauben Sie, daß Sie genug Zeit haben werden, die Kirche zu reformieren und das geistliche Leben der Bevölkerung zu vertiefen? Glauben Sie überhaupt, daß die Kirche diesen ihren letzten Stützpunkt in Südostasien halten kann?«
»Aus der menschlichen Sicht heraus kann man diese Frage kaum beantworten. Hier ist Asien, nicht Europa. Es gibt viel Unwissenheit, Analphabetentum und Aberglauben. Die Möglichkeit einer Ausbildung haben nur wenige, die dazu neigen, diese Möglichkeit zu mißbrauchen. Wir setzen unser Vertrauen auf Gott und das Wirken des Heiligen Geistes.«
Sein Gesicht verdunkelte sich, als er hinzufügte:
»Ich war in großer Verzweiflung und habe daraus keinen Hehl gemacht, aber in letzter Zeit durfte ich den winzigen Beginn eines Wunders in unserer Kirche erleben: das Wunder eines weisen und lebendigen Glaubens, der im einfachen Volk fortlebt als eine Überwindung der Fehler derjenigen, die es beherrschen.«
Ich widerstand der Versuchung, darauf hinzuweisen, daß derlei Wunder oft nichts als Illusionen seien, die die Verzweiflung selbst als Trost für die Verzweifelten hervorbrächten. Dieser Angelo Visconti besaß, wonach ich verlangte: einen festen Glauben an Übernatürliches. Ich mußte erfahren, wie sich dieser Glaube in der Praxis bewährte, und fragte weiter:
»Hat die Kirche Schritte unternommen, um im Geist der christlichen Liebe und der Ökumenischen Bewegung die Beziehungen zu den Buddhisten wieder anzuknüpfen oder zu verbessern?«
»Es gibt Priester, die derartige Beziehungen pflegen. Es mag manchmal so scheinen, als ob durch das Verhalten einiger Christen die Kirche kompromittiert würde. In Wahrheit ist die Kirche in sich selbst, in ihrem innersten Wesen, nicht zu kompromittieren. Ihre letzte Antwort bleibt die Antwort der Brüderlichkeit und der christlichen Liebe.«
Meine nächste Frage war unfair. Ich stellte sie trotzdem, weil ich wissen wollte, wie der katholische Präsident auf die Antwort des Glaubens reagierte.
»Die Stadt ist voller Gerüchte, daß eine Anzahl von Studenten und Studentinnen in Gefängnissen festgehalten und gefoltert wird. Glauben Sie diesen Gerüchten?«
»Es bleibt mir nichts anderes übrig. Ich fürchte sogar, daß in Kürze noch mehr Verhaftungen erfolgen werden.«
»Sind Sie deswegen im Palast vorstellig geworden?«
»Ich habe es versucht, aber es gibt keine Möglichkeit, das Denken des Präsidenten zu ändern.«
Ich erinnere mich, daß er an diesem Punkt abbrach und gedankenvoll seinen Wein trank, als erwäge er seine nächsten Worte. »Was ich jetzt sagen will, mag Ihnen als ein Widerspruch zu allem bisher Gesagten erscheinen, aber ich halte es trotzdem für wichtig. Ich will Cung Gerechtigkeit widerfahren lassen. Wenn ich ihn im privaten Bereich seines Gewissens zu beurteilen hätte, müßte ich zugeben, daß er höchstwahrscheinlich nach bestem Wissen und Gewissen handelt. Er ist blind, verrannt, mißleitet, aber es gab eine Zeit, in der er seinem Volk als Retter aus Hoffnungslosigkeit und Korruption erschien. Mag sein, daß er die Fehler von heute mit den damaligen Triumphen rechtfertigt. So paradox es klingt, das ist die Wahrheit, wie ich sie sehe. Noch eins möchte ich hinzufügen …«
Ich habe niemals erfahren, was er hinzufügen wollte. Man rief mich ans Telefon. Harry Yaffa hatte eine Nachricht für mich: »Es geht los, Sir! Cungs Truppen haben den Befehl, die Pagoden zu stürmen. Bitte kommen Sie sofort zur Botschaft.«
Ich blickte auf die Uhr. Es war eine Viertelstunde nach Mitternacht. Ehe ich den Hörer auflegte, vernahm ich entfernt, aber deutlich, die Schläge eines metallenen Gongs.