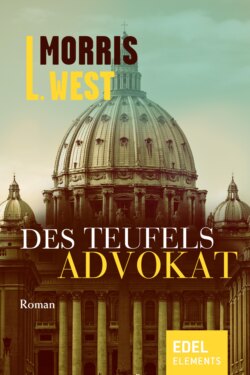Читать книгу Des Teufels Advokat - Morris L. West - Страница 4
ОглавлениеEs gehörte zu seinem Beruf, andere auf den Tod vorzubereiten. Er war entsetzt, als er merkte, daß er selber so gar nicht auf seinen eigenen Tod vorbereitet war.
Er war ein vernünftiger Mann, und die Vernunft sagte ihm, daß dem Menschen das Todesurteil schon am Tage seiner Geburt in der Hand geschrieben steht. Er war ein kaltsinniger Mann, von Leidenschaften kaum berührt, durch die Gebote der Disziplin in keiner Weise belastet, aber sein erster Impuls war das wilde Verlangen gewesen, sich an die Illusion der Unsterblichkeit zu klammern.
Eigentlich erfordert es die Würde des Todes, daß er unangekündigt, mit verhangenem Antlitz und verborgenen Händen erscheine, zu einer Stunde, da man ihn am allerwenigsten erwartet. Langsam sollte er kommen, auf leisen Sohlen wie sein Bruder, der Schlaf – oder rasch und heftig wie die Erfüllung des Liebesakts –, damit der Augenblick des Untergangs still und gesättigt sei und nicht eine gewaltsame Trennung von Seele und Leib.
Die Würde des Todes. Sie erhofft sich der Mensch in dunkler Ahnung, sie erfleht er vom Himmel, wenn er geneigt ist zu beten, ihr trauert er bitterlich nach, wenn er weiß, daß sie ihm nicht vergönnt sein wird. Diese dumpfe Trauer empfand Blaise Meredith nun, als er in der matten Frühlingssonne saß und den langsamen Zug der Schwäne auf dem Serpentine-Teich betrachtete, die verliebten Paare auf dem Rasen, die an die Leine gelegten Pudel, die geziert hinter den kokett flatternden Röcken ihrer Besitzerinnen dahintänzelten.
Inmitten dieser Lebensfülle – sprießendes Gras, von frischen Säften schwellende Bäume, nickender Krokus und schaukelnde Narzissen, lässige Liebelei der Jugend, kräftiger Schritt der promenierenden alten Herren – schien er allein vom Tode gezeichnet. Das kategorische und unausweichliche Gebot war nicht mißzuverstehen. Man konnte es zwar nicht in den Handlinien lesen, aber wer Augen hatte, sah es auf dem viereckigen fotografischen Negativ, auf dem ein kleiner grauer Fleck das Urteil sprach.
«Karzinom.» Der breite Finger des Chirurgen hatte einen Augenblick lang das Zentrum des grauen Flecks berührt und dann die äußeren Konturen des Tumors umrissen.
«Langsam wachsend, aber ziemlich entwickelt. Ich habe zu viele solche Fälle gesehen, ich irre mich nicht.»
Während er den kleinen, durchsichtigen Schirm und den spatelförmigen, dahingleitenden Finger beobachtete, kam Blaise Meredith die Ironie der Situation zu Bewußtsein. Sein ganzes Leben hatte er damit verbracht, anderen Menschen die Wahrheit über ihre Person vor Augen zu führen, die quälende Schuld, die erniedrigenden Begierden, die lähmenden Torheiten. Nun blickte er in seine eigenen Eingeweide, wo ein kleines, bösartiges Gewächs wie eine Alraunwurzel dem Tag entgegenwucherte, da es ihn vernichten würde.
Er fragte ziemlich gelassen:
«Ist eine Operation möglich?»
Der Chirurg knipste das Licht hinter dem Bildschirm aus, der kleine graue Tod wurde unsichtbar. Dann setzte er sich, rückte die Tischlampe so zurecht, daß sein eigenes Gesicht im Schatten lag und das seines Patienten voll beleuchtet war.
Blaise Meredith bemerkte den kleinen Trick und konnte ihn verstehen. Ihre Berufe ähnelten einander. Jeder hatte es, auf seinem Gebiet, mit menschlichen Wesen zu tun. Jeder mußte eine gewisse klinische Kälte bewahren, um sich nicht selber allzusehr preiszugeben und ebenso schwach und ängstlich zu werden wie die Patienten.
Der Chirurg lehnte sich in seinen Sessel zurück, griff nach einem Papiermesser und balancierte es elegant wie ein Skalpell. Er wartete eine Weile, sammelte seine Worte, wählte dieses, schob jenes beiseite und ordnete sie dann zu einem peinlich genauen Muster.
«Ja, ich kann Sie operieren. Dann sind Sie in drei Monaten tot.»
«Und wenn Sie nicht operieren?»
«Dann werden Sie etwas länger leben und schmerzhafter sterben.»
«Wie lange?»
«Sechs Monate. Im äußersten Fall zwölf.»
«Das ist eine bittere Wahl.»
«Sie bleibt Ihnen überlassen.»
«Das ist mir klar.»
Der Chirurg setzte sich bequemer zurecht. Jetzt war das Schlimmste vorbei. Er hatte sich in diesem Manne nicht getäuscht. Der Mann war klug, gefaßt, ein asketischer Typ. Er wird den Schock überwinden und sich in das Unvermeidliche fügen. Wenn die Agonie beginnt, wird er sie mit einer gewissen Würde ertragen. Seine Kirche wird ihn vor Entbehrungen schützen und ihn nach seinem Tode mit allen Ehren begraben, und wenn niemand ihm nachtrauert, könnte man auch das als den letzten Lohn des Zölibats bezeichnen: sich aus dem Leben wegzuschleichen, ohne seine Freuden vermissen oder unerfüllte Pflichten hinterlassen zu müssen.
Blaise Merediths kalte, trockene Stimme unterbrach seinen Gedankengang. «Ich werde mir überlegen, was Sie mir gesagt haben. Falls ich mich entschließen sollte, mich nicht operieren zu lassen – meine Tätigkeit wiederaufzunehmen –, würden Sie dann so gut sein, mir einen Bericht für meinen Hausarzt mitzugeben? Eine ausführliche Diagnose und vielleicht auch eine Behandlungsvorschrift?»
«Sehr gern, Monsignore Meredith. Wenn ich nicht irre, sind Sie in Rom tätig? Leider beherrsche ich nicht Italienisch.»
Blaise Meredith gestattete sich ein leichtes, eisiges Lächeln. «Ich werde es selber übersetzen. Eine interessante Stilübung.»
«Ich bewundere Ihren Mut, Monsignore. Ich bin kein Anhänger des katholischen Glaubens – ich gehöre überhaupt keiner Kirche an –, aber ich stelle mir vor, daß die Religion in solchen Augenblicken ein großer Trost sein kann.»
«Hoffentlich, Herr Doktor», erwiderte Blaise Meredith ruhig.
«Aber ich trage schon allzu lange das geistliche Gewand, um mich darauf verlassen zu dürfen.»
Nun saß er auf einer Bank im Sonnenschein, die Luft war voller Frühling und die Zukunft eine kurze, leere Perspektive, die in die Ewigkeit mündete. In seiner Studentenzeit hatte er einmal einen alten Missionär über die Auferstehung des Lazarus predigen hören: Wie Christus vor dem versiegelten Grabgewölbe steht und Befehl gibt, es zu öffnen, so daß der Verwesungsgeruch in die stille, trockene Sommerluft herausströmt – wie Lazarus auf seine Aufforderung, in die Leichentücher gehüllt, aus dem Dunkel gestolpert kommt und blinzelnd im Sonnenlicht stehenbleibt. Was, hatte der alte Mann gefragt, empfand Lazarus in diesem Augenblick? Welchen Preis hatte er für die Rückkehr in die Welt der Lebenden gezahlt? War er von nun an ein Krüppel, dem jede Rose nach Verfall duftete und jedes goldhaarige Mädchen als ein schlotterndes Skelett erschien? Oder wandelte er in betäubendem Staunen über das neue Antlitz der Dinge, im Herzen zärtliches Mitleid und Liebe zum Menschengeschlecht?
Jahrelang hatte diese Überlegung Meredith interessiert. Einmal hatte er mit dem Gedanken gespielt, einen Roman darüber zu schreiben. Nun kannte er endlich die Antwort. Nichts ist dem Menschen so köstlich wie das Leben, nichts kostbarer als die Zeit, nichts erquickender als die Berührung von Erde und Gras, das Säuseln wehender Winde, der Duft neuerblühter Blumen, Menschenstimmen und Verkehrslärm und schriller Vogelsang.
Das war es, was ihn stets beunruhigt hatte. Vor zwanzig Jahren war er zum Priester geweiht worden; zwanzig Jahre lang hatte er sich der These verschworen, daß das Leben vergänglich und unvollkommen sei, die Erde ein bläßliches Abbild des Schöpfers, die Seele etwas Unsterbliches in sterblicher Hülle, das bis zur Erschöpfung kämpft, um in die allumfassenden Arme des Allmächtigen zu flüchten. Nun, da ihm seine eigene Befreiung verheißen und der Tag des Heils festgesetzt war, warum konnte er es nicht hinnehmen, wenn auch nicht mit Freuden, so doch mit Zuversicht?
Warum klammerte er sich an etwas, das er noch vor kurzem verworfen hatte? Frau? Kind? Familie? Es gab keine lebende Seele, die ihm angehörte. Besitztümer? Sie waren recht spärlich: eine kleine Wohnung in der Nähe der Porta Angelica, ein paar Schmuckstücke, ein Zimmer voller Bücher, ein bescheidenes Stipendium von der Ritenkongregation, eine Jahresrente, die seine Mutter ihm hinterlassen hatte. Nichts, das einen Menschen von der Schwelle der großen Offenbarung fortlocken könnte. Karriere? Daran mochte etwas sein: Auditor der Congregatio Sacrorum Rituum, persönlicher Assistent des Präfekten Eugenio Kardinal Marotta. Ein einflußreicher Posten, eine schmeichelhafte Vertrauensstellung. Man sitzt im Schatten des Papstes. Man beobachtet das komplizierte, delikate Getriebe einer mächtigen Theokratie. Man lebt in schlichter Bequemlichkeit. Man hat Zeit zu studieren, man kann sich in den Grenzen des Herkommens und Ermessens frei bewegen. Daran konnte einem schon etwas liegen; – aber es genügte nicht – es genügte bei weitem nicht für einen Menschen, der nach der vollendeten Harmonie lechzt, die er sein Leben lang gepredigt hat.
Vielleicht war das die Quintessenz. Er hatte nie nach einem bestimmten Ziel gelechzt. Er hatte immer das besessen, was er sich wünschte, und sich nie mehr gewünscht, als ihm erreichbar war. Er hatte sich der kirchlichen Disziplin unterworfen, und die Kirche hatte ihm Geborgenheit, Behagen und einen Wirkungskreis geschenkt. Er war zufriedener gewesen, als die meisten Menschen es sind – und wenn er nie das Glück begehrt hatte, dann nur deshalb, weil er sich nie unglücklich gefühlt hatte: bis heute – bis zu dieser düsteren Stunde im Sonnenschein, im Frühlingsanfang, im letzten Frühling, der Blaise Meredith noch vergönnt war.
Der letzte Frühling, der letzte Sommer. Der Stummel des Lebens, zerkaut und ausgelutscht wie ein Kaubonbon, das man zuletzt in den Mülleimer wirft. Die Bitterkeit, der saure Geschmack des Fiaskos und der Enttäuschung. Was kann er sich an Verdiensten zumessen und auf den Weg zum Jüngsten Gericht mitnehmen? Was läßt er zurück, das die Menschen bewegen würde, sich seiner zu erinnern?
Nie hatte er ein Kind gezeugt, nie einen Baum gepflanzt, nie einen Baustein auf den anderen gesetzt, um ein Haus oder ein Denkmal zu errichten. Er hatte keinen Zorn versprüht, er hatte keine Almosen gespendet. Sein Werk würde namenlos in den Archiven des Vatikans vermodern. Was immer für Leistungen seiner priesterlichen Tätigkeit entsprungen sein mochten, sie waren sakramentaler und nicht persönlicher Natur. Kein Armer würde ihm für die Brosamen, kein Kranker für den Zuspruch, kein Sünder für die Erlösung danken. Er hatte alles getan, was von ihm verlangt worden war, dennoch würde er mit leeren Händen sterben, und binnen vier Wochen würde sein Name verwehter Staub sein in den Wüsten der Jahrhunderte.
Plötzlich packte ihn die Angst. Der kalte Schweiß brach ihm aus. Seine Hände begannen zu zittern, und eine Schar von Kindern, die in der Nähe der Bank Ball spielten, rückten von dem hageren, grauwangigen Priester ab, der mit blinden Augen auf das glitzernde Wasser des Teichs hinausblickte.
Langsam wich der Krampf. Die Furcht legte sich, die Ruhe kehrte zurück. Die Vernunft siegte, und er fing an, sich zu überlegen, wie er sein Leben in der noch verfügbaren Frist ordnen könnte.
Als er in Rom erkrankt war, als die italienischen Ärzte ihre erste, vorläufige Diagnose stellten, hatte er sich instinktiv entschlossen, nach London zurückzukehren. Wenn das Todesurteil unvermeidlich war, wollte er es in seiner Muttersprache vernehmen. Wenn ihm das Leben verkürzt werden sollte, dann wollte er den Rest in der milden Luft Englands verbringen, auf den Dünen und in den Buchenwäldern spazierengehen und dem elegischen Gesang der Nachtigallen im Schatten alter Kirchen lauschen, wo der Tod vertrauter und freundlicher ist, denn die Engländer haben ihm im Laufe der Jahrhunderte höfliche Sitten beigebracht.
In Italien ist der Tod schroff, dramatisch – ein großes Opernfinale mit wehklagendem Chor und wehenden Federbüschen und schwarzen Barockleichenwagen, die an Stuckpalästen vorbei zu den Marmorgrüften des Campo Santo rollen. Hier in England hat er sanftere Aspekte: diskret gemurmelter Nachruf in einem normannischen Kirchenschiff, das geöffnete Grab im gemähten Rasen zwischen verwitterten Steinen, die Trankopfer unter dem Dachgebälk der Kneipe, die dem Friedhofstor gegenüberliegt.
Nun hatte auch dies sich als Illusion erwiesen, als rührender Trugschluß; es war keine Wehr gegen den grauen, heimtückischen Feind, der sich in seinem eigenen Leib verschanzt hatte. Er konnte ihm nicht entrinnen – ebensowenig wie der Überzeugung, daß er als Priester und als Mensch versagt habe.
Was tun? Sich dem Messer ausliefern? Die Qual verkürzen, die Angst beschneiden und die Einsamkeit auf ein erträgliches Maß begrenzen? Würde das nicht ein neues Fiasko sein, eine Art Selbstmord, den die Moralisten rechtfertigen mögen, den jedoch das Gewissen nie ganz verzeihen kann? Er hatte bereits genug Schulden – dieser letzte Posten könnte ihn bankrott machen.
Die Tätigkeit wieder aufnehmen? An dem alten Schreibtisch sitzen, unter der Kassettendecke des Palastes der Kongregationen in Rom? Die mächtigen Folianten aufschlagen, in denen tausend Schreiber die Lebensläufe, Werke und Schriften längstverstorbener Anwärter auf die Heiligsprechung verzeichnet haben? Sie prüfen, zergliedern, analysieren und kommentieren? Ihre Tugenden in Frage stellen und neue Zweifel auf die ihnen zugeschriebenen Wunder werfen? In einem neuen Schriftsatz neue Anmerkungen notieren? Zu welchem Zweck? Damit abermals ein Anwärter auf kanonische Ehren zurückgewiesen wird, weil er nicht heroisch oder nicht weise genug gewesen war? Oder damit vielleicht ein halbes Jahrhundert später ein neuer Papst in der Peterskirche verkünden wird, der Kalender sei um einen neuen Heiligen bereichert worden?
Kümmert es die Toten, was er über sie schreibt? Kümmert es sie, ob eine neue Büste einen Heiligenschein tragen darf oder ob die Druckereien eine Million kleiner Karten verbreiten, die auf der Vorderseite ihre Gesichter und auf der Rückseite ihre Meriten zeigen? Belächeln sie ihre liebenswürdigen Biographen oder grollen sie ihren beamteten Lästerern? Sie sind längst begraben und abgeurteilt, so, wie auch er nun sterben und bald vor seinen Richter treten wird. Der Rest ist lauter Addendum, Postskript, durchaus entbehrlich. Ein neuer Kult, ein neues Wallfahrtsziel, eine neue Messe in der Liturgie werden sie nicht im geringsten berühren. Blaise Meredith, Priester, Philosoph, Kanoniker, mochte zwölf Monate oder zwölf Jahre lang ihre Akten bearbeiten, ohne dadurch auch nur ein Jota zu ihrer Glückseligkeit oder zu ihrer Verdammnis beizutragen.
Trotzdem war das seine Arbeit; er hatte sie zu verrichten, weil sie für ihn bereitlag – und weil er zu müde, zu krank war, um mit einer anderen zu beginnen. Jeden Tag wird er die Messe lesen, sein tägliches Pensum im Palast der Kongregationen erledigen, ab und zu in der englischen Kirche eine Predigt halten, in Vertretung eines beurlaubten Kollegen die Beichte abnehmen, allabendlich in seine Wohnung an der Porta Angelica zurückkehren, ein wenig lesen, das Abendgebet verrichten und sich dann durch die schlaflose Nacht bis zu dem sauren Morgen durchkämpfen. Zwölf Monate lang. Dann wird er tot sein. Eine Woche lang wird man seinen Namen während der Messe nennen – «unser Bruder Blaise Meredith» –. Nachher wird er sich zu der anonymen und vergessenen Schar derer gesellen, die nur ganz allgemein erwähnt werden: «Alle die im Glauben Dahingeschiedenen.»
Jetzt war es kalt geworden. Die Liebespaare streiften das Gras von ihren Kleidern, die jungen Mädchen strichen ihre Röcke glatt. Die Kinder tapsten verdrossen hinter den scheltenden Eltern her. Die Schwäne zogen sich mit gesträubtem Gefieder in den Schutz der Inselchen zurück, begleitet von dem dumpfen Getöse des Stoßverkehrs.
Zeit, aufzubrechen. Zeit für Monsignore Blaise Meredith, seine kummervollen Gedanken einzupacken und die hageren Züge zu einem verbindlichen Lächeln zu formen, weil in Westminster die Teestunde des Diözesanverwalters auf ihn wartete. Die Engländer sind höfliche und tolerante Leute. Sie verlangen von jedem Menschen, daß er sein Seelenheil nüchtern und seine Verdammnis diskret besorge, sich mit Anstand betrinke und seine Kümmernisse für sich behalte. Heilige erregen ihr Mißtrauen, vor Mystikern sind sie auf der Hut, und halb und halb bilden sie sich ein, der allmächtige Gott sei in diesem Punkt derselben Meinung wie sie. Selbst in der Stunde seines privaten Gethsemane freute sich Meredith über die Konventionen, die ihn zwingen würden, sich zu vergessen und sich dem Geplauder seiner Amtsbrüder zu widmen.
Mit steifen Gliedern erhob er sich von der Bank, blieb lange stehen, als wüßte er nicht recht, ob er in diesem Leib zu Hause sei, und ging dann festen Schrittes auf die Brompton Road zu.
Doktor Aldo Meyer hatte an diesem milden Mittelmeerabend seine besonderen Sorgen. Er war bemüht, sich zu betrinken – so schnell und schmerzlos wie nur möglich.
Die Chancen waren gering. Das Lokal, in dem er trank, war ein niedriges Steingewölbe mit einem Lehmboden, der nach verschüttetem Wein stank. Seine Gesellschaft bestand aus einem ungeschlachten Weinbauern und einer stämmigen Magd mit dem Nacken und dem Hinterteil eines Ochsen, mit feisten Melonenbrüsten, die aus einem schmierigen schwarzen Kleid hervorquollen. Das Getränk war scharfer Grappa, der auch den hartnäckigsten Kummer zu ertränken vermag – aber Aldo Meyer war viel zu enthaltsam und viel zu intelligent, um ihn genießen zu können.
Er saß vornübergebeugt auf der rohgezimmerten Bank, neben ihm stand eine tropfende Kerze; er starrte in seinen Becher und zeichnete monotone Ornamente in den vergossenen Schnaps, der träge hinter seinem Finger einhersickerte. Der Padrone lehnte an der Theke, stocherte mit einem Zweiglein in seinen Zähnen herum und sog die Reste des Abendessens geräuschvoll durch die Lücken. Die Kellnerin saß im Schatten und wartete darauf, den Becher frisch zu füllen, sowie der Arzt ihn geleert hatte. Zuerst hatte er hastig getrunken, an jedem Schluck beinahe erstickend, dann immer langsamer, je mehr der rohe Schnaps zu wirken begann. Während der letzten zehn Minuten hatte er gar nichts mehr getrunken. Es war, als erwarte er, daß sich etwas ereigne, bevor er sich endgültig dem Vergessen ergab.
Er war noch keine fünfzig Jahre alt, aber er sah aus wie ein alter Mann. Sein Haar war weiß, die Haut des feingezeichneten jüdischen Gesichts straff über die Knochen gespannt. Die Hände waren lang und geschmeidig, aber schwielig wie die eines Landarbeiters. Er trug einen unvorteilhaft geschnittenen Anzug mit zerfransten Manschetten und speckigen Aufschlägen, aber seine Schuhe waren geputzt und die Unterwäsche sauber bis auf die frischen Grappaflecken. Er hatte einen Anstrich verblichener Eleganz an sich, der schlecht zu der ordinären Umgebung und der derben Vitalität der Kellnerin und des Padrone paßte.
Gemello Minore lag weit von Rom entfernt und noch weiter von London. Die schmutzige Weinkneipe hatte nicht die geringste Ähnlichkeit mit dem Palast der Kongregationen. Aber Doktor Aldo Meyer war ebenso wie Blaise Meredith mit dem Problem des Todes beschäftigt; auch er, der Skeptiker, sah sich vor die Frage nach dem Sinn der Heiligsprechung gestellt.
Am späten Nachmittag war er in das Haus Pietro Rossis gerufen worden, dessen Frau seit zehn Tagen in Wehen lag. Die Hebamme war verzweifelt, das Zimmer wimmelte von Frauen, die wie die Gänse schnatterten, während Maria Rossi ächzte und sich in Krämpfen wand und, wenn die Wehen nachließen, vor Erschöpfung nur noch leise stöhnte. Vor der Hütte waren die Männer versammelt, unterhielten sich mit gedämpften Stimmen und ließen eine Weinflasche von Hand zu Hand gehen.
Als der Arzt erschien, verstummten sie und betrachteten ihn mit schiefen, forschenden Blicken, während Pietro Rossi ihn hineinführte. Seit zwanzig Jahren lebte er in ihrer Mitte, war aber noch immer ein Fremdling. An solchen Wendepunkten ihres Sippendaseins brauchten sie vielleicht seine Dienste, aber er war nie gerne bei ihnen gesehen.
In dem mit Weibern angefüllten Raum war es dieselbe Geschichte: Schweigen, Argwohn, Feindseligkeit. Als er sich über das breite Messingbett beugte, den aufgeschwollenen Leib abtastend und sondierend, standen die Hebamme und die Mutter der jungen Frau dicht neben ihm, und wenn eine neue Wehe kam, fingen sie erschrocken zu murmeln an, als ob er daran schuld wäre.
Binnen drei Minuten wußte er, daß eine normale Entbindung nicht mehr zu erhoffen war. Er würde einen Kaiserschnitt vornehmen müssen. Diese Aussicht machte ihm keine besondere Sorge. Er hatte solche Eingriffe schon öfter vollzogen, bei Kerzen- und Lampenlicht, auf Küchentischen und Bretterbänken. Heißes Wasser, ein Betäubungsmittel und die Widerstandskraft der Bergbewohnerinnen: Damit war ein glücklicher Ausgang vor vornherein so gut wie gegeben.
Er rechnete mit heftigen Protesten. Diese Menschen sind so dickköpfig wie Maulesel und geraten doppelt so leicht in Panik – aber auf einen Ausbruch war er nicht gefaßt. Die Mutter der jungen Frau, eine dicke, muskulöse Megäre mit strähnigem Haar, breiten Zahnlücken und schwarzen Schlangenaugen, begann damit. Sie schrie auf ihn ein, in ihrem plumpen Dialekt:
«Mir wirst du nicht mit dem Messer im Bauch meiner Tochter herumwühlen. Ich will lebende Enkel haben, keine toten! Ihr Ärzte seid alle gleich. Wenn ihr die Menschen nicht gesund machen könnt, dann schneidet ihr sie in Stücke und begrabt sie. Aber nicht meine Tochter! Man muß ihr nur Zeit lassen, dann spuckt sie es aus wie eine Erbse. Ich hab’ zwölfe gekriegt. Ich muß es wissen. Es war nicht immer leicht, aber ich habe sie gekriegt – und ich habe keinen Pferdeschlächter dafür gebraucht.»
Ein schrilles Gelächter übertönte das Ächzen der jungen Frau. Aldo Meyer stand da, beobachtete sie, kümmerte sich nicht um die Weiber, sagte ganz einfach:
«Wenn ich nicht operiere, ist sie um Mitternacht tot.»
Das hatte schon öfters gewirkt – die nüchterne, sachverständige Erklärung, die Verachtung ihrer Unwissenheit: Diesmal aber ging es glatt daneben. Die Frau lachte ihm ins Gesicht.
«Diesmal nicht, Judenmensch! Weißt du, warum?» Sie faßte in ihr Kleid und holte einen kleinen, in verschossene rote Seide eingewickelten Gegenstand hervor, den sie ihm unter die Nase hielt.
«Weißt du, was das ist? Natürlich weißt du es nicht – weil du ein Heide und ein Christusmörder bist. Wir haben jetzt unseren eigenen Heiligen. Einen echten Heiligen! Jeden Augenblick wird man ihn in Rom heiligsprechen. Das ist ein Fetzen von seinem Hemd. Eine echte, lebende Reliquie, mit seinem Blut getränkt. Er hat auch Wunder getan. Richtige Wunder. Es steht alles aufgeschrieben. Man hat es dem Papst geschickt. Glaubst du, daß du mehr ausrichten kannst als er? Ja? Für wen entscheiden wir uns, Leute – für unseren eigenen Heiligen, Giacomo Nerone, oder für diesen Kerl?»
Die junge Frau auf dem Bett stieß einen jähen Schmerzensschrei aus, und die Weiber verstummten, während die Mutter sich über sie beugte, leise Trostworte murmelte und die schmutzige Reliquie unter der Decke mit kreisförmigen Bewegungen an dem aufgeblähten Leib entlangführte. Aldo Meyer wartete eine Weile und suchte nach den richtigen Worten. Als die junge Frau sich wieder beruhigt hatte, sagte er mit ernster Miene:
«Auch ein Heide weiß, daß es eine Sünde ist, Wunder zu erwarten, ohne daß man selber versucht, Hilfe zu leisten. Man darf nicht die Arznei wegwerfen und damit rechnen, daß die Heiligen einen gesund machen werden. Außerdem ist dieser Giacomo Nerone noch kein Heiliger. Es wird lange dauern, bis sie in Rom auch nur anfangen, über seinen Fall zu reden. Betet zu ihm, wenn ihr wollt, aber bittet ihn, mir eine feste Hand und der jungen Frau ein starkes Herz zu schenken. Seid jetzt nicht dumm, gebt mir kochendes Wasser und saubere Tücher. Ich habe nicht mehr viel Zeit.»
Niemand rührte sich. Die Mutter vertrat ihm den Zugang zum Bett. Die Weiber bildeten einen engen Halbkreis und scheuchten ihn zur Tür, während Pietro Rossi mit ausdruckslosem Gesicht dabeistand und sich den dramatischen Vorgang mit ansah. Aldo Meyer wandte sich an ihn und versuchte, ihn aufzurütteln.
«Du, Pietro! Willst du ein Kind haben? Willst du deine Frau behalten? Dann hör mich um Gottes willen an. Wenn ich nicht schnell operiere, wird sie sterben, und das Kind wird mit ihr sterben. Du weißt, was ich kann – es gibt zwanzig Leute im Dorf, die es dir sagen werden. Aber du weißt nicht, was dieser Giacomo Nerone kann – auch wenn er ein Heiliger ist –, was ich sehr bezweifle.»
Pietro Rossi schüttelte halsstarrig den Kopf.
«Das ist unnatürlich, ein Kind herauszureißen wie Schafsdärme. Außerdem ist er kein gewöhnlicher Heiliger. Er ist unser Heiliger. Er gehört uns. Er wird für uns sorgen. Geh jetzt, Doktor.»
«Wenn ich jetzt gehe, wird deine Frau die Mittemacht nicht mehr erleben.»
Das glatte Bauerngesicht war leer wie eine Wand. Aldo Meyer sah sie sich der Reihe nach an, die dunkelhäutigen, geheimnisvollen Menschen des Südens, und es wurde ihm bewußt, wie verzweifelt wenig er über sie wußte, welch geringen Einfluß er auf sie hatte. Resigniert zuckte er die Schultern, nahm seine Tasche und ging zur Tür. Auf der Schwelle blieb er stehen und drehte sich noch einmal um.
«Verständigt Vater Anselmo. Die Zeit drängt.»
Die Mutter spuckte verachtungsvoll auf den Fußboden und bückte sich dann abermals, um den zuckenden Bauch ihrer Tochter mit dem kleinen Seidenbausch abzureiben, wobei sie in ihrem Dialekt Gebete vor sich hin murmelte. Die übrigen Weiber beobachteten ihn stumm und mit kalten Mienen. Als er auf die mit Katzenköpfen gepflasterte Straße hinausging, fühlte er die Blicke der Männer wie Messer im Rücken. Da beschloß er, sich zu betrinken.
Für Aldo Meyer, den alten Liberalen, den Mann, der an die Menschen glaubte, war das das endgültige Zeichen der Niederlage. Hoffnungslos, diese Menschen. Raubgierig wie Geier. Sie fressen dir das Herz aus dem Leibe und lassen dich in einem Graben verfaulen. Er hatte für sie gelitten, für sie gekämpft und versucht, sie zu erziehen, aber sie nahmen alles entgegen und lernten nichts. Sie spotteten über die elementarsten Kenntnisse, schluckten jedoch Legenden und jeden Aberglauben gierig wie kleine Kinder.
Nur die Kirche kann sie zügeln, ohne sie bessern zu können. Sie schreckt sie mit Teufeln, lädt ihnen die Heiligen auf den Hals, schmeichelt ihnen mit weinenden Madonnen und feisten Bambini. Sie kann sie bis zum Weißbluten schröpfen für einen neuen Kandelaber, aber kann – oder will – sie nicht dazu bewegen, sich in der Klinik gegen Typhus impfen zu lassen. Die Mütter siechen an Tuberkulose dahin, ihre Kinder haben eine geschwollene Milz von den ständigen Malariaanfällen. Aber lieber würden sie einen Teufel in den Mund nehmen als eine Atebrintablette – auch wenn der Arzt sie aus seiner Tasche bezahlt.
Sie leben in Hütten, in denen ein tüchtiger Landwirt nicht einmal sein Vieh unterbringen würde. Sie essen Oliven und Makkaroni und in Öl getunktes Brot und an Feiertagen Ziegenfleisch, wenn sie welches haben. Die Berge sind unbewaldet, die Terrassen mit kärglicher Erde bedeckt, deren Krume der erste Regenguß wegschwemmt. Der Wein ist dünn, der Mais mager, und sie bewegen sich mit dem trägen Gang von Menschen, die zu wenig essen und zu schwer arbeiten.
Die Großgrundbesitzer beuten sie aus, aber sie hängen sich ihnen wie Kinder an die Rockschöße. Ihre Priester fallen oft der Trunksucht anheim oder leben in wilder Ehe, aber sie ernähren sie mit ihren armseligen Groschen und behandeln sie mit toleranter Geringschätzung. Kommt der Sommer verspätet oder war der Winter streng, dann verbrennt der Frost die Oliven, und in den Bergen herrscht Hungersnot. Sie haben keine Schulen, und was der Staat nicht zur Verfügung stellt, das wollen sie unter keinen Umständen selber schaffen. Sie denken nicht daran, ihre Mußezeit zu opfern, um ein Schulhaus zu bauen. Eine Lehrkraft können sie nicht bezahlen, aber sie greifen tief in ihren winzigen Lirevorrat, um die Kanonisierung eines neuen Heiligen für einen ohnedies schon mit Heiligen überladenen Kalender zu finanzieren.
Aldo Meyer betrachtete den dunklen Bodensatz seines Grappa und las dort nichts als Aussichtslosigkeit, Enttäuschung und Verzweiflung. Er hob den Becher und leerte ihn auf einen Zug. Der Bodensatz schmeckte bitter wie Wermut und wärmte nicht im geringsten.
Er war als Flüchtling hierhergekommen, damals, als die Fascisti die Juden, die linksstehenden Intellektuellen und die allzu lauten Liberalen zusammentrieben und sie vor die enge Wahl stellten: Verbauerung in Kalabrien oder Zwangsarbeit auf Lipari. Sie hatten ihm den ironischen Titel eines Amtsarztes verliehen, aber weder ein Gehalt noch Medikamente noch Betäubungsmittel bewilligt. Er hatte, als er ankam, nichts bei sich gehabt als die Kleider, die er am Leibe trug, eine Tasche mit Instrumenten, ein Fläschchen mit Aspirintabletten und ein medizinisches Nachschlagewerk. Sechs Jahre lang hatte er gekämpft und intrigiert, geschmeichelt und erpreßt, um in einem Gebiet chronischer Unterernährung, endemischer Malaria und häufiger Typhusepidemien einen rudimentären Gesundheitsdienst aufzubauen.
Er wohnte in einem halbverfallenen Bauernhaus, das er eigenhändig instand setzte. Mit Hilfe eines schwachsinnigen Landarbeiters bestellte er einen steinigen Acker, der ungefähr zwei Morgen groß war. Ein Zimmer des Hauses diente als Spital, die Küche als Operationssaal. Die Bauern zahlten in natura, sofern sie überhaupt zahlten, und von den Ortsbehörden erhob er einen gewissen Tribut an Arzneimitteln und chirurgischen Instrumenten; sie schützten ihn auch vor einer feindselig eingestellten Regierung. Es war eine bittere Sklaverei gewesen, aber es hatte auch Stunden des Triumphs gegeben, Tage, an denen es so aussah, als sei es ihm endlich gelungen, in den geschlossenen Kreis des primitiven Berglebens einzudringen.
Als die Alliierten die Straße von Messina überschritten und ihren langsamen, blutigen Vormarsch über die Halbinsel antraten, war er geflüchtet und hatte sich den Widerstandskämpfern angeschlossen, und nach dem Waffenstillstand hatte er eine kurze Zeit in Rom zugebracht. Aber er war zu lange weggewesen. Alte Freunde waren gestorben, neue schwer zu erwerben, und die kleinen Siege der Heuschreckenjahre spornten ihn zu größeren an. Ein freier Mensch, der etwas Geld, den guten Willen und den Drang nach Reformen besitzt, könnte vielleicht dort unten im Süden Wunder wirken.
Deshalb war er zurückgekehrt – in das alte Haus, an den alten Ort, aber mit einem neuen Traum und dem Gefühl, wieder jung zu sein. Er wollte nicht nur Arzt, sondern auch Lehrer sein. Er wollte eine genossenschaftliche Mustervereinigung schaffen, eine Organisation, der Zuschüsse aus Rom und Unterstützungen aus ausländischen Fonds zufließen würden. Er wollte die Leute zur Hygiene erziehen und sie lehren, den Boden zu verbessern und Bewässerungssysteme anzulegen. Er wollte junge Menschen heranbilden, die seine Botschaft in die abgelegenen Gegenden trügen. Er wollte ein Missionär des Fortschritts werden in einem Lande, in dem der Fortschritt vor drei Jahrhunderten haltgemacht hatte.
Vor zwölf Jahren war es ein schöner, frischer Traum gewesen. Jetzt hatte er sich als eine traurige Illusion entpuppt. Aldo Meyer war in den Fehler aller Liberalen verfallen, anzunehmen, daß die Menschen gewillt seien, sich zu bessern, daß das Gute den guten Willen erwecke, daß die Wahrheit an und für sich eine belebende Kraft besitze. Seine Pläne waren an der Bestechlichkeit der Beamten, an dem konservativen Geist einer feudalen Kirche und an dem Mißtrauen einer primitiven, unwissenden Bevölkerung gescheitert.
Selbst durch die dicken Dünste des Alkohols sah er das alles nur allzu klar. Er war ein geschlagener Mann. Seine Feinde hatten ihn besiegt. Er hatte sich selber besiegt. Und nun war es zu spät, etwas daran zu ändern.
Aus dem Dunkel vor den Fenstern kam das langgezogene Wehklagen zahlreicher Frauenstimmen. Die Magd und der Padrone sahen einander an und bekreuzigten sich. Der Arzt erhob sich, ging auf unsicheren Beinen zur Tür, blieb dort stehen und blickte in die kühle Frühlingsdämmerung hinaus.
«Sie ist tot», sagte der Padrone mit seiner dumpfen, heiseren Stimme.
«Das mußt du dem Heiligen erzählen», sagte Aldo Meyer. «Ich gehe zu Bett.»
Als er auf die Straße hinaustorkelte, streckte ihm die Kellnerin die Zunge heraus und machte das Zeichen gegen den bösen Blick.
Die Totenklage wehte, an- und abschwellend wie der Wind, über die schlafenden Berge, folgte ihm über die mit runden Steinen gepflasterte Straße bis ins Haus, schlug gegen die Tür, zerrte an den Fensterläden und geisterte durch die Nacht seines unruhigen Schlummers.
In dieser selben Frühlingsdämmerung, als die Schatten länger wurden, ging Eugenio Kardinal Marotta im Garten seiner Villa spazieren. Tief unten zu seinen Füßen erwachte die Stadt aus der Betäubung des Nachmittags; mit lärmenden Hupen, knatternden Motorrollern und feilschenden Krämern ging sie wieder an ihre Geschäfte. Müden Trotts und bemitleidenswert kehrten die Touristen von der Peterskirche, von San Giovanni in Laterano und dem Kolosseum zurück. Die Blumenverkäuferinnen besprengten ihre Blumen, um für den letzten Angriff auf die Liebespaare der Spanischen Treppe gerüstet zu sein. Der Sonnenuntergang ergoß sich über die Hügel und auf die Dächer, aber drunten in den Gassen hingen schwere Dunstschwaden, und die Mauern der Gebäude waren grau und müde.
Oben in Parioli jedoch war die Luft rein, die Avenuen lagen still und friedlich da, und Seine Eminenz promenierte unter hängenden Palmwedeln dahin, begleitet vom Duft der Jasminblüten. Hohe Mauern mit Gittertoren schützten seine private Domäne, Bronzewappen an den Oberbalken der Türen und Fenster erinnerten an Rang und Titel Eugenio Kardinal Marottas: Erzbischof von Akropolis, Titularbischof von St. Clement, Präfekt der Congregatio Sanctorum Rituum, Propräfekt des Höchsten Gerichts der Apostolischen Signatur, Bevollmächtigter für die Auslegung des Kirchenrechts, Schutzherr der Söhne des heiligen Josef und der Töchter der Unbefleckten Maria und zwanzig anderer religiöser, gewichtiger Körperschaften der Heiligen Römischen Kirche.
Stattlich waren die Titel, stattlich auch die Machtbefugnisse, die sie mit sich brachten, aber Seine Eminenz trug sie mit Frohsinn und guter Laune, hinter denen sich ein scharfer Verstand und ein unbeugsamer Wille versteckten.
Er war ein untersetzter, rundlicher Mann mit kleinen Händen und Füßen, schlaffem Gesicht und hochgewölbtem, kahlem Kopf, auf dem wie auf einem Ei das scharlachrote Käppchen saß. Wohlwollend blinzelten seine grauen Augen, der Mund war klein und rot wie ein Frauenmündchen, der Teint von mattem Olivbraun. Er war dreiundsechzig Jahre alt, also noch recht jung für einen Mann, der bereits den Kardinalshut trug. Er arbeitete fleißig, wenn auch ohne sichtbare Anstrengung, und behielt trotzdem genug Kräfte übrig für die diplomatischen Schachzüge und Machtkämpfe innerhalb der Mauern des Vatikans.
Manche sahen in ihm einen geeigneten Anwärter auf den Heiligen Stuhl; zahlreicher aber waren die anderen, die meinten, der nächste Papst müsse ein frommerer Mann sein, dem weniger an diplomatischen Machenschaften liege als an einer Besserung der Sitten unter der Geistlichkeit wie unter den Laien. Eugenio Marotta gab sich damit zufrieden, geduldig der kommenden Dinge zu harren, denn er wußte, wer als Papst ins Konklave geht, wird es wahrscheinlich als Kardinal verlassen. Außerdem war der Heilige Vater zwar alt, aber noch lange nicht tot, und hatte nicht viel für Leute übrig, die nach seinen Schuhen trachteten.
Seine Eminenz ging also in seinem Villengarten zu Parioli spazieren, sah die Sonne über den Albanerbergen untergehen und dachte über die Fragen des Tages nach in der gelassenen Haltung eines Menschen, welcher weiß, daß er sie zu guter Letzt alle wird beantworten können.
Er konnte sich’s leisten, gelassen zu sein. Schritt für Schritt hatte er jene hohe Vorzugsstellung erreicht, aus der weder Mißgunst noch Ungnade ihn vertreiben konnten. Bis zu seinem Todestag würde er Kardinal bleiben, dem Protokoll nach ein Fürst, kraft unwiderruflicher Weihe ein Bischof, Bürger des kleinsten und unantastbarsten Staates auf Erden. Das war sehr viel für einen Mann in der Kraft seiner Jahre. Es fiel um so schwerer ins Gewicht, als er keine Frau mitzuschleppen hatte, keine Söhne und Töchter ihn plagten und er den Stacheln der Leidenschaften entrückt war. Weiter hätten Begabung und Ehrgeiz ihn bisher nicht treiben können.
Die nächste Etappe war der Stuhl Petri – aber das würde ein gewaltiger Sprung sein, halbwegs zur Welt hinaus, ins Vorgemach der Göttlichkeit. Der Mann, der den päpstlichen Siegelring und die dreifache Papstkrone trägt, trägt auch die Sünden der Welt wie einen bleiernen Mantel auf den Schultern. Einsam steht er auf windumbrauster Zinne, unter ihm liegt ausgebreitet der Teppich der Völker, und über ihm hängt das nackte Antlitz des Allmächtigen. Nur ein Dummkopf würde ihn um die Macht und den Glanz und die Schrecken seiner Würde beneiden. Und Eugenio Kardinal Marotta war bei weitem kein Dummkopf.
In dieser Stunde des Zwielichts und des Jasmins hatte er genug eigene Probleme.
Zwei Tage zuvor hatte man ihm einen Brief des Bischofs von Valenta auf den Schreibtisch gelegt. Valenta war eine kleine Diözese in einer verkommenen Gegend von Kalabrien, und der Bischof war ihm flüchtig bekannt als ein strenger Mann, reformfreudig und mit politischen Neigungen. Vor zwei Jahren hatte er dadurch Aufsehen erregt, daß er zwei Landpfarrer wegen Bruchs des Zölibats ihres Amtes enthob und einige seiner älteren Seelsorger wegen Unfähigkeit pensionierte. Die Wahlergebnisse aus seiner Diözese hatten einen deutlichen Umschwung zugunsten der Christlichen Demokraten gezeigt, und das hatte ihm ein päpstliches Belobigungsschreiben eingetragen. Nur die scharfsinnigen Beobachter, wie Kardinal Marotta, hatten festgestellt, daß der Stimmenzuwachs von der Monarchistischen Partei und nicht von den Kommunisten stammte, die gleichfalls leichte Gewinne zu verzeichnen hatten. Der Brief des Bischofs war schlicht und ausführlich – zu schlicht, um arglos zu sein, und zu ausführlich, um nicht bei einem geschulten Taktiker, wie dem Kardinal Marotta, Argwohn zu wecken.
Er begann mit blumenreichen und unterwürfigen Begrüßungsfloskeln, von einem bescheidenen Bischof an einen fürstlichen gerichtet. Dann hieß es, er, der Bischof von Valenta, habe von dem Dorfpfarrer und den Pfarrkindern der Dörfer Gemelli dei Monti eine Bittschrift erhalten, es möge die Seligsprechung des Gottesknechts Giacomo Nerone in Betracht gezogen werden.
Dieser Giacomo Nerone sei von kommunistischen Partisanen ermordet worden, und zwar unter Umständen, die man durchaus als ein Martyrium bezeichnen dürfe. Seit seinem Tode habe man ihm in den Dörfern und auf dem umliegenden Lande spontane Verehrung entgegengebracht und mehrere Wunderkuren seinem Einfluß zugeschrieben. Vorläufige Ermittlungen hätten den Ruf der Heiligkeit und den anscheinend wundertätigen Charakter der Heilungen bestätigt, und er, der Bischof, sei geneigt, den Wunsch der Bittsteller zu erfüllen und den Fall einer gerichtlichen Untersuchung zu unterbreiten. Zuvor jedoch wolle er Seine Eminenz als Präfekten der Ritenkongregation zu Rate ziehen und ihn bitten, von Rom aus zwei weise und gottesfürchtige Männer zu ernennen – den Advocatus Dei, den Postulator der Causa, der die Untersuchung einzuleiten und voranzutreiben, und den Advocatus Diaboli, den Teufelsadvokaten, der das Beweismaterial und die Zeugenaussagen gemäß den entsprechenden Bestimmungen des kanonischen Rechts der strengsten Prüfung zu unterziehen habe.
Er schrieb noch mehr, aber das war des Pudels Kern. Der Bischof rechnete mit der Möglichkeit, in seinem Amtsbereich einen Heiligen zu besitzen – noch dazu einen sehr brauchbaren Heiligen, dem die Kommunisten den Märtyrertod bereitet hatten.
Das ließ sich aber nur durch eine gerichtliche Untersuchung beweisen, die unter den Auspizien der Ritenkongregation zuerst in seiner eigenen Diözese und dann in Rom stattzufinden hatte. Die ersten Ermittlungen jedoch würden an seinem Amtssitz und unter seiner Aufsicht vor sich gehen, und er persönlich durfte die betreffenden Funktionäre ernennen. Bischöfe sind im allgemeinen sehr auf ihre Autonomie bedacht. Warum also dieser unterwürfige Appell an Rom?
Eugenio Kardinal Marotta spazierte über die gestutzten Rasenflächen seines Gartens und dachte über den Antrag nach.
Die beiden Dörfer Gemelli dei Monti liegen tief im Süden Italiens, wo neue Kulte wie die Pilze aus der Erde schießen und ebensoschnell verwelken, wo der Glaube mit einer dicken Patina von Aberglauben überzogen ist, wo die Bauern mit ein und derselben Hand das Kreuz schlagen und das Zeichen gegen den bösen Blick machen, wo über dem Bett das Bild des Jesuskindleins hängt und am Scheunentor die heidnischen Hörner festgenagelt sind. Der Bischof war ein schlauer Mann, der gern zum Wohl seiner Diözese einen Heiligen besessen hätte, aber nicht geneigt war, sein eigenes Renommee zugleich mit dem Ruf des Gottesknechts unter die Lupe nehmen zu lassen.
Wenn die Untersuchung günstig verlief, dann hatte er nicht nur einen beato, sondern auch eine Zuchtrute für die Kommunisten. Ging es schief, dann durfte man einen Teil der Schuld den weisen und gottesfürchtigen Herren aus Rom in die Schuhe schieben. Seine Eminenz lächelte in sich hinein. Sehr gerissen! Kratz’ einen Süditaliener, und es kommt der Fuchs zum Vorschein, der kilometerweit die Falle wittert und auf seinem Wege zum Hühnerstall einen Bogen um sie schlägt.
Es stand jedoch mehr auf dem Spiel als das Renommee eines Provinzbischofs. Es ging um politische Interessen. Schon in zwölf Monaten sollten in ganz Italien Neuwahlen stattfinden. Die öffentliche Meinung ist sehr empfindlich, wenn es sich um die Einflußnahme des Vatikans auf zivile Angelegenheiten handelt. Die antiklerikalen Kreise würden jede Gelegenheit begrüßen, um der Kirche eins auszuwischen, und sie verfügten bereits über genügend viele Waffen: Da mußte man ihnen nicht eine neue in die Hände spielen.
Noch tiefere Probleme hingen damit zusammen, die weniger die Zeit als die Ewigkeit angingen. Einen Menschen seligsprechen heißt, ihn zu einem heldenhaften Knecht Gottes stempeln, ihn als Vorbild und Fürsprecher der Frommen hinstellen. Seine Wundertaten anerkennen heißt, über alle Zweifel hinaus zugeben, daß durch ihn die Macht Gottes tätig gewesen sei, die die Naturgesetze aufgehoben oder außer Kraft gesetzt habe. In solchen Dingen ist ein Irrtum unvorstellbar. Der gesamte wuchtige Apparat der Ritenkongregation dient dem Zweck, solche Irrtümer zu vermeiden. Aber ein übereiltes Vorgehen, eine verpfuschte Untersuchung könnten zu einem üblen Skandal führen und das Vertrauen von Millionen Menschen zu der unfehlbaren Kirche erschüttern, die behauptet, unter der unmittelbaren Leitung des Heiligen Geistes zu stehen.
Seine Eminenz fröstelte, als das erste kühle Dunkel sich auf Parioli herabsenkte. Er war ein Mann, den die Macht verhärtet und die Routine zum Skeptiker gemacht hatte, aber auch er trug auf seinen Schultern die Bürde des Glaubens und in seinem Herzen die Furcht vor dem Höllenfürsten.
Weniger noch als jeder andere durfte er sich einen Mißgriff erlauben. Von ihm hing ja soviel mehr ab – die Strafe für den Mißgriff würde um so vieles strenger sein. Trotz seines pompösen Titels und der weltlichen Würde, die mit diesem verknüpft war, lag seine Hauptaufgabe auf geistlichem Gebiet. Sie galt den Seelen – ihrem Heil oder ihrer Verdammnis. Der Fluch des Mühlsteins konnte ebensogut einen irregeleiteten Kardinal wie einen sündigen Dorfpfarrer treffen. Deshalb spazierte er umher, in ernste Gedanken vertieft, während die leise Harmonie der Glocken aus der Stadt heraufwehte und die Grillen im Garten ihren schrillen Chorgesang anstimmten.
Er beschloß, dem Bischof von Valenta seinen kleinen Triumph zu gönnen und die geeigneten Männer für ihn zu wählen – einen Advocatus Dei, den Postulator, der das Material zu sammeln und vorzutragen hat, und einen Teufelsadvokaten, der es womöglich zu widerlegen hat. Von den beiden ist der Advokat des Teufels die wichtigere Figur. Der offizielle Titel umschreibt genau seine Funktion: Promotor des Glaubens. Er ist der Mann, der die Reinheit des Glaubens wahrt um jeden Preis – auch wenn es ein zerstörtes Leben und gebrochene Herzen kostet. Er muß ein gelehrter, peinlich genauer, leidenschaftsloser Mensch sein, von kaltem Verstand und unbarmherziger Strenge. Nächstenliebe und Frömmigkeit dürfen ihm fehlen, nicht aber Schärfe und Präzision. Solche Menschen sind selten, und die wenigen, die ihm zur Verfügung standen, waren bereits mit anderen Fällen beschäftigt.
Dann fiel ihm Blaise Meredith ein, der hagere, ernste, von der Blässe des Todes gezeichnete Mann. Er besaß die erforderlichen Eigenschaften. Er war Engländer, und damit wäre jeder politische Anstrich vermieden. Ob er jedoch noch den Willen und die nötige Zeit dazu hatte, war eine andere Frage. Wenn das ärztliche Gutachten ungünstig ausfiel, würde er vielleicht nicht geneigt sein, einen so schwierigen Auftrag zu übernehmen.
Immerhin war dies der Anfang einer Lösung. Seine Eminenz war nicht unzufrieden. Er machte einen letzten gemächlichen Rundgang um den dunkelnden Garten und kehrte dann in die Villa zurück, um mit seinen Hausgenossen die Abendandacht abzuhalten.