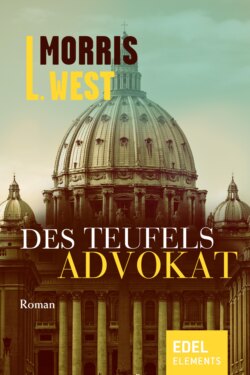Читать книгу Des Teufels Advokat - Morris L. West - Страница 6
3
ОглавлениеDr. Aldo Meyer stand in der Tür seines Hauses und sah zu, wie das Dorf schwerfällig zu einem neuen Tag erwachte.
Zuerst öffnete die alte Nonna Patucci ihre Tür, blickte nach links und rechts die mit runden Steinen gepflasterte Straße entlang, wackelte auf die andere Seite und entleerte ihren Nachttopf über die Mauer auf den darunterliegenden Weinberg. Dann ging sie ins Haus, verstohlen wie eine Hexe, und schloß die Tür mit lautem Knall. Wie auf ein Signal kam Felici, der Schuster, heraus, in Jacke, Hose und Holzpantinen, gähnte und kratzte sich unterm Arm und sah zu, wie die Sonne das Dach des neuen Krankenhauses in Gemello Maggiore jenseits des Tales beleuchtete. Nach einer beschaulichen Minute räusperte er sich geräuschvoll, spuckte aus und begann, die Fensterläden aufzuriegeln.
Dann wurde die Tür des Pfarrhauses geöffnet, und Rosa Benzoni kam heraus, fett und unförmig in einem schwarzen Kleid, um Wässer aus der Zisterne zu schöpfen. Kaum war sie verschwunden, ging oben ein Fenster auf, und Vater Anselmo streckte zaghaft seinen grauen Struwwelkopf dem neuen Tag entgegen.
Dann kam Martino, der Hufschmied, an die Reihe, vierschrötig, breitbrüstig und braun wie eine Nuß. Er öffnete das Tor seines Schuppens und setzte den Blasebalg in Gang. In dem Augenblick, da seine ersten Hammerschläge auf dem Amboß ertönten, rührte sich bereits das ganze Dorf – Weiber leerten Spüleimer aus, nacktbeinige Mädchen wanderten mit grünen Flaschen auf dem Kopf zum Brunnen hinunter, halbnackte Kinder pinkelten an die Straßenmauer, die ersten Arbeiter machten sich auf den Weg zu den Terrassen und kleinen Gärtchen, zerlumpte Röcke über die Schulter geworfen, Brot und Oliven in Baumwolltücher eingewickelt.
Das alles betrachtete Aldo Meyer ohne Neugier und ohne Groll, auch wenn sie mit abgewandtem Gesicht an ihm vorbeigingen oder gegen seine Tür das Zeichen gegen den bösen Blick machten. Es war bezeichnend für das Ausmaß seiner Ernüchterung, daß er ihre feindselige Haltung ignorieren und sich zugleich wie ein Tier an die vertrauten Bilder und Geräusche klammern konnte: das rhythmische Klirren des Hammers, das Gepolter eines Eselkarrens auf den Katzenköpfen, das schrille Kindergeschrei, das Schelten der Hausfrauen, die Weinberge und Olivenhaine, die am Bergeshang talwärts kletterten, die verstreuten, halb verfallenen Häuser längs der Straße bis zu der großen Villa hinauf, die den Gipfel krönte, der Glanz des Sonnenaufgangs über dem wohlhabenden Zwillingsort jenseits des Tales, wo der Heilige für die Touristen Wunder wirkte, während Maria Rossi mit seiner Reliquie auf dem Leib im Kindbett hatte sterben müssen.
Jeden Tag nahm er sich vor, morgen zu packen und wegzuziehen – in eine neue Gegend mit einer neuen Zukunft – und diese rohe Sippe ihrer Dummheit zu überlassen. Aber wenn der Abend kam, war der Entschluß verebbt, und er setzte sich hin, um sich in den Schlaf zu trinken. Die trostlose Wahrheit war die, daß er keine neue Stätte und keine neue Zukunft mehr finden konnte. Sein Bestes war hier zurückgeblieben – Glaube, Hoffnung und Liebe, bis zur Erschöpfung vergossen, von der unfruchtbaren Erde aufgesogen, zertreten von den undankbaren, unwissenden Menschen.
Aus der Tiefe des Tales war das gedämpfte Rattern eines Motorrades zu hören, und als er sich dem Geräusch zuwandte, sah er eine kleine Vespa mit einem Beifahrer in einer grauen Staubwolke den Weg heraufholpern. So alltäglich der Anblick war, erfüllte er Aldo Meyer jedoch mit kühler Heiterkeit. Die Vespa und das Auto der Contessa waren die einzigen Kraftfahrzeuge in Gemello Minore. Die Vespa hatte einen kleinen Aufruhr und gaffendes Staunen erregt, die Wochen angedauert hatten. Auch ihr Besitzer war eine wunderliche Erscheinung – ein englischer Maler, Hausgast der Contessa, die in der Villa auf dem Gipfel wohnte und der das gesamte Ackerland und auch der größte Teil des Dorfes gehörten. Der Maler hieß Nicholas Black, der Mann auf dem Soziussitz war ein blutjunger Bursch aus dem Ort, Paolo Sanduzzi, der sich Black als Führer, Packesel und Interpret des Dialekts und der ortsüblichen Sitten angeschlossen hatte.
Für die Dorfbewohner war der Engländer ein matto – ein Verrückter, der mit einem Zeichenblock umherwanderte oder stundenlang in der Sonne saß, um Olivenbäume, Felsblöcke und Ruinen zu malen. Seine Kleidung war genauso verrückt wie seine Manieren, ein hellrotes Hemd, eine verschossene blaue Baumwollhose, Bastsandalen und ein zerbeulter Strohhut, unter dessen Krempe ein faunisches Gesicht mit schiefem Lächeln die Umwelt betrachtete. Er konnte sich nicht einmal mit seiner Jugend entschuldigen – er war über dreißig –, und als die jungen Mädchen aufhörten, nach ihm zu seufzen, begannen die älteren Leute rohen Klatsch über seine Beziehungen zu der Contessa zu verbreiten, die in einsamer Pracht hinter den Gittertoren ihrer Villa hauste.
Aldo Meyer hörte die Gerüchte und schob sie beiseite. Er kannte die Contessa zu gut, und in seiner römischen Zeit hatte er nur allzu viele Künstler und auch genug Engländer vom Schlage Nicholas Blacks kennengelernt. Seine Neugier galt weit mehr dem jungen Paolo Sanduzzi mit seinen schlanken Arabergliedern, dem glatten Gesicht und den funkelnden, schlauen Augen und seinem tyrannischen Einfluß auf seinen exzentrischen Herrn. Meyers Neugier war um so größer, als er selber den Burschen zur Welt hatte kommen sehen und wußte, daß sein Vater Giacomo Nerone war, den die Leute als ihren Heiligen bezeichneten.
Am unteren Ende des Dorfes machte die Vespa halt, der junge Bursch stieg ab, und Meyer sah ihn über den Hang auf das Haus seiner Mutter zuklettern, eine plumpe Steinhütte in einem kleinen Gärtchen, von einigen Stechpalmen beschattet. Die Vespa fuhr knatternd weiter und hielt ein paar Augenblicke später vor Aldo Meyers Haus. Der Maler stemmte sich steifbeinig aus dem Sattel und erhob den Arm in theatralischer Begrüßung.
«Come sta, Dottore? Wie geht es heute? Ich möchte gern Kaffee trinken, wenn Sie welchen haben.»
«Kaffee habe ich immer», erwiderte Meyer lächelnd. «Wie sollte ich sonst dem Sonnenaufgang gewachsen sein?»
«Katzenjammer?» fragte der Maler mit boshafter Unschuldsmiene.
Meyer zuckte die Schultern und ging voran ins Haus und dann in einen kleinen ummauerten Garten, in dem ein alter grauer Feigenbaum ein Schutzdach gegen das Sonnenlicht bildete. Ein rohgezimmerter Tisch war mit einem karierten Tuch und Tassen und Tellern gedeckt. Das Geschirr war kalabresische Keramik. Eine Frau beugte sich über den Tisch, legte frisches Brot und ein Stück weißen Käse auf und stellte eine Schüssel mit den kleinen einheimischen Früchten hin.
Ihre Beine und Füße waren nach Bauernart nackt; sie trug ein schwarzes Baumwollkleid und ein schwarzes Kopftuch, alles tadellos sauber. Ihr Rücken war gerade, ihre Brüste waren voll und fest, das Gesicht von reingriechischem Schnitt, als ob in uralter Zeit ein Kolonist sich von der Küste ins Gebirge verirrt und eine Eingeborene geheiratet hätte, um diese neue Mischrasse zu erzeugen. Sie war sechsunddreißig Jahre alt. Sie hatte ein Kind geboren, war aber nicht dick geworden wie die Gebirglerinnen. Ihr Mund und ihre Augen wirkten seltsam heiter. Als sie den Besucher erblickte, zuckte sie vor Erstaunen leicht zusammen und sah Meyer fragend an. Er sagte nichts, gab ihr jedoch einen leisen Wink, sie möge verschwinden. Als sie ins Haus ging, folgten ihr die Blicke des Malers, und er grinste wie ein weißer Ziegenbock.
«Ich wundere mich über Sie, Doktor. Wo haben Sie sie aufgegabelt? Ich habe sie noch nie gesehen.»
«Sie ist von hier», erwiderte Meyer kühl. «Sie hat selber ein Haus und lebt ziemlich zurückgezogen. Sie kommt jeden Tag zu mir, um aufzuräumen und zu kochen.»
«Ich möchte sie gerne malen.»
«Das würde ich Ihnen nicht raten», sagte Meyer kurz.
«Warum nicht?»
«Sie ist die Mutter Paolo Sanduzzis.»
«Oh.» Black wurde rot und ließ das Thema fallen. Sie setzten sich zu Tisch, Meyer schenkte Kaffee ein. Ein paar Augenblicke lang herrschte Schweigen, dann begann Black zu sprechen, redselig und theatralisch.
«Große Neuigkeiten aus Valenta, Dottore! Ich war gestern unten, um Leinwand und Farben zu kaufen. Die ganze Stadt spricht davon.»
«Was für Neuigkeiten?»
«Euer Heiliger, Giacomo Nerone. Offenbar will man ihn seligsprechen.»
Meyer zuckte gleichgültig die Schultern und nahm einen Schluck Kaffee. «Das ist keine Neuigkeit. Davon ist seit zwölf Monaten die Rede.»
«Doch, doch!» Das scharfgeschnittene Faunsgesicht strahlte vor spöttischem Vergnügen. «Es wird nicht mehr nur geredet, es ist ein offizielles Verfahren eingeleitet worden. Jetzt werden bereits die Bekanntmachungen verbreitet – in allen Kirchen angeschlagen. Wer etwas auszusagen hat, soll sich melden. Der Bischof hat einen Hausgast, einen Monsignore aus Rom, der beauftragt ist, das Verfahren zu eröffnen. In ein paar Tagen wird er hier erscheinen.»
«Was, zum Teufel!» Meyer stellte seine Tasse hin, daß es nur so klirrte. «Stimmt das?»
«Das stimmt. Ich selber habe den Mann im Wagen Seiner Bischöflichen Gnaden vorbeifahren sehen. Grau und mickrig wie ein Vatikanmäuschen. Er scheint Engländer zu sein, deshalb habe ich mir erlaubt, ihn im Namen der Contessa in ihre Villa einzuladen. Wie Sie wissen, ist sie eine fromme Frau und sehr einsam. » Er lachte in sich hinein und streckte die Hand aus, um sich noch eine Tasse Kaffee einzugießen. «Dieses Dorf wird berühmt werden, Dottore. Auch Sie werden berühmt werden.»
«Davor fürchte ich mich», sagte Meyer ernst.
«Fürchten?» Die Augen des Malers funkelten interessiert. «Was haben Sie zu fürchten? Sie sind nicht einmal Katholik. Es geht Sie gar nichts an.»
«Das verstehen Sie nicht», sagte Meyer gereizt. «Sie verstehen gar nichts.»
«Im Gegenteil, lieber Mann!» Die länglichen Künstlerhände gestikulierten emphatisch. «Ganz im Gegenteil. Ich verstehe alles. Ich verstehe, was Sie hier versucht haben und warum es Ihnen mißglückt ist. Ich weiß, was die Kirche vorhat und warum es ihr glücken wird, wenigstens für eine Zeitlang. Was ich nicht weiß – und was ich für mein Leben gern sehen möchte –, ist, was geschieht, wenn die Wahrheit über Giacomo Nerone ans Licht kommt. Ich hatte vor, nächste Woche abzureisen, aber jetzt werde ich wohl bleiben. Es dürfte eine schöne Komödie werden.»
«Warum sind Sie denn überhaupt hergekommen?» In Meyers Stimme lag eine ärgerliche Schärfe, die Nicholas Black nicht entging. Er lächelte und machte eine saloppe Gebärde.
«Das ist sehr einfach. Ich hatte eine Ausstellung in Rom – mit ziemlichem Erfolg, obwohl es gegen Ende der Saison war. Die Contessa zählt zu meinen Abnehmerinnen. Sie hat drei Bilder gekauft. Sie lud mich ein, hierherzukommen und ein wenig zu malen. Ich hoffe, sie wird in naher Zukunft eine neue Ausstellung finanzieren. So einfach ist das.»
«Es gibt nichts, das so einfach wäre», sagte der Arzt gelassen.
«Und die Contessa ist keine einfache Person. Ebensowenig wie Sie. Was Sie als eine Provinzposse betrachten, könnte sich sehr leicht in eine große Tragödie verwandeln. Ich rate Ihnen, sich nicht hineinziehen zu lassen.»
Der Engländer warf den Kopf zurück und lachte.
«Aber ich bin bereits hineinverwickelt, mein lieber Doktor. Ich bin Künstler, ich beobachte und registriere die Torheiten der Menschheit. Stellen Sie sich vor, was Goya aus einer solchen Situation hätte machen können. Zum Glück ist er seit langem tot, also bin ich an der Reihe. Hier gibt es eine ganze Porträtgalerie – und der Titel ist fix und fertig: Seligsprechung von Nicholas Black. Ein Einmanntheater mit einem einzigen Thema. Ein Dorfheiliger, die Dorfsünder und der gesamte Klerus, bis hinauf zum Bischof. Was halten Sie davon?»
Aldo Meyer betrachtete seine Handrücken, musterte die braunen Leberflecken und die rauhe, schlaffe Haut, die ihm deutlicher als Worte verriet, wie alt er geworden war. Ohne den Blick zu erheben, sagte er:
«Ich halte Sie für einen sehr unglücklichen Menschen, Nicholas Black. Sie suchen etwas, das Sie nie finden werden. Meiner Meinung nach sollten Sie sofort abreisen. Verlassen Sie die Contessa. Verlassen Sie Paolo Sanduzzi. Überlassen Sie es uns, mit unseren Problemen fertig zu werden. Sie gehören nicht hierher. Sie sprechen zwar unsere Sprache, aber Sie verstehen uns nicht.»
«Doch, doch, Doktor!» Das hübsche, zwitterhafte Gesicht leuchtete vor Bosheit «Ich weiß, daß ihr alle fünfzehn Jahre lang etwas versteckt habt, und jetzt wird es hervorgescharrt. Die Kirche will einen Heiligen haben, und Sie wollen ein Geheimnis bewahren, das Ihrem Ruf schaden würde. Stimmt das?»
«Es ist eine halbe Wahrheit, und die ist schlimmer als eine halbe Lüge.»
«Sie haben doch Giacomo Nerone gekannt?»
«Ja, ich habe ihn gekannt.»
«War er ein Heiliger?»
«Ich weiß nichts von Heiligen», sagte Aldo Meyer ernst. «Ich kenne nur Menschen.»
«Und Nerone –?»
«– war ein Mensch.»
«Seine Wunder?»
«Ich habe noch nie ein Wunder erlebt.»
«Glauben Sie an Wunder?»
«Nein.»
Die blitzenden sardonischen Augen waren auf seine abgehärmten Züge gerichtet.
«Warum also, lieber Doktor, fürchten Sie sich vor dieser Untersuchung?»
Aldo Meyer schob den Stuhl zurück und stand auf. Der Schatten des Feigenbaums fiel über sein Gesicht, vertiefte die Höhlung der Wangen, verbarg die nackte Qual in seinen Augen. Nach einer Weile antwortete er:
«Haben Sie sich schon einmal geschämt, lieber Freund?»
«Nie», sagte der Maler vergnügt. «Nie im Leben.»
«Das dachte ich mir eben», sagte der Arzt leise. «Deshalb verstehen Sie nicht, worum es sich handelt. Aber ich rate Ihnen noch einmal, abzureisen – und zwar sehr schnell.»
Die einzige Antwort, die ihm zuteil wurde, war ein spöttisch bedauerndes Lächeln, während Black sich erhob, um sich zu verabschieden. Sie reichten einander nicht die Hand, und Meyer machte keine Miene, den Gast hinauszubegleiten. Auf halbem Weg zum Hause blieb der Maler stehen und drehte sich um.
«Beinahe hätte ich es vergessen. Die Contessa läßt Ihnen etwas sagen. Sie möchte Sie für morgen abend zum Essen einladen.»
«Richten Sie der Contessa meinen Dank aus», sagte Meyer trocken. «Ich komme gern. Adieu, Heber Freund.»
«Ci vederemo», sagte Nicholas Black nonchalant. «Wir sehen uns wieder – sehr bald.»
Dann war seine schmächtige, clownartige Gestalt verschwunden. Aldo Meyer setzte sich wieder an den Tisch und starrte auf die zerkrümelten Brotkrusten und den braunen, schlammigen Kaffeesatz in der Tasse. Nach einer Weile kam die Frau aus dem Haus, blieb stehen und blickte auf ihn hinab, Sanftmut und Mitleid im ruhigen Blick. Als er den Kopf erhob und sie dastehen sah, sagte er kurz:
«Du kannst abräumen, Nina.»
Sie rührte sich nicht, sondern fragte:
«Was hat er gewollt, der Mann, der wie ein Ziegenbock aussieht?»
«Er hat mir eine Neuigkeit gebracht», sagte Meyer, in denselben Dialekt verfallend, den die Frau sprach. «Das Leben Giacomo Nerones wird von neuem untersucht. Aus Rom ist ein Priester gekommen, um dem Diözesangericht zu helfen. Er wird in Kürze hier sein.»
«Wird er Fragen stellen – so wie die anderen?»
«Mehr Fragen als die anderen, Nina.»
«Dann wird er dieselbe Antwort bekommen – nichts!»
Meyer schüttelte langsam den Kopf.
«Diesmal nicht, Nina. Es ist zu weit gediehen. Rom interessiert sich dafür. Die Presse wird sich dafür interessieren. Diesmal sollen sie die Wahrheit hören.»
Empört und verblüfft sah sie ihn an.
«Das sagst du? Du?»
Meyer zuckte resigniert die Schultern und zitierte einen alten Bauernspruch.
«Wer kann gegen den Wind kämpfen? Wer kann das Geschrei übertönen, das sie auf der anderen Seite des Tales angestimmt haben? Bis nach Rom hat man es gehört. Und da haben wir das Resultat. Erzählen wir ihnen, was sie hören wollen, und damit basta! Vielleicht werden sie uns dann in Ruhe lassen.»
«Aber warum wollen sie es denn hören?» Jetzt lag Zorn in ihren Augen und in der Stimme. «Was spielt es denn für eine Rolle? Bei Lebzeiten haben sie ihm alle möglichen Namen gegeben – jetzt wollen sie ihn einen beato nennen. Das ist auch wieder nur ein Name. Es ändert nichts an dem, was er war – ein guter Mensch, mein Mann.»
«Sie wollen keinen Menschen haben, Nina», sagte Meyer verdrossen. «Sie wollen einen Gipsheiligen haben, mit einer goldenen Scheibe auf dem Kopf. Die Kirche wünscht es sich, weil sie damit stärkeren Einfluß auf das Volk gewinnt. Ein neuer Kult, die Hoffnung auf neue Wunder sollen die Leute über ihre Bauchschmerzen hinwegtäuschen. Die Leute wünschen es sich, weil sie dann niederknien und um Gefälligkeiten bitten können, statt die Ärmel aufzukrempeln und zu arbeiten – oder zu kämpfen. Das ist die Art der Kirche – Zucker für den alten sauer gewordenen Wein.»
«Warum soll ich ihnen dann helfen?»
«Wenn wir ihnen die Wahrheit sagen, werden sie den Fall ad acta legen. Es wird ihnen nichts anderes übrigbleiben. Giacomo war ein merkwürdiger Mensch, aber ebensowenig ein Heiliger wie ich.»
«Bist du dieser Meinung?»
«Du nicht, Nina?» Ihre Antwort traf ihn wie ein Schlag ins Gesicht. «Ich weiß, daß er ein Heiliger war», sagte sie. «Ich weiß, daß er Wunder getan hat, weil ich sie erlebt habe.»
Meyer sah sie mit offenem Mund an, dann schrie er:
«Allmächtiger Gott, Weib! Auch du? Er hat in deinem Bett geschlafen. Er hat dir einen Bankert gemacht, aber dich nicht geheiratet. Und du stellst dich hin und erzählst mir, daß er ein Heiliger war, der Wunder getan hat. Warum hast du das nicht gleich den Geistlichen erzählt! Warum hast du dich nicht unseren Freunden dort drüben angeschlossen und verlangt, man soll ihn seligsprechen?»
«Weil er es nicht hätte haben wollen», sagte Nina Sanduzzi ruhig.
«Weil es das einzige ist, was er von mir verlangt hat – daß ich nie erzählen soll, was ich über ihn weiß.»
Er war besiegt, er wußte es, aber er hatte noch eine Waffe übrig und schlug unbarmherzig zu.
«Was wirst du antworten, Nina, wenn sie auf deinen Sohn zeigen und sagen: ‹Das ist der Sohn eines Heiligen, und er macht sich zur femenella des Engländers›?»
Keine Spur von Beschämung zeigte sich in den ruhigen, klassischen Zügen.
«Was sage ich, wenn sie in den Straßen auf mich zeigen und flüstern: ‹Das ist die, die die Hure eines Heiligen war›? Nichts, gar nichts. Und weißt du, warum, Dottore? Weil Giacomo, bevor er starb, mir für mein Versprechen auch eins gegeben hat. ‹Was auch geschieht, cara, ich werde mich um dich und um den Jungen kümmern. Sie können mich umbringen, aber sie können mich nicht daran hindern, mich bis in alle Ewigkeit um dich zu kümmern.› Das habe ich ihm damals geglaubt, das glaube ich heute noch. Mein Sohn ist dumm, aber er ist noch nicht verloren.»
«Dann wird es sehr bald der Fall sein», sagte Aldo Meyer brutal.
«Geh jetzt um Gottes willen nach Haus und laß mich in Ruhe.»
Aber auch nachdem sie sich entfernt hatte, konnte er nicht zur Ruhe kommen, und er wußte, das würde so lange dauern, bis die Inquisitoren erschienen und die Wahrheit ans Licht zerrten.
Kein morgendlicher Schimmer war bisher in das hohe Barockzimmer eingedrungen, in dem die Gräfin Anne Louise de Sanctis hinter Samtvorhängen schlief. Keinerlei böse Vorahnungen konnten den Barbiturnebel zerteilen, in dessen Schutz sie ihre Träume träumte.
Erst später, viel später wird eine Hausgehilfin hereinkommen und die Gardinen öffnen, um das Sonnenlicht über den abgetretenen Teppich, den moderfleckigen Samt und die stumpfe Patina der Nußholzschnitzereien fluten zu lassen. Es wird nicht bis ans Bett reichen, freundlicherweise, denn die Contessa bietet frühmorgens keinen erfreulichen Anblick.
Noch ein wenig später wird sie erwachen, mit ausgedörrtem Mund, grauer Haut, verschwollenen Augen und tief unzufrieden mit dem Anbruch eines neuen Tages, der auf ein Haar dem alten gleichen würde. Sie wird erwachen und eindösen, dann wieder aufwachen und die erste Zigarette des Tages zwischen die bleichen, schlaffen Lippen schieben. Nachdem sie die Zigarette zu Ende geraucht hat, wird sie an der Klingelschnur ziehen, und die Hausgehilfin wird zurückkehren, mit einem beflissenen gutgelaunten Lächeln und einem Frühstückstablett. Da die Contessa nie gerne allein ißt, wird das Mädchen im Zimmer bleiben, die umhergestreuten Kleidungsstücke zusammenfalten, frische Wäsche bereitlegen, im Badezimmer hantieren, während ihre Herrin in stetem Redefluß bissige Bemerkungen über den Haushalt und seine Mängel macht.
Nach beendetem Frühstück wird das Mädchen mit dem Tablett verschwinden, und die Contessa wird noch eine Zigarette rauchen, bevor das kleine intime Ritual der Toilette beginnt – die einzige bedeutsame Zeremonie im Verlauf ihres bedeutungslosen Tages; und sie vollzog sie in strenger Abgeschiedenheit.
Sie drückte die Zigarette in der silbernen Aschenschale aus, stand auf, ging zur Tür und sperrte ab. Dann machte sie die Runde durch den Raum, blieb an jedem Fenster stehen und blickte auf die Terrassen und die Gärten hinaus, um sich zu vergewissern, daß niemand in der Nähe sei. Einmal hatte ein neugieriger Gärtner zum Fenster hereingespäht und war zur Strafe für diese frevelhafte Einmischung in die Mysterien fristlos entlassen worden.
Nachdem die Contessa sich endlich davon überzeugt hatte, daß kein unbefugter Blick sie stören werde, ging sie ins Badezimmer, zog sich aus und stieg in die große Marmorwanne mit den vergoldeten Kränen und dem Aufmarsch der Seifen, Schwämme und Badesalzflaschen. Kein Vergnügen ließ sich mehr mit diesem ersten, einsamen Versinken ins dampfende Wasser vergleichen, das die Nachwehen eines künstlich erzeugten Schlafes hinwegschwemmte und einem alternden Körper die Illusion der Jugend zurückgab. Zum Unterschiede von anderen Vergnügungen konnte diese beliebig wiederholt und bis zur vollen Sättigung fortgesetzt werden. Sie erforderte keinen Partner, brachte keinerlei Abhängigkeit oder Unterwerfung mit sich, und die Contessa hielt an ihr mit der Inbrunst einer frommen Schwärmerin fest.
Während sie sich rücklings ins heiße Wasser legte, musterte sie sich selbst, die noch schlanken und jugendlichen Linien der Lenden, den flachen und durch keine Geburt entstellten Bauch, die Taille, die ein wenig dick zu werden begann, die kleinen, aber runden und noch jugendlichen Brüste, die durch gewissenhafte Massage ihre Festigkeit behalten hatten. Wenn es am Halse Falten gab, fehlte vorläufig der Spiegel, der es ihr mitgeteilt hätte, und die verräterischen Runzeln um Mund und Augen ließen sich noch durch Massage beherrschen. Noch war die Jugend nicht ganz aus ihrem Körper versickert, noch konnte man mit Hilfe einer wöchentlichen Sendung kosmetischer Präparate das heranrückende Alter eine Weile in Schach halten.
Aber das Bad war nur der Anfang. Nachher begann sie sich mit weichen gewärmten Tüchern abzutrocknen, darauf folgte das Frottieren mit rauhen Tüchern, das Parfümieren mit scharfen, zusammenziehenden Hautwassern, das Pudern, das sanfte Entfernen des Puders, das Kämmen der Haare – noch waren keine grauen darunter, obwohl das Gold zu verblassen begann –, die sie mit einem Bande von den blankfrottierten Wangen zurückraffte. Nun war sie endlich für den Höhepunkt dieses Rituals gerüstet.
Nackt und strahlend im Glänze der neuen Illusion kehrte sie ins Schlafzimmer zurück, ging zum Toilettentisch, nahm aus der obersten Schublade das Foto eines Mannes in der Uniform eines Alpini-Obersten und lehnte es an den Spiegel. Dann begann sie, geziert wie ein Mannequin, sich vor dem Foto anzuziehen, sorgfältig, kokett, als wollte sie den Mann aus dem Rahmen hervorzaubern und in ihre sehnsüchtigen Arme locken.
Sobald sie angekleidet war, legte sie das Bild wieder in die Lade, sperrte sie ab, setzte sich gelassen vor den Spiegel und begann, das Gesicht herzurichten.
Zwanzig Minuten später verließ sie in einem modischen Sommerkleid das Schlafzimmer und ging die Treppe hinunter in den sonnigen Garten hinaus, wo Nicholas Black, nackt bis zur Mitte, an einem neuen Gemälde arbeitete.
Als er ihre Schritte hörte, drehte er sich um, eilte ihr entgegen, um sie mit gekünsteltem Entzücken zu begrüßen, küßte ihr die Hand und wirbelte sie dann im Kreise umher, um das neue Kleid zur Geltung zu bringen, während er wie ein vergnügter Papagei plapperte:
«Prächtig, cara! Ich weiß nicht, wie Sie das anstellen! Jeder Morgen bringt eine neue Offenbarung. In Rom waren Sie schön, aber recht furchterregend. Hier sind Sie eine ländliche Schönheit, die meiner privaten Bewunderung vorbehalten bleibt. Ich muß Sie in diesem Kleid malen. Da, setzen Sie sich und lassen Sie sich anschauen.»
Sie weidete sich erfreut an den Komplimenten und ließ sich von ihm zu einer kleinen Steinbank führen, die von einem blühenden Mandelbaum beschattet wurde. Es dauerte lange, bis er sie zu seiner Zufriedenheit placiert hatte, er entfaltete die Schöße ihres Kleides über die Sitzkante, bog ihren Kopf zu den Blüten empor und legte ihre Hände im Schoß zurecht. Dann griff er nach einem Skizzenblock und begann, mit raschen, bravourösen Strichen zu zeichnen, ohne auch nur eine Sekunde lang den Mund zu halten.
«Ich habe heute früh mit unserem ärztlichen Freund Kaffee getrunken. Er hatte seinen üblichen Kater, wurde aber gleich viel munterer, als ich ihm Ihre Einladung überbrachte. Ich hatte den Eindruck, daß er halb und halb in Sie verliebt ist … Nein, nein, nicht sprechen! Sie verderben die Pose. Der arme Teufel kann wohl nichts dafür. Er lebt schon zu lange unter den Bauern. Sie müssen ihm hier oben in Ihrem Schloß wie eine Märchenprinzessin vorkommen … Ach, und noch etwas. Der Bischof von Valenta läßt das Leben und die Verdienste Giacomo Nerones offiziell untersuchen. Er hat sich aus Rom einen englischen Monsignore kommen lassen, der als Teufelsadvokat fungieren soll. In einigen Tagen kommt er hierher. Ich habe mir die Freiheit erlaubt, Seiner Bischöflichen Gnaden zu sagen, daß Sie ihn gern als Ihren Cast bei sich aufnehmen werden.»
«Nein!» Es war ein Schreckensruf. Sie verlor völlig die Fassung und starrte ihn an, wütend und entsetzt.
«Aber, cara!» Sogleich spielte er den Reumütigen. Er legte den Zeichenblock weg und ging auf sie zu. Mit besorgter Stimme sagte er: «Ich dachte, es würde Ihnen recht sein. Ich konnte Sie nicht erst fragen, aber ich wußte doch, daß Sie mit dem Bischof befreundet sind, und ich wußte auch, daß man den Besucher sonst nirgends unterbringen kann. Er kann doch nicht bei den Bauern übernachten? Oder in der Weinschenke unter der Theke? Außerdem ist er ein Landsmann von Ihnen – und von mir. Ich habe mir eingebildet, daß es Ihnen Freude macht. Wenn ich Sie gekränkt habe, werde ich mir das nie verzeihen.»
Er kniete vor sie hin und vergrub das Gesicht in ihrem Schoß wie ein bußfertiges Kind.
Das war ein uralter Trick, um reifere Damen zu bezaubern, und er verfehlte auch diesmal nicht seine Wirkung. Liebkosend strich sie ihm mit den Fingern durchs Haar und sagte sanft:
«Natürlich haben Sie mich nicht gekränkt, Nicki. Ich war überrascht, weiter nichts … Ich bin nicht mehr so wie früher auf neue Gäste gefaßt. Natürlich haben Sie richtig gehandelt. Ich werde diesen Monsignore gern bei mir unterbringen.»
«Das habe ich doch gewußt!» Sogleich war er wieder vergnügt.
«Seine Bischöfliche Gnaden ist Ihnen sehr dankbar – und ich glaube nicht, daß uns der Besucher langweilen wird. Außerdem –», wieder funkelte eine leise, lächelnde Bosheit aus seinen Augen, «werden wir die Untersuchung aus nächster Nähe verfolgen können, nicht wahr?»
«Vermutlich.» Wieder umwölkte sich ihre Miene, und sie begann, nervös an den Falten ihres Kleides zu zupfen. «Aber was hat er hier vor?»
Nicholas Black fuchtelte mit den Händen.
«Was sie alle vorhaben. Fragen stellen, Notizen machen, Zeugen vernehmen. Übrigens werden wahrscheinlich auch Sie an die Reihe kommen. Sie haben doch Nerone gekannt?»
Sie wurde unruhig und wich seinem Blick aus.
«Nur flüchtig. Ich – ich hätte nichts zu erzählen, das wissenswert wäre.»
«Dann brauchen Sie sich keine Sorgen zu machen, cara. Sie bekommen einen Logenplatz in einer Bauernkomödie – und noch obendrein eine Portion römischen Klatsch. Also – setzen Sie sich wieder schön zurecht und lassen Sie mich diese Skizze fertigmachen.»
Aber sosehr er sich auch bemühte, er konnte ihre Furcht nicht wegzaubern, und als er daranging, das Gesicht zu zeichnen, war jeder Strich eine Lüge. Aber alle Frauen sind töricht. Sie sehen nur, was sie sehen wollen – und Nicholas Black hatte sein ganzes Leben lang aus ihren Torheiten Nutzen gezogen.
Als die Skizze fertig war, überreichte er sie mit schwungvoller Gebärde und mußte innerlich über ihre erleichterte und erfreute Miene lächeln. Dann küßte er mit wohlberechneter Nonchalance ihre Hand und entließ sie:
«Sie stören mich, mein Schatz. Sie sind ein schöner Plagegeist. Gehen Sie, pflücken Sie mir ein paar Blumen fürs Schlafzimmer und lassen Sie mich mein Bild vollenden.»
Während er sie mit unsicheren Schritten über den Rasen davongehen sah, lachte er in sich hinein. Sie war nett zu ihm gewesen, und er war ihr persönlich nicht böse. Aber auch er hatte seine geheimen Freuden, und die raffinierteste von allen lag darin, durch Intrigen zu demütigen, was er nie durch Besitznahme besiegen konnte – das gierige, verhaßte Weiberfleisch.
Für Anne Louise de Sanctis hatte der Augenblick eine ganz andere Bedeutung. Sie war weder dumm noch lasterhaft, obwohl sie den Torheiten des reifen Alters genauso ihren Tribut zollte wie den Lastern, die der lebenshungrige Körper von ihr gefordert hatte. Wenn sie sich den kleinen tyrannischen Launen des Malers unterwarf, dann nur, weil sie ihrer Eitelkeit schmeichelten und weil sie wußte, daß sie trotz allem die Stärkere war. Er wollte sich von ihr eine neue Ausstellung in Rom finanzieren lassen. Sie konnte ihm diesen Wunsch erfüllen – aber sie konnte ihn auch morgen wegschicken, zurück in das Bettlerdasein eines mittelmäßigen Malers, der emsig auf gefällige Witwen Jagd macht.
Sie sah mit Freuden, daß auch er alt zu werden begann und daß ihm jede neue Eroberung ein wenig schwerer fiel. Seine Bosheit war wie die eines Kindes, manchmal sehr verletzend, aber immer mit einem uneingestandenen Bedürfnis nach ihr, der hilfreichen Freundin, verknüpft. Und es war lange her, seit jemand sie gebraucht hatte. Auch sie hatte ihre Bedürfnisse, aber obgleich er diese Bedürfnisse verstand und sie ausnützte, war er nicht imstande, sie gegen sie zu kehren. Er trieb sein Spiel mit ihren Ängsten und ihrer Einsamkeit, doch das wirkliche Gespenst hatte er noch nicht entdeckt.
Dieses Gespenst begleitete sie jetzt durch den bunten Garten auf dem Berggipfel, wo Reichtum und billige Arbeitskraft auf dem rauhen, ausgedörrten Boden Kalabriens eine Oase geschaffen hatten. Die Erde für die Rasenflächen und die Blumenbeete war in Körben auf den Schultern der Dorfbewohnerinnen heraufgeschleppt worden. Maurer aus der Umgebung hatten die Hänge von Steinen befreit, die Olivenbäume, die Kiefern und die Orangenwäldchen waren von Pächtern gepflanzt worden als ein Zinsgedinge für die Familie, die sie seit Jahrhunderten unter ihrer Fuchtel hielt. Neapolitanische Maler hatten die Wände und die kassettierten Decken geschmückt und ein Dutzend Kunstkenner die Gemälde, die Statuen und das Porzellan ersteigert, das Graf Gabriele de Sanctis für seine junge Frau aus England verlangte.
Damit sie ungestört sei, war die Ringmauer errichtet und mit wappengeschmückten Eisentoren versehen worden. Der Conte persönlich hatte das Personal ausgewählt, um ihr eine aufmerksame Bedienung zu sichern. Das Haus, der Grund und Boden und alles, was dazugehörte, waren sein Hochzeitsgeschenk, eine ländliche Zufluchtsstätte nach der hektischen Saison in Rom, wo Gabriele de Sanctis im Dienst des Duce Karriere machte. Für die Tochter eines drittrangigen Diplomaten, die soeben ihre erste Saison in London erlebt hatte, war es wie ein Märchen aus Tausendundeiner Nacht gewesen, aber die Angst hatte sie durch die Tore begleitet und war seither nicht von ihrer Seite gewichen.
Gabriele de Sanctis hatte damit angefangen – aber er war längst tot, hatte in der libyschen Wüste durch Selbstmord geendet, mit Schimpf und Schande. Ein Dutzend Männer waren in der Zwischenzeit gekommen und gegangen, aber keiner hatte sie von ihrer Angst befreien können.
Dann erschien Giacomo Nerone. In diesem Garten hier, an einem solchen Morgen, hatte sie sich vor ihm erniedrigt und ihn angefleht, das Gespenst zu vertreiben, aber er hatte sich geweigert. Zu guter Letzt hatte sie sich gerächt, aber die Rache hatte ihr neue Furien auf den Hals gehetzt – Alpträume, Geister, die in den Orangenhainen spukten und wie Satyre zwischen den Blüten grinsten. In letzter Zeit hatten sie ihr nicht mehr so heftig zugesetzt. Sie hatte ihre Mittel, die ihr nachts Schlaf schenkten, und ihren Nicholas Black, der sie am Tage unterhielt.
Nun aber näherte sich ein neuer Mann – ein grauwangiger Kleriker aus Rom, mit dem Auftrag, die Vergangenheit zu durchwühlen, alte Schulden einzutreiben und vergrabenes Unrecht zu registrieren, mochten die Enthüllungen auch noch so schmerzliche Folgen nach sich ziehen. Er wird unter ihrem Dache wohnen und an ihrem Tische essen. Er wird umherschnüffeln, und selbst die versperrte Tür ihres Schlafzimmers wird ihm keine Geheimnisse vorenthalten können. Plötzlich schien das Leben, das sie in dem morgendlichen Bad in sich eingesogen hatte, aus ihren Adern zu verebben, sie fühlte sich schlaff und müde. Mit langsamen, schleppenden Schritten ging sie in einen kleinen Obstgarten am Rande der Olivenpflanzung, wo eine kleine Statue, ein tanzender Faun, auf einem verwitterten Steinsockel posierte. Vor der Statue stand eine ländliche Bank unter träge und üppig herabhängendem Geißblatt. Sie setzte sich auf die Bank, zündete sich eine Zigarette an und inhalierte gierig, tief den Rauch in die Lungen einziehend. Sie fühlte die Spannung langsam weichen.
Nun begann sie, Klarheit zu gewinnen. Sie war allzu lange auf der Flucht gewesen. Es gab kein Entrinnen vor dieser Angst, die sie wie ein Geschwür in ihrem Innern mit sich herumschleppte. Es mußte ein Ende haben, sonst würde sie Hals über Kopf in dem düsteren Wahnsinn landen, der allen Frauen droht, welche unglücklich und unvorbereitet in die Wechseljahre kommen. Aber wie sollte man ihm ein Ende bereiten? Alle Türen aufreißen, sich vor den Inquisitoren demütigen, eine reinigende Beichte ablegen? Das hatte sie schon einmal versucht, und es war restlos mißglückt.
Es gab eine Alternative, eine vielleicht sehr finstere, aber zuverlässige Alternative: das kleine Fläschchen mit den Gelatinekapseln, die sie allnächtlich zum Schlummer verführten. Nur ein bißchen mehr – und es würde vorbei sein, ein für allemal. Im gewissen Sinne würde damit ihre Rache an Giacomo Nerone vollendet sein und auch die Rache an dem Körper, der sie an ihn und ihn an sie verraten hatte.
Aber vorläufig noch nicht. Noch hatte sie ein bißchen Zeit. Der Priester soll erst einmal herkommen, und wenn er ihr nicht allzu heftig zusetzt, wird dies ein günstiges Omen sein – und Aussicht auf andere Lösungen bringen. Wenn ja … Nun, dann wird es ein sehr einfaches und ironisches Finale geben, und wenn man sie findet, wird sie noch immer so schön sein wie jeden Morgen nach dem parfümierten Bade.