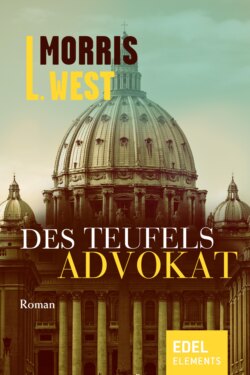Читать книгу Des Teufels Advokat - Morris L. West - Страница 5
2
ОглавлениеZwei Tage später saß Eugenio Kardinal Marotta in seinem Arbeitssessel hinter dem großen, mit Perlmutter ausgelegten Schreibtisch und unterhielt sich mit Blaise Meredith.
Seine Eminenz hatte gut geschlafen und ein leichtes Frühstück zu sich genommen, und sein rundes, gutgelauntes Gesicht glänzte frisch und glatt rasiert: In dem hohen Raum mit der kassettierten Decke, den samtweichen Aubussonteppichen und den edlen Bildnissen in vergoldeten Rahmen umstrahlte ihn die unbewußte Würde des Besitzes.
Dagegen wirkte der Engländer klein, grau und verschrumpelt. Die Soutane hing lose an seinem mageren Körper herab, und die scharlachrote Borte unterstrich nur noch die ungesunde Blässe des Gesichts. Sein Augen waren von Müdigkeit umwölkt, tiefe Schmerzensfalten saßen an den Mundwinkeln. Selbst im flotten Römer-Italienisch klang seine Stimme matt und ausdruckslos.
«So sieht es aus, Eure Eminenz. Im besten Fall habe ich zwölf Monate vor mir. Davon wird mir vielleicht die Hälfte eine gewisse Tätigkeit erlauben.»
Der Kardinal wartete einige Sekunden und betrachtete ihn mit kühlem Bedauern. Dann sagte er sanft:
«Ich bin betrübt, lieber Freund. Natürlich steht es uns allen bevor, aber es ist doch immer ein schwerer Schlag.»
«Aber gerade wir müßten darauf vorbereitet sein.» Der schlaffe Mund verzog sich zu einem schiefen Lächeln.
«Nein, nein!» Marotta erhob seine kleinen Händchen in einer bittenden Gebärde. «Wir dürfen uns nicht selber überschätzen. Wir sind Menschen wie alle anderen. Wir haben uns freiwillig für das geistliche Kleid entschieden, wir leben im Zölibat, weil das kanonische Recht es verlangt. Es ist ein Beruf. Die Macht, die wir ausüben, die Gnade, die wir spenden, sind unabhängig von unserem persönlichen Wert. Freilich wäre es besser, wir wären keine Sünder, sondern Heilige – aber wie bei unseren Brüdern außerhalb des Klerus läuft es meistens auf ein Zwischending hinaus.»
«Ein recht kleiner Trost, Eure Eminenz, wenn man im Schatten des Richterstuhls steht.»
«Trotzdem ist es wahr.» Der Kardinal betonte mit kühlem Nachdruck: «Ich gehöre seit langem der Kirche an, lieber Freund. Je höher man klettert, desto mehr bekommt man zu sehen – und desto schärfer wird der Blick. Es ist eine fromme Legende, daß die Priesterwürde einen Menschen heilige oder daß das Zölibat ihn adle. Wenn es einem Geistlichen bis zu seinem fünfundvierzigsten Jahr gelingt, mit seinen Händen nicht in fremde Taschen zu fassen und seine Beine nicht im Bett einer Frau auszustrecken, hat er eine ziemlich große Chance, bis zu seinem seligen Ende dabei zu bleiben. Auch in der Laienwelt gibt es eine Menge eingefleischter Junggesellen. Aber wir unterliegen nach wie vor dem Hochmut, dem Ehrgeiz, der Schlamperei, der Faulheit, der Habsucht. Oft fällt es uns schwerer als anderen, unser Seelenheil zu retten. Ein Familienvater muß Opfer bringen, muß seine Begierden im Zaum halten, muß Liebe und Geduld aufwenden. Vielleicht sündigen wir weniger, aber wir werden zuletzt auch weniger Verdienste aufzuweisen haben.»
«Meine Hände sind leer», sagte Blaise Meredith. «Ich habe nichts Schlechtes zu bereuen und nichts Gutes zu verzeichnen. Ich habe gegen nichts ankämpfen müssen. Ich kann nicht einmal Narben vorzeigen.»
Der Kardinal lehnte sich in seinem Sessel zurück und spielte mit dem großen gelben Stein an seinem Bischofsring. Das einzige Geräusch im Raum war das leise Ticken einer vergoldeten Bronzeuhr auf dem Kaminsims. Nach einer Weile sagte er nachdenklich:
«Wenn Sie wollen, kann ich Ihren sofortigen Rücktritt bewilligen. Ich kann Ihnen eine Pension aus den Geldern der Kongregation aussetzen. Sie können in aller Stille leben …»
Blaise Meredith schüttelte den Kopf.
«Das ist sehr gütig von Eurer Eminenz, aber ich habe kein Talent für ein beschauliches Dasein. Ich möchte lieber meine Tätigkeit fortsetzen.»
«Eines Tages werden Sie aufhören müssen. Und dann?»
«Dann werde ich mich in ein Krankenhaus legen. Man hat mir gesagt, ich werde sehr viel zu leiden haben. Dann …» Er breitete resigniert die Arme aus. «Finita la commedia. Wenn es nicht zuviel verlangt ist, möchte ich gern in der Kirche Eurer Eminenz begraben werden.»
Unwillkürlich war Marotta durch den düsteren Mut des Mannes betroffen. Der Mann war müde und krank. Die schlimmsten Stationen seines Leidensweges standen ihm erst bevor, trotzdem ging er ihnen mit einer stoischen Würde entgegen, die typisch englisch war. Bevor der Kardinal etwas sagen konnte, fuhr Meredith fort:
«Bei alledem setze ich natürlich voraus, daß Eure Eminenz Verwendung für mich haben … Leider kann ich nicht für eine erstklassige Leistung garantieren.»
«Sie haben sich immer besser bewährt, als Sie dachten, lieber Freund», sagte Marotta wohlwollend. «Sie haben immer mehr geleistet, als Sie versprochen hatten. Außerdem liegt eine Sache vor, bei der Sie mir – », er hielt inne, als sei ihm nachträglich ein seltsamer Gedanke gekommen, «– und vielleicht auch sich selber helfen können.»
Dann, ohne eine Antwort abzuwarten, erzählte er ihm von dem Ansuchen des Bischofs von Valenta und von der Notwendigkeit, einen Teufelsadvokaten im Falle Giacomo Nerones zu finden.
Meredith hörte aufmerksam zu, wie ein Rechtsanwalt, der die Einzelheiten einer Klageschrift zur Kenntnis nimmt. Ein neues Leben schien von ihm Besitz zu ergreifen. Seine Augen wurden heller, er richtete sich auf. In seine blassen Wangen stieg ein wenig Farbe. Eugenio Marotta bemerkte es, enthielt sich aber jeglichen Kommentars. Nachdem er die Situation umrissen hatte, fragte er:
«Nun, was halten Sie davon?»
«Eine Unklugheit», erwiderte Meredith prompt. «Ein politisches Manöver, das mich mißtrauisch macht.»
«Alles, was die Kirche tut, trägt politischen Charakter», betonte Marotta mit sanftem Nachdruck.
«Der Mensch ist ein zoon politikon, ein politisches Wesen mit einer unsterblichen Seele. Man kann ihn nicht zerteilen – genausowenig, wie man die Kirche in getrennte und voneinander unabhängige Funktionen zergliedern kann. Alles, was die Kirche tut, ist dazu bestimmt, einer materiellen Entwicklung einen geistlichen Charakter zu verleihen Wir ernennen einen Heiligen zum Schutzpatron des Fernsehens. Was bedeutet das? Ein neues Symbol für eine alte Wahrheit: Jede gesetzmäßige Tätigkeit kann Gutes stiften oder in schlechte Bahnen gelenkt werden.»
«Allzu viele Symbole werden das Gesicht der Wirklichkeit vernebeln», sagte Blaise Meredith trocken. «Allzu viele Heilige werden die Heiligkeit in Verruf bringen. Ich habe immer gedacht, unsere Aufgabe in der Ritenkongregation sei, nicht sie in den Kalender einzuführen, sondern sie von dem Kalender fernzuhalten.»
Der Kardinal nickte ernst.
«Das stimmt in gewissem Sinne. Aber hier wie in allen Fällen haben nicht wir den ersten Schritt getan. Zuerst rührt sich der Bischof in seiner eigenen Diözese. Dann erst werden uns die Unterlagen zugeschickt. Wir sind nicht unmittelbar ermächtigt, eine Untersuchung zu verbieten.»
«Wir können abraten.»
«Mit welcher Begründung?»
»Daß es unklug wäre. Der Zeitpunkt ist schlecht gewählt. Wir stehen vor Neuwahlen. Giacomo Nerone wurde im letzten Kriegsjahr von Kommunisten ermordet. Was wollen wir machen? Dies ausnützen, um in der Provinz Stimmen zu gewinnen – oder ihn als ein Muster heroischer Nächstenliebe hinstellen?»
Die roten Lippen des Kardinals verzogen sich zu einem leichten, ironischen Lächeln.
«Ich kann mir denken, daß unser Amtsbruder, der Bischof, gerne beides erzielen möchte. Und bis zu einem gewissen Grade dürfte ihm das auch gelingen. Es wird behauptet, daß sich Wunder ereignet haben. Unter der Bevölkerung ist ein offenbar spontaner Kult entstanden. Beides muß gerichtlich untersucht werden. Eine erste Untersuchung hat bereits stattgefunden, und das Urteil ist günstig. Nun folgt fast automatisch das zweite Stadium – der Prozeß der Seligsprechung vor dem Diözesangericht.»
«Wenn es erst einmal soweit ist, wird die gesamte italienische Presse über den Fall berichten. Die Reisebüros werden inoffizielle Touren arrangieren. Die ortsansässigen Kaufleute werden die Trommel rühren. Das läßt sich nicht vermeiden.»
«Aber wir werden vielleicht imstande sein, zu bremsen. Deshalb habe ich mich entschlossen, den Wunsch Seiner Bischöflichen Gnaden zu erfüllen. Deshalb möchte ich Sie zum Advocatus Diaboli machen.»
Blaise Meredith schürzte die dünnen, blutlosen Lippen und überlegte sich das Angebot. Nach einer Weile schüttelte er den Kopf. «Ich bin ein kranker Mann, Eure Eminenz. Ich würde Ihre Erwartungen nicht erfüllen können.»
«Das zu beurteilen, müssen Sie mir überlassen.» Kühl wies er ihn zurecht. «Außerdem glaube ich, wie gesagt, daß es Ihnen helfen könnte.»
«Das verstehe ich nicht.»
Der Kardinal stieß seinen hochlehnigen, geschnitzten Sessel zurück und stand auf. Er ging zum Fenster und schob die dicken Draperien zur Seite, so daß die Morgensonne in den Raum flutete, das Scharlachrot und das Gold aufglänzen, die üppigen Muster auf dem Teppich wie Blumen lebendig werden ließ. Blaise Meredith blinzelte, das grelle Licht blendete ihn, er hielt die Hand vor die Augen. Der Kardinal blickte in den Garten hinaus. Meredith konnte sein Gesicht nicht sehen, aber als er zu sprechen begann, lag in seiner Stimme ein seltenes Mitgefühl.
»Was ich Ihnen zu sagen habe, Monsignore, ist wahrscheinlich anmaßend. Ich bin nicht Ihr Beichtvater, ich kann nicht Ihr Gewissen erforschen, aber ich vermute, daß Sie in eine Krise geraten sind. Wie so viele von uns hier in Rom sind Sie Kirchenmann von Beruf – Beamter der Kirche. Das ist an und für sich kein Makel. Ein tüchtiger Fachmann zu sein bedeutet schon sehr viel. Es gibt eine Menge Leute, die nicht einmal dieses begrenzte Ziel erreichen. Plötzlich haben Sie entdeckt, daß Ihnen das nicht genügt. Sie sind verblüfft und erschrocken. Trotzdem wissen Sie nicht, was Sie machen sollen, um die Lücke auszufüllen. Das Problem rührt zum Teil daher, daß Sie und ich und andere in unserer Lage allzu lange nichts mehr mit seelsorgerischen Aufgaben zu tun gehabt haben. Wir haben den Kontakt mit den Menschen verloren, die uns den Kontakt zu Gott vermitteln. Wir haben den Glauben auf ein verstandesmäßiges Konzept reduziert, weil wir ihn nicht im täglichen Leben gewöhnlicher Menschen am Werke sehen. Wir haben das Mitleid, die Angst und die Liebe eingebüßt. Wir sind die Hüter der Mysterien, aber wir haben keine Ehrfurcht mehr vor ihnen. Wir richten uns nach dem Kanon und nicht nach den Geboten der Barmherzigkeit. Wie alle Verwaltungsmenschen sind wir überzeugt, daß ohne uns die Welt im Chaos versinken würde, daß wir die Kirche Gottes auf unserem Rücken tragen. Das stimmt nicht – aber manche von uns halten bis zum letzten Atemzug an dieser Einbildung fest. Sie dürfen von Glück reden, daß die Unzufriedenheit Sie überfallen hat – wenn auch sehr spät. Ja, nicht nur Unzufriedenheit, sondern auch Zweifel. Ich glaube nämlich, daß Sie jetzt in die Wüste der Versuchung geraten sind. Deshalb nehme ich an, daß diese Untersuchung Ihnen helfen könnte. Sie verlassen Rom und kommen in eines der schlimmsten Elendsgebiete von ganz Italien. Sie werden das Leben eines Menschen rekonstruieren, nach den Aussagen derer, die ihn gekannt haben – der Armen, der Unwissenden, der Enterbten. Ob er Sünder oder Heiliger war, das spielt schließlich und endlich keine Rolle. Sie werden unter einfachen Menschen leben und mit ihnen sprechen. Dort werden Sie vielleicht eine Arznei für Ihre kranke Seele finden.»
«Worin besteht meine Krankheit, Eure Eminenz?» Die erschütternde Mattigkeit der Stimme, der trostlos verwirrte Ton erregten das Mitleid des alten Kirchenmannes. Er drehte sich um und sah, daß Meredith auf seinem Stuhl nach vorn gesunken war und das Gesicht in den Händen verbarg. Marotta wartete eine Weile und überlegte sich die Antwort. Dann sagte er langsam:
«In Ihrem Leben gibt es keine Leidenschaften, mein Sohn. Sie haben nie eine Frau geliebt, nie einen Mann gehaßt, nie ein Kind bedauert. Sie haben sich allzuweit zurückgezogen und sind jetzt ein Fremdling unter den Menschen. Sie haben nichts verlangt und nichts gegeben. Nie haben Sie die Würde der Not oder Dankbarkeit für geteiltes Leid erlebt. Das ist Ihre Krankheit. Das ist das Kreuz, das Sie für Ihre eigenen Schultern zurechtgezimmert haben. Hier beginnen Ihre Zweifel und auch Ihre Befürchtungen – denn ein Mensch, der seine Mitmenschen nicht heben kann, kann auch Gott nicht lieben.»
«Wie fängt man zu lieben an?»
«Aus einem Bedürfnis heraus», erwiderte Marotta fest. «Weil Leib und Seele es brauchen. Der Mensch sehnt sich nach dem ersten Kuß – und zum ersten Male verrichtet er ein echtes Gebet, wenn er sich nach dem verlorenen Paradies sehnt.»
«Ich bin so müde», sagte Blaise Meredith.
«Gehen Sie nach Hause und ruhen Sie sich aus», sagte der Kardinal lebhaft. «Morgen fahren Sie nach Kalabrien. Überreichen Sie dem Bischof von Valenta Ihr Beglaubigungsschreiben und machen Sie sich an die Arbeit.»
«Sie sind ein harter Mann, Eure Eminenz.»
«Jeden Tag sterben Menschen», sagte Eugenio Marotta rundheraus. «Manche sind verdammt, manche werden erlöst, aber das Werk der Kirche schreitet weiter. Gehen Sie, mein Sohn – in Frieden und im Namen Gottes!»
Am nächsten Vormittag um elf Uhr trat Blaise Meredith die Reise nach Kalabrien an. Sein Gepäck bestand aus einem kleinen Kleiderkoffer, einer Aktenmappe mit dem Brevier, seinen Notizbüchern und einem Ermächtigungsschreiben des Präfekten der Ritenkongregation an Seine Gnaden, den Bischof von Valenta. Vor ihm lag eine zehnstündige Bahnfahrt, der rapido war heiß, staubig und mit Kalabresen überfüllt, die von einer organisierten Wallfahrt nach der Heiligen Stadt zurückkehrten.
Die Ärmeren saßen zusammengepfercht wie das Vieh in den Abteilen zweiter Klasse, während die Bessergestellten sich auf die erste Klasse verteilten; sie rekelten sich auf den Polstersitzen und bepackten die Gepäcknetze mit ihren Habseligkeiten. Meredith sah sich festgeklemmt zwischen einer dicken Matrone in seidenem Kleid und einem schwärzlichen Kleriker, der, geräuschvoll kauend, Pfefferminzbonbons aus einer Pappschachtel verzehrte. Auf der gegenüberliegenden Bank hatte sich eine Bauernfamilie niedergelassen. Die vier Kinder lärmten wie Zikaden und gerieten den Mitreisenden zwischen die Beine. Sämtliche Fenster waren geschlossen, die Luft war sauer und stickig.
Meredith holte das Brevier hervor und machte sich mit grimmiger Konzentration an seine Andacht. Zehn Minuten nachdem sie den Bahnhof Termini in Rom verlassen hatten, gab er es angewidert auf. Die verdorbene Luft bereitete Übelkeit, der Kopf brummte ihm von dem Geratter des Zuges und dem Geschrei der Kinder. Er versuchte zu schlummern, aber die dicke Frau bewegte sich unruhig in ihrem engsitzenden Kleid, und die lärmenden Kaumanöver des Priesters machten ihn fast wahnsinnig. Besiegt und verbittert raffte er sich auf und ging in den Seitengang hinaus. Dort lehnte er sich gegen die Tür und betrachtete die vorbeieilende Landschaft.
Alles war grün im ersten Anhauch des Frühlings. Die Narben der Erosion und des Pfluges waren mit frischem Gras zugedeckt, den Bewurf der Häuser hatte der Regen reingewaschen und die Sonne gebleicht, und die Ruinen der Aquädukte und der altrömischen Villen waren mit jungem Moos und Unkraut geschmückt, das aus den verwitterten Steinen sproß. Das ewige Wunder der Wiedergeburt ist hier stärker zu spüren als in jedem anderen Lande der Welt. Hier finden wir eine müde Erde, die jahrhundertelang vergewaltigt worden ist, deren Berge zernagt, deren Bäume gefällt, deren Flüsse ausgetrocknet sind und deren Humus zu Staub zerbröckelt. Trotzdem bringt sie Jahr um Jahr für eine kurze Zeit tapfer ihr Laub, ihre Gräser und ihre Blumen hervor. Selbst auf den Bergen, auf den zackigen Tuffhängen, deren Vegetation nicht einmal den Ziegen genügt, erinnerten kleine grüne Flecken an vergangene Fruchtbarkeit.
Wenn man das Land für eine Weile evakuieren könnte, dachte Meredith – wenn man es für ein halbes Jahrhundert von seiner fortpflanzungshungrigen Bevölkerung befreien könnte –, würde es vielleicht wieder zu Kräften kommen. Aber das wird nie geschehen. Sie vermehren sich und vermehren sich, während die Erde unter ihren Füßen dahinsiecht – freilich nur langsam, aber doch zu schnell, als daß die Techniker und Agronomen sie retten könnten.
Die vorbeijagenden, sonnenbeglänzten Bilder ermüdeten seine Augen, er blickte auf und musterte die Leidensgenossen im Gang, die durch Zigarrenrauch, Salami- und Knoblauchgestank und die Ausdünstungen ungewaschener Leiber aus ihren Abteilen vertrieben worden waren. Da standen ein neapolitanischer Geschäftsmann mit enger Hose, kurzschößigem Jackett und einem funkelnden Amethyst an dem einen fetten Finger, ein deutscher Tourist mit dicksohligen Schuhen und einer teuren Leica, zwei flachbrüstige Französinnen, ein amerikanischer Student mit kurzgestutztem Haar und sommersprossigem Gesicht und zwei verliebte Provinzler Hand in Hand in der Nähe der Toilette.
Vor allem das Liebespärchen erregte seine Aufmerksamkeit. Der Bursche war ein vierschrötiger Bauer aus dem Süden, braun wie ein Araber, mit blitzenden Augen und beredten Händen. Die dünne Baumwollhose spannte sich über die Hüften, das durchschwitzte Leibchen klebte an der Brust, so daß seine ganze, kompakte Männlichkeit gleichsam aufdringlich zutage trat. Das Mädchen war klein und ebenso braun wie er, hatte eine dicke Taille und dicke Fesseln, aber die Brüste waren voll und fest und drohten, das tiefausgeschnittene Mieder ihres Kleides zu sprengen. Sie standen voreinander in dem engen Gang, ihre verschränkten Hände bildeten eine Barriere gegen jede Belästigung, ihre Augen sahen nichts als nur das Gegenüber, ihre Körper schaukelten im Rhythmus der Räder. Ihre Verliebtheit war deutlich zu merken, aber man hatte nicht den Eindruck, daß sie es nicht erwarten könnten, einander in die Arme zu stürzen. Der Bursche spreizte sich wie ein Pfau, war jedoch seines Besitzes sicher. Das Mädchen war mit ihm und mit sich selber zufrieden in der kleinen privaten Ewigkeit neuerwachter Liebe.
Als Blaise Meredith sie betrachtete, packte ihn eine vage Sehnsucht nach einer Vergangenheit, die ihm nie gehört hatte. Was wußte er von der Liebe, abgesehen von einer theologischen Definition und den gemurmelten Schuldbekenntnissen im Beichtstuhl? Welchen Sinn hatten seine Ratschläge angesichts dieser offenen erotischen Gemeinsamkeit, welche die göttliche Vorsehung als den Beginn des Lebens und als die Bürgschaft für den Fortbestand der Menschheit gesetzt hat? Sehr bald, vielleicht schon in der kommenden Nacht, werden diese beiden miteinander in den kleinen Tod versinken, aus dem neues Leben erwächst – ein neuer Leib, eine neue Seele. Blaise Meredith aber wird allein schlafen, ihm wird sich das ungeheure Geheimnis des Weltalls auf einen scholastischen Syllogismus in seinem Schädel reduzieren. Wer hatte recht – er oder die beiden? Wer kam näher an die Vollendung der göttlichen Pläne heran? Es gab nur eine Antwort. Eugenio Marotta hatte recht. Er, Meredith, hatte sich von der menschlichen Familie zurückgezogen. Diese beiden strebten vorwärts, um sie zu erneuern und zu erhalten.
Seine Füße begannen zu brennen. Der Rücken tat ihm weh. Wieder meldete sich der leise nagende Schmerz in der Magengrube.
Er wird sich hinsetzen und ausruhen müssen. Als er zu seinem Platz zurückkehrte, hatte der kalabresische Priester eine regelrechte Predigt begonnen:
«… Ein wunderbarer Mann, der Heilige Vater! Ein richtiger Heiliger. Ich war in der Peterskirche ganz in seiner Nähe. Ich hätte die Hand ausstrecken und ihn anrühren können. Man spürte die Kraft, die von ihm ausstrahlt. Wunderbar! Wunderbar! Wir sollten jeden Tag unseres Lebens dem lieben Gott dafür danken, daß uns diese Pilgerfahrt vergönnt war.»
Eine Pfefferminzwolke schwebte durchs Abteil. Blaise Meredith schloß die Augen und bat den Himmel um eine Atempause, aber die schwere kalabresische Stimme schwätzte unablässig weiter:
«… Daß man in Rom war, daß man den Fußstapfen der Märtyrer gefolgt ist und an Petrus’ Grab gekniet hat – was für ein Erlebnis ließe sich damit vergleichen? Hier sieht man die Kirche so, wie sie in Wirklichkeit ist – eine Heerschar von Priestern und Mönchen und Nonnen, die sich darauf vorbereiten, in Christi Namen die Welt zu erobern …»
Wenn wir sie erobern wollen, dachte Blaise Meredith gereizt, dann gnade Gott der Welt. Noch nie hat solcher Firlefanz einem Menschen genützt. Der Kerl redet wie ein Handlungsreisender. Wenn er bloß den Mund halten und ein wenig nachdenken wollte …
Aber der Kalabrese war jetzt richtig in Gang gekommen, und die Anwesenheit eines Amtsbruders spornte ihn zu immer neuen Leistungen an.
«Man hat recht, wenn man Rom die Heilige Stadt nennt. Tag und Nacht schwebt der Geist des großen Hirten über ihr. Aber wohlgemerkt – nicht alle Heiligen der Kirche sind in Rom. O nein! Sogar in unserer eigenen kleinen Provinz haben wir einen Heiligen. Er ist noch nicht offiziell anerkannt – aber er ist einer. Er ist gewiß ein Heiliger!»
Sofort spitzte Blaise Meredith die Ohren. Seine Gereiztheit verschwand, und er wartete gespannt auf die Fortsetzung.
«Der Prozeß der Seligsprechung hat schon begonnen. Giacomo Nerone. Vielleicht habt ihr von ihm gehört! Nein?
Eine seltsame und wunderbare Geschichte. Niemand weiß, wo er herkam, aber eines Tages erschien er im Dorf, wie ein von Gott Gesandter. Er baute eigenhändig eine kleine Klause und widmete sich dem Gebet und der Wohltätigkeit. Als die Kommunisten nach dem Krieg angerückt kamen und das Dorf besetzten, ermordeten sie ihn. Er starb als Märtyrer im Kampf für den Glauben. Und seither haben sich an seinem Grab Wunder über Wunder ereignet. Kranke sind geheilt worden, Sünder haben bereut – sichere Zeichen für die Huld des Allmächtigen.»
Blaise Meredith öffnete die Augen und fragte unschuldsvoll:
«Kannten Sie ihn, Vater?»
Der Kalabrese warf ihm einen raschen, argwöhnischen Blick zu.
«Ob ich ihn gekannt habe? Hm, nein, nicht persönlich. Aber ich weiß natürlich sehr viel von ihm. Ich selber bin aus Cosenza. Das ist die nächste Diözese.»
«Danke», sagte Blaise Meredith höflich und machte wieder die Augen zu. Der Kalabreser rutschte voller Unbehagen auf seinem Platz hin und her und machte sich dann auf den Weg zur Toilette, um Erleichterung zu suchen. Meredith benützte seine Abwesenheit, um die Beine auszustrecken und den schmerzenden Kopf an die gepolsterte Rückstütze zu lehnen. Er bereute nicht, was er getan hatte. Mehr denn je war ihm neuerdings diese Art von Gewäsch zuwider. Es war das eine Art Kirchenjargon, eine depravierte Rhetorik, die nichts erklärt, aber die Wahrheit in Verruf bringt. Sämtliche Fragen werden angeschnitten und keine beantwortet. Das massive Fundament aus Vernunft und Offenbarung, auf dem die Kirche ruht, wird zu einer formlosen, nutzlosen und im wesentlichen falschen Litanei degradiert. Pfefferminzfrömmigkeit. Sie täuscht keinen außer den, der mit ihr hausieren geht. Sie befriedigt nur alte Damen und bleichsüchtige Fräulein, aber sie gedeiht dort am üppigsten, wo die Kirche am festesten in der herrschenden Ordnung verankert ist. Sie ist beim Klerus ein Zeichen der Anpassung, des Kompromisses, der Laxheit: Es fällt ihm leichter, Andacht zu predigen, als sich mit den moralischen und sozialen Problemen der Zeit herumzuschlagen. Das Volk wird nackt und wehrlos den beängstigenden Mysterien ausgeliefert – dem Schmerz, der Leidenschaft, dem Tod, dem großen Vielleicht der Zukunft.
Der dunkelhäutige Kalabrese kehrte zurück, an den Knöpfen seiner Soutane fingernd und entschlossen, sich wieder mit seiner Zuhörerschaft und mit diesem hohlwangigen Monsignore zu verständigen. Er setzte sich, schneuzte sich geräuschvoll und klopfte dann Meredith vertraulich aufs Knie.
«Sie kommen aus Rom, Monsignore?»
«Ja, aus Rom.» Ihn ärgerte die Ruhestörung, sein Ton war schroff; aber der Kalabrese war ein Starrkopf, der keine Hindernisse kannte.
«Aber Sie sind kein Italiener?»
«Nein. Ich bin Engländer.»
«Ah – ein Pilger! Sie haben den Vatikan besucht?»
«Ich arbeite im Vatikan», erwiderte Meredith trocken.
Der Kalabrese lächelte ihm brüderlich zu und zeigte seine schadhaften Zähne.
«Sie dürfen sich glücklich schätzen, Monsignore. Sie haben Möglichkeiten, die uns armen Landleuten versagt sind. Wir bestellen die steinigen Äcker, während Sie die üppigen Wiesen in der Stadt der Heiligen pflegen.»
«Ich pflege gar nichts», sagte Meredith unverblümt. «Ich bin ein Beamter der Ritenkongregation, und Rom ist ebensowenig eine Stadt von Heiligen wie Paris oder Berlin. Es herrscht dort einigermaßen Ordnung, weil der Papst auf seinem durch das Konkordat verbürgten Recht besteht, den heiligen Charakter der Stadt als des Zentrums der Christenheit zu wahren. Das ist alles.»
Der Kalabrese war schlau wie ein Dachs. Er wich dem Rüffel aus und stürzte sich schnell auf das neue Thema, das ihm geboten wurde.
«Was Sie sagen, interessiert mich sehr, Monsignore. Sie leben natürlich in einer größeren Welt als ich. Sie haben mehr Erfahrung in weltlichen Dingen. Aber ich sage immer, das einfache Landleben ist einem frommen Wandel günstiger als das Getriebe einer Großstadt. Sie arbeiten in der Ritenkongregation. Vielleicht haben Sie mit Heiligen und Seligen zu tun. Sind Sie nicht derselben Meinung wie ich?»
Er saß in der Falle, das war ihm klar. Nun ließ sich das lästige Gespräch nicht mehr vermeiden. Er würde Zeit und Energie sparen, wenn er sich nicht länger dagegen sträubte – und in Formia oder in Neapel den Platz zu tauschen versuchte. Er antwortete trocken:
«Meiner Erfahrung nach sind Heilige an den unwahrscheinlichsten Orten – und zu den ungünstigsten Zeiten anzutreffen.»
«Richtig! Das ist es eben, was mich so sehr an unserem eigenen Gottesknecht, Giacomo Nerone, interessiert. Kennen Sie die Gegend, in der er gelebt hat? Gemelli dei Monti?»
«Ich bin noch nie dort gewesen.»
«Aber Sie wissen, was der Name bedeutet?»
«Ich nehme an, das, was er besagt. Die Bergzwillinge.»
«Richtig. Zwei Zwillingsdörfer auf den Gipfeln eines Berges in einer der ödesten Gegenden von Kalabrien. Gemello Minore ist der kleinere, Gemello Maggiore der größere Ort. Sie liegen etwa sechzig Kilometer von Valenta entfernt, und die Straße ist ein Alptraum. Die Einwohner gehören zu den ärmsten unserer Provinz – und zu den geplagtesten –, das heißt, so war es bis zu dem Augenblick, da der Ruhm des Gottesknechts sich zu verbreiten begann.»
«Und dann?» Unwillkürlich fühlte Meredith sein Interesse erwachen.
«Ah – dann!» Mit einer Kanzelgebärde hob er die stämmige Hand.
«Dann geschah etwas Seltsames. Giacomo Nerone hatte in Gemello Minore gelebt und gewirkt. Dort wurde er verraten und ermordet. Sein Leichnam wurde heimlich in eine Grotte bei Gemello Maggiore gebracht und beigesetzt. Seither ist Gemello Minore immer tiefer in Armut und Ruin versunken, während Gemello Maggiore von Tag zu Tag reicher wird. Dort gibt es jetzt eine neue Kirche, ein Krankenhaus, einen Gasthof für Touristen und Wallfahrer. Es ist, als wollte Gott die Verräter bestrafen und die belohnen, die dem Leichnam des Gottesknechtes Schutz gewährt haben. Sind Sie nicht auch dieser Meinung?»
«Das ist eine fragwürdige These», sagte Meredith mit kaum verhohlener Ironie. «Wohlstand ist nicht immer ein himmlischer Gunstbeweis. Es könnte sich um geschickte Reklamemethoden des Bürgermeisters und der Ortsbewohner – und vielleicht sogar des Dorfpfarrers – handeln. So etwas hat man schon erlebt.»
Bei dieser Unterstellung wurde der Kalabrese rot vor Zorn und wies sie heftig zurück.
«Sie gehen zu weit, Monsignore. Kluge und fromme Männer haben die Sache geprüft – Männer, die unsere Bevölkerung kennen. Wollen Sie ihnen widersprechen?»
«Ich widerspreche niemandem», sagte Meredith milde. «Ich bin nur gegen überstürzte Urteile und gegen zweifelhafte Doktrinen. Heilige werden nicht durch Volksabstimmung, sondern durch einen kanonischen Spruch bestimmt. Deshalb fahre ich jetzt nach Kalabrien, um im Fall Giacomo Nerones als Promotor des Glaubens zu fungieren. Wenn Sie mir etwas aus erster Hand mitzuteilen haben, dann werde ich es gern zur Kenntnis nehmen – in der üblichen Form.»
Der Priester starrte ihn eine Sekunde lang mit offenem Munde an, dann zerschmolz seine Selbstsicherheit in gemurmelte Entschuldigungen, denen die Ankunft in Formia ein barmherziges Ende bereitete.
Sie mußten zwanzig Minuten auf den nach Norden gehenden Gegenzug warten. Blaise Meredith hatte Gelegenheit, die Beine auszustrecken – und genug Anstand, sich zu schämen.
Was hatte er durch diesen billigen dialektischen Sieg über einen Landpfarrer erreicht? Der Kalabrese war ein langweiliger Schwätzer – noch dazu ein frommer Schwätzer –, aber Blaise Meredith war ein mißmutiger Intellektueller, ohne eine Spur Nächstenliebe. Er hatte nichts gewonnen und nichts gegeben – und die erste Gelegenheit versäumt, Näheres über den Mann zu erfahren, dessen Leben er zu überprüfen hatte.
Während er auf dem sonnigen Bahnsteig auf und ab ging und zusah, wie die Bauern sich um den Getränkeverkäufer drängten, fragte er sich zum hundertsten Male wo der Fehler liege, der ihm den ungezwungenen Umgang mit seinen Mitmenschen unmöglich machte. Er wußte, daß andere Geistliche großes Vergnügen fanden an dem rauhen, gepfefferten Dialekt der Bauerngespräche. An dem Tisch eines Bauernhofs oder bei einem Glas Wein in der Küche eines Landarbeiters fischten sie Perlen der Weisheit und Lebenserfahrung auf. Sie unterhielten sich ebenso vertraulich mit den grobschnäuzigen Huren von Trastevere wie mit den geschliffenen Signori von Parioli. Sie genossen den derben Humor des Fischmarktes genauso wie die geistreiche Unterhaltung an der Tafel des Kardinals. Außerdem waren sie tüchtige Seelsorger und taten viel für ihre Schäflein, und das bereitete ihnen selber eine ganz besondere Befriedigung.
Worin lag der Unterschied zwischen ihnen und ihm? Leidenschaft, hatte Marotta gesagt. Die Fähigkeit, zu lieben und zu begehren, die Leiden des Nächsten mitzufühlen, seine Freuden zu teilen. Jesus Christus aß und trank Wein mit Spielern und Schenkdirnen, aber Monsignore Meredith, von Berufs wegen sein Nachfolger, hatte mutterseelenallein zwischen verstaubten Folianten in der Bibliothek des Palastes der Kongregation gehaust. Und nun, in seinem letzten Lebensjahre, war er immer noch einsam. In seinem Bauch wuchs ein kleiner grauer Tod heran, und keine Menschenseele auf Erden würde ihm am Sterbebett Gesellschaft leisten.
Der Schaffner pfiff, und Meredith stieg wieder in den Zug ein, um im Schweiße seines Angesichts die lange, beschwerliche Reise durchzuhalten: Neapel, Nocera, Salerno, Eboli, Cassano, Cosenza und dann am späten Abend Valenta, wo der Bischof ihn erwartete, um ihn zu begrüßen.
Aurelio, Bischof von Valenta, war in mehrfacher Hinsicht eine Überraschung. Ein hochgewachsener, magerer Mann Ende der Vierzig. Das stahlgraue Haar war sorgfältig frisiert, die feingeschnittenen Züge mit der Adlernase strahlten Klugheit und Humor aus. Er stammte aus dem Trentino – sonderbar, daß man ihm eine Diözese im Süden gegeben hatte –, und vor seiner Versetzung war er Gehilfe und Stellvertreter des Patriarchen von Venedig gewesen. Er holte Meredith mit seinem eigenen Auto ab, und statt ihn in die Stadt zu bringen, fuhr er mit ihm ein Dutzend Kilometer weit aufs Land hinaus zu einer schönen Villa, die von großen Orangen- und Olivenhainen umgeben war und in ein Tal hinabblickte, in dessen Tiefe ein schmaler Bach im Mondschein glitzerte.
«Ein Experiment», erklärte er in hartem Englisch. «Ein Versuch praktischen Anschauungsunterrichts. Die hiesigen Leute bilden sich ein, daß die Geistlichen mit der Soutane zur Welt kommen und nichts anderes können, als Paternoster und Ave-Marias aufsagen und in der Kathedrale das Weihrauchfaß schwingen. Ich bin im Norden geboren. Meine Angehörigen waren Bergbauern – tüchtige Leute. Dieses Anwesen habe ich einem hiesigen Grundbesitzer abgekauft, der bis über die Ohren in Schulden steckte, und ich bearbeite es mit Hilfe von einem halben Dutzend junger Burschen, denen ich die Grundzüge moderner Landwirtschaft beizubringen versuche. Es ist ein harter Kampf, aber ich glaube, ich werde siegen. Hier habe ich auch meinen offiziellen Wohnsitz genommen. Die frühere Residenz ist hoffnungslos antiquiert – mitten in der Stadt, neben der Kathedrale. Ich habe sie meinem Generalvikar abgetreten. Er stammt aus der alten Schule und fühlt sich dort wohl.»
Meredith lächelte, angesteckt von der guten Laune des Mannes. Der Bischof warf ihm einen listigen Blick zu.
«Sie sind überrascht, Monsignore?»
«Angenehm», erwiderte Blaise Meredith. «Ich hatte etwas ganz anderes erwartet.»
«Bourbonen-Barock? Samt und Brokat und vergoldete Cherubim, an denen hinten die Farbe abblättert?»
«Ja, etwas Ähnliches.»
Der Bischof hielt vor dem Stuckvordach der Villa, blieb eine Weile am Steuer sitzen und ließ den Blick über die Bäume schweifen, deren Spitzen das Mondlicht versilberte. Er sagte ruhig:
«Davon werden Sie hier im Süden mehr als genug zu sehen bekommen – Formalismus, Feudalismus, Reaktion, alte Männer, die an den alten Methoden festhalten, weil die alten Methoden ungefährlicher sind und sie sich auf die neuen nicht vorbereitet haben. Armut und Unwissenheit sind in ihren Augen nicht Ungerechtigkeiten, denen man abzuhelfen hat, sondern ein Kreuz, das man geduldig tragen muß. Sie sind der Meinung, je mehr Priester und Mönche und Nonnen es gibt, desto besser für die Welt. Mir wäre es lieber, sie wären weniger zahlreich und dafür tüchtiger. Weniger Kirchen, aber mehr Menschen, die hineingehen.»
«Und auch weniger Heilige?» fragte Meredith mit Unschuldsmiene.
Der Bischof blickte scharf auf, fing dann zu lachen an.
«Gott sei Dank, daß es Engländer gibt! Eine Portion tramontane Skepsis würde uns allen sehr guttun. Sie fragen sich, warum ein Mann wie ich den Fall Giacomo Nerones aufgegriffen hat?»
«Ehrlich gesagt, ja.»
«Heben wir uns das bis zum Obst und Käse auf», sagte Seine Gnaden ohne jede Bosheit.
Ein Diener in weißer Jacke öffnete die Autotüren und geleitete die beiden ins Haus.
«In dreißig Minuten wird gegessen», sagte Seine Bischöfliche Gnaden. «Hoffentlich wird Ihnen Ihr Zimmer bequem genug sein. Morgen früh können Sie das ganze Tal überblicken und sich ansehen, was wir geschafft haben.»
Er verabschiedete sich, und der Diener führte Meredith nach oben in ein geräumiges Gastzimmer mit einer Glastür, die auf einen engen Balkon führte. Meredith war betroffen von dem klaren, modernen Stil der Möbel, von der asketischen Strenge des hölzernen Kruzifixes über dem Betpult in der Ecke. Auf einem Bücherregal standen französische, italienische und englische Neuerscheinungen, auf dem Nachttisch lag ein Exemplar der Nachfolge Christi. Aus dem Schlafraum führte eine Tür in ein frischgekacheltes Badezimmer mit Toilette und Duschnische. Seine Bischöfliche Gnaden hatte die Instinkte eines Baumeisters und den guten Geschmack eines Künstlers. Außerdem hatte er Sinn für Humor, eine Eigenschaft, die man bei dem italienischen Klerus nur allzu selten antrifft.
Während Meredith badete und sich umzog, fielen die Müdigkeit und die Enttäuschungen der Bahnfahrt von ihm ab wie eine Haut. Sogar der nagende Schmerz schien nachzulassen; vergnügt und neugierig freute er sich auf das Essen mit Seiner Bischöflichen Gnaden. Es war eine einfache Mahlzeit – Antipasto, Zuppa di verdura, Brathuhn, Obst und ein scharfer Landkäse –, aber alles war vorzüglich zubereitet und wurde tadellos serviert, und der Wein war ein fülliger Barolo aus den Weinbergen des Nordens. Die Gespräche, die das Essen begleiteten, waren subtiler, ein Duell zwischen Fachleuten, wobei der Bischof die ersten sondierenden Stöße lieferte.
«Bis zu Ihrer Ankunft, mein lieber Meredith, befürchtete ich, einen Fehler begangen zu haben.»
«Einen Fehler?»
«Dadurch, daß ich mich an Rom um Hilfe gewandt habe. Das enthält eine Konzession. Ich opfere einen Teil meiner Autonomie.»
«Kostet dieses Opfer Eurer Bischöflichen Gnaden sehr viel?»
Der Bischof nickte ernst.
«Möglicherweise ja. Freunde des Modernen und reformwillige Menschen sind immer verdächtig, ganz besonders hier im Süden. Haben sie Erfolg, dann sind sie für ihre konservativen Kollegen ein wandelnder Vorwurf. Scheitern sie, dann werden sie zu einem warnenden Beispiel. Deshalb habe ich es immer für ratsam gehalten, meine eigenen Wege zu gehen, meine Angelegenheiten für mich zu behalten – und die Initiative meinen Kritikern zu überlassen.»
«Haben Sie viele Kritiker?»
«Einige, ja. Die Großgrundbesitzer mögen mich nicht – und sie haben starke Beziehungen zu Rom. Der Klerus findet, daß ich in Moralfragen zu streng und den lokalen Riten und Traditionen gegenüber zu lasch bin. Mein Erzbischof ist Monarchist. Ich bin ein gemäßigter Anhänger sozialer Reformen. Die Berufspolitiker mißtrauen mir, weil ich immerzu predige, daß die Partei weniger wichtig sei als der einzelne, der sie vertritt. Sie machen Versprechungen. Ich sorge gern dafür, daß sie eingehalten werden. Wenn das nicht geschieht, protestiere ich.»
«Finden Sie in Rom Unterstützung?»
Die schmalen Lippen Seiner Bischöflichen Gnaden erschlafften zu einem Lächeln.
«Sie kennen Rom besser als ich, lieber Freund. Man wartet die Ergebnisse ab – und die Ergebnisse einer Politik, wie ich sie bevorzuge, noch dazu in einer solchen Gegend, werden sich vielleicht erst nach zehn Jahren bemerkbar machen. Glückt es mir – schön und gut. Wenn ich scheitere oder zur unrechten Zeit einen Fehler begehe, werden sie weise die Köpfe schütteln und sagen, das hätte man schon seit Jahren erwartet. Deshalb lasse ich sie lieber Rätsel raten. Je weniger sie dort wissen, desto freier kann ich mich rühren.»
«Warum haben Sie dann an Kardinal Marotta geschrieben? Warum haben Sie für die Rollen des Postulators und des Promotors römische Priester erbeten?»
Seine Bischöfliche Gnaden spielte mit seinem Weinglas, drehte den Stiel in den langen, sensiblen Fingern und sah zu, wie das Licht sich in der roten Flüssigkeit brach, bevor es auf dem schneeweißen Tischtuch landete. Er sagte, behutsam die Worte wählend:
«Weil mir das Gebiet neu ist. Ich weiß, was Güte ist, aber Heiligkeit ist mir ein fremder Begriff. Ich glaube an mystische Zusammenhänge, habe aber keine Erfahrung im Umgang mit Mystikern. Ich bin Norditaliener, von Natur aus und durch die Erziehung pragmatisch eingestellt. Ich glaube an Wunder, war aber nie darauf gefaßt, daß sie sich vor meiner Tür ereignen. Deshalb habe ich mich an die Ritenkongregation gewandt.» Er lächelte entwaffnend. «Sie sind in diesen Fragen sachverständig.»
«War das der einzige Grund?»
«Sie sprechen wie ein Inquisitor», sagte Seine Bischöfliche Gnaden mit einem seltsam launigen Lächeln. «Was sollte ich sonst noch für Gründe gehabt haben?»
«Politische», erwiderte Meredith trocken, «wahlpolitische Gründe.»
Zu seinem Erstaunen warf der Bischof den Kopf zurück und lachte herzlich.
«Das also ist es. Ich habe mich schon gewundert, daß Seine Eminenz so entgegenkommend ist. Ich habe mich gewundert, daß er mir nicht einen Italiener, sondern einen Engländer schickt – und zwar einen Weltgeistlichen, statt eines bärtigen Barnabitermönchs. Sehr schlau von ihm. Aber er irrt sich.» Plötzlich erlosch das Lächeln auf seinen Lippen, er wurde wieder ernst. Er stellte das Weinglas hin und breitete mit einer eindrucksvoll erklärenden Geste die Hände aus. «Er irrt sich sehr, Meredith. So geht es in Rom zu. Die Dummen werden noch dümmer, und die Klugen wie Marotta werden so übergescheit, daß sie zuviel sehen. Aus zwei Gründen interessiere ich mich für diesen Fall. Der erste Grund ist simpel und offiziell. Es handelt sich um einen nicht genehmigten Kult. Ich muß ihn untersuchen, ihn billigen oder verurteilen. Der zweite Grund ist nicht so simpel – und die offiziellen Kreise würden ihn nicht begreifen.»
«Marotta vielleicht doch», sagte Meredith gelassen. «Vielleicht auch ich.»
«Warum solltet ihr beide euch von den anderen unterscheiden?»
«Weil Marotta ein kluger alter Humanist ist – und ich, weil ich in zwölf Monaten an Krebs sterben muß.»
Aurelio, Bischof von Valenta, lehnte sich zurück und musterte das blasse, abgezehrte Gesicht seines Gastes. Nach einer langen Pause sagte er in gedämpftem Ton:
«Ich habe über Sie nachgedacht. Jetzt fange ich an, mich auszukennen. Gut, ich werde versuchen, es Ihnen zu erklären. Ein Mensch im Schatten des Todes sollte nicht leicht zu schockieren sein, nicht einmal durch einen Bischof. Ich bin der Meinung, daß die Kirche dieses Landes drastischer Reformen bedarf. Meiner Meinung nach haben wir zu viele Heilige und nicht genug Heiligkeit, zu viele Kulte und nicht genug Katechismus, zu viele Medaillen und nicht genug Medikamente, zu viele Kirchen und nicht genug Schulen. Wir haben drei Millionen Arbeitslose und drei Millionen Frauen, die von Prostitution leben. Wir beherrschenden Staat durch die Christlich-Demokratische Partei und die Bank des Vatikans, aber wir fördern eine Spaltung, die der einen Hälfte des Volkes Wohlstand schenkt und die andere Hälfte im Elend verkommen läßt. Unsere Geistlichen sind mangelhaft geschult und unsicher, aber wir wettern gegen die Antiklerikalen und die Kommunisten. An ihren Früchten wirst du sie erkennen. Und ich halte es für besser, statt eines neuen Attributs der Jungfrau Maria eine neue Ära sozialer Gerechtigkeit zu verkünden. Das zweite ist die unerläßliche Anwendung eines moralischen Prinzips, das erste nur die Definition eines traditionellen Glaubens. Wir Geistlichen bewachen eifriger unsere durch das Konkordat verbürgten Rechte als die Rechte des Volkes, die ihm das Naturrecht und das göttliche Recht verbürgen … Habe ich Sie schockiert, Monsignore?»
«Sie machen mir Mut», erwiderte Blaise Meredith. «Aber warum wünschen Sie sich dann einen neuen Heiligen?»
«Ich will ihn gar nicht haben», sagte der Bischof mit erstaunlichem Nachdruck. «Ich muß den Fall untersuchen, aber ich hoffe von ganzem Herzen, daß das Ergebnis negativ ausfällt. Der Bürgermeister von Gemello Maggiore hat fünfzehn Millionen Lire gesammelt, um die Sache zu finanzieren, aber für ein Waisenhaus der Diözese kann ich keine tausend von ihm bekommen. Wenn Giacomo Nerone seliggesprochen wird, dann werden sie eine neue Kirche brauchen, um ihn unterzubringen. Ich aber brauche barmherzige Schwestern, einen landwirtschaftlichen Berater und zwanzigtausend Obstbäume aus Kalifornien.»
«Warum haben Sie dann Seine Eminenz um Hilfe ersucht?»
«Das ist in Rom ein Prinzip, mein lieber Meredith: Man bekommt immer das Gegenteil von dem, was man erbeten hat.»
Blaise Meredith lächelte nicht. Ein neuer und lästiger Gedanke erwachte in ihm. Er schwieg eine Weile und suchte nach Worten, um ihn zu formulieren.
«Wenn aber der Fall bewiesen wird? Wenn Giacomo Nerone wirklich ein Heiliger und ein Wundertäter ist?»
«Ich sagte Ihnen schon, daß ich ein Pragmatiker bin», erwiderte Seine Bischöfliche Gnaden mit leisem Spott. «Ich warte auf die Fakten. Wann wollen Sie mit Ihrer Arbeit beginnen?»
«Sofort», sagte Meredith. «Meine Zeit ist kurz bemessen. Ich möchte zuerst ein paar Tage lang die Dokumente studieren. Dann werde ich nach Gemelli dei Monti übersiedeln und Zeugen vernehmen.»
«Morgen früh lasse ich Ihnen die Akten aufs Zimmer schicken. Ich hoffe, Sie werden dieses Haus als Ihr Heim und mich als Ihren Freund betrachten.»
«Ich bin Euer Gnaden dankbar, dankbarer, als ich es sagen kann.»
«Kein Grund zur Dankbarkeit.» Der Bischof lächelte bagatellisierend. «Ich werde mich über Ihre Gesellschaft freuen. Ich glaube, wir haben vieles gemeinsam. Ach ja – ich möchte Ihnen einen kleinen Rat geben.»
«Ja?»
«Ich persönlich bin überzeugt, daß Sie in Gemello Maggiore nicht die Wahrheit über Giacomo Nerone erfahren werden. Dort wird er verehrt. Man profitiert von seinem Ruhm. In Gemello Minore sieht die Geschichte anders aus – vorausgesetzt, daß Sie die Leute dazu bewegen können, mit der Sprache herauszurücken. Bisher ist das noch keinem meiner Leute geglückt.»
«Gibt es Gründe dafür?»
«Suchen Sie lieber selbst nach den Gründen, mein Freund. Wie Sie sehen, bin ich ziemlich voreingenommen.» Er schob den Stuhl zurück und stand auf. «Es ist spät, Sie müssen müde sein. Ich schlage Ihnen vor, morgen recht lange zu schlafen. Ich werde Ihnen das Frühstück hinaufschicken.»
Blaise Meredith fand die patrizische Höflichkeit des Mannes geradezu rührend. Er teilte sich nicht gern mit; er war ängstlich darauf bedacht, seine private Sphäre zu hüten, aber jetzt sagte er ganz bescheiden:
«Ich bin ein kranker Mann, Eure Bischöfliche Gnaden. Ich bin plötzlich sehr einsam. Hier fühle ich mich zu Hause. Vielen Dank.»
«Wir sind Brüder in einer großen Familie», sagte der Bischof.
«Aber als Junggesellen werden wir egoistisch und wunderlich. Ich stehe gern zu Diensten. Gute Nacht – und angenehme Träume.»
Als Blaise Meredith in dem großen Gastzimmer allein war, durch dessen geöffnete Fenster der Mond hereinschien, bereitete er sich auf eine neue Nacht vor. Ihr Verlauf war ihm bekannt, aber darum nicht weniger furchterregend. Bis Mitternacht wird er wach liegen, dann wird der Schlaf kommen, flach und unruhig. Noch vor dem ersten Hahnenschrei wird er auffahren, die Eingeweide schmerzverkrampft, im Mund den sauren Galle- und Blutgeschmack. Matt und von Brechreiz gepackt, wird er ins Badezimmer stolpern, sich dann mit Betäubungsmitteln vollpfropfen und sich wieder ins Bett legen. Kurz vor Sonnenaufgang wird er einschlafen – für ein bis zwei Stunden. Das genügte zwar nicht, um ihn zu erfrischen, reichte aber dazu aus, den trägen, langsam verebbenden Lebensstrom durch die Adern zu treiben.
Es war eine seltsame Schar von Schreckgespenstern: die Todesfurcht, der Ekel vor dem langsamen Zerfall, die unheimliche Einsamkeit des gläubigen Christen vor einem Gott, der kein Gesicht hat, den er, ohne ihn gesehen zu haben, anerkennt, der ihm jedoch sehr bald entschleiert und herrlich als sein Richter begegnen wird. Er konnte nicht vor diesen Schrecken in den Schlaf flüchten, und er konnte sie nicht durch Gebete beschwören, weil ihm das Gebet zu einem unfruchtbaren Willensakt geworden war, der die Schmerzen weder zu betäuben noch mit Balsam zu lindern vermochte.
Heute nacht also versuchte er, trotz seiner Müdigkeit, das Fegefeuer hinauszuschieben. Er zog sich aus, schlüpfte in Pyjama, Pantoffeln und Morgenrock und trat auf den Balkon.
Der Mond stand hoch über dem Tal – ein Schiff aus Silber auf leuchtendem Meer. Die Orangenwäldchen schimmerten kalt, die Olivenblätter stachen wie blanke Dolchspitzen aus einer wirren Schattenmasse hervor. Unter ihnen lag das Wasser, flach und voller Sterne, hinter einer Barriere von Holzklötzen und aufgehäuftem Abfall, während die Arme des Gebirges dies alles umfingen, wie starke Wälle, die das Chaos der Jahrhunderte fernhalten.
Blaise Meredith sah es an und fand es gut. Gut an und für sich, gut in dem Manne, der es geschaffen hatte. Der Mensch lebt nicht von Brot allein – aber er kann auch nicht ohne Brot leben. Die Mönche in alter Zeit waren von dem gleichen Gedanken ausgegangen. Sie setzten das Kreuz mitten in eine Wüste – und dann pflanzten sie Getreide und Obstbäume, so daß das dürre Symbol zu einer grünen Wirklichkeit erblühte. Besser als die meisten wußten sie, daß der Mensch ein Geschöpf aus Fleisch und Geist ist, daß aber der Geist nicht anders wirken kann als innerhalb des Fleisches und durch das Fleisch. Ist der Körper krank, dann läßt die moralische Verantwortung des Menschen nach. Der Mensch ist ein denkendes Rohr, aber das Rohr muß fest in schwarzer Erde verankert sein, an den Wurzeln bewässert, von der Sonne erwärmt.
Aurelio, Bischof von Valenta, war ein Pragmatiker, aber ein christlicher Pragmatiker. Er war Erbe der ältesten und orthodoxesten Tradition der Kirche: daß Erde und Gras und Baum und Tier demselben Schöpfungsakt entspringen, der auch den Menschen geschaffen hat. Sie sind an und für sich gut, vollkommen in ihrem Wesen und in den Gesetzen, die ihr Wachstum und ihren Verfall beherrschen. Nur der Mensch kann sie durch Mißbrauch in Werkzeuge des Bösen verwandeln. Einen Baum zu pflanzen, ist folglich eine fromme Handlung. Unfruchtbare Erde zur Blüte bringen heißt, am Schöpfungsakt teilnehmen. Andere Menschen diese Dinge lehren heißt, auch sie an einem göttlichen Plan mitwirken lassen … Aber Aurelio, Bischof von Valenta, war vielen seiner Amtsbrüder suspekt.
Das ist das Geheimnis der Kirche: daß sie in organischer Einheit Humanisten wie Marotta, Formalisten wie Blaise Meredith, Dummköpfe wie den Kalabresen, Reformer, Rebellen und puritanische Gleichschalter, politisierende Päpste und barmherzige Schwestern, Weltpriester und fromme Antiklerikale umschließt. Sie fordert das unerschütterliche Bekenntnis zu der festumrissenen Lehre und gestattet außergewöhnlich große Unterschiede in Fragen der Disziplin. Ihren Dienern erlegt sie Armut auf, spekuliert aber mit Hilfe der Bank des Vatikans an den Weltbörsen. Sie predigt Weltentsagung, sammelt jedoch Grundbesitz wie jede öffentliche Körperschaft. Sie verzeiht Ehebrechern und exkommuniziert Ketzer. Sie ist streng gegen ihre eigenen Reformer, unterzeichnet jedoch Konkordate mit den Leuten, die sie vernichten wollen. In keiner Gemeinschaft der Welt ist das Leben beschwerlicher – aber alle ihre Mitglieder wollen in ihrem Schöße sterben, und ob Papst, Kardinal oder Waschfrau, sie würden dankbar die Letzte Ölung von dem geringsten Landpfarrer entgegennehmen.
Sie ist ein Mysterium und ein Paradoxon – aber Blaise Meredith war weiter davon entfernt, es zu verstehen, weiter davon entfernt, es hinzunehmen, als vor zwanzig Jahren. Das war es, was ihn quälte. Als er noch gesund war, hatte er ohne weiteres den Gedanken einer göttlichen Einmischung in menschliche Angelegenheiten akzeptiert. Nun, da das Leben langsam verrann, klammerte er sich verzweifelt an die einfachsten Erscheinungsformen physischer Fortdauer – an einen Baum, an eine Blume, an ein stilles Gewässer unter ewigem Mondlicht.
Ein leichter Wind wehte durchs Tal, raschelte in dem spröden Laub, kräuselte die Sterne im Wasser. Meredith fröstelte in der jähen Kühle, ging hinein und machte die Glastür hinter sich zu. Er kniete am Betpult unter dem hölzernen Christus nieder und begann zu beten.
«Pater Noster qui es in Coelis …»
Aber der Himmel, falls es ihn gab, war ihm fest verschlossen, und der sterbende Sohn erhielt keine Antwort von dem Vater, der kein Gesicht besaß.