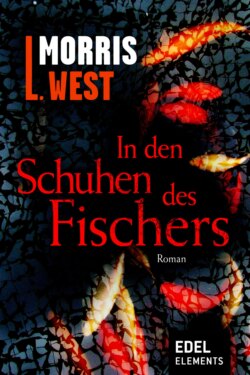Читать книгу In den Schuhen des Fischers - Morris L. West - Страница 5
На сайте Литреса книга снята с продажи.
AUSZUG AUS DEM GEHEIMEN TAGEBUCH VON KYRILL I., PONT. MAX.
ОглавлениеKein Herrscher entgeht dem Urteil der Geschichte, aber ein Herrscher, der ein Tagebuch führt, setzt sich der Gefahr aus, von den Sachverständigen hart behandelt zu werden. Ich wäre ungern wie Pius II., dessen Erinnerungen seinem Sekretär zugeschrieben und von seinen Verwandten bearbeitet wurden, worauf zwei amerikanische Blaustrümpfe fünfhundert Jahre später alle seine Indiskretionen wieder einfügten. Doch ich kann sein Dilemma nachfühlen, das wohl jeder, der auf dem Stuhl Petri sitzt, durchmachen muß. Ein Papst kann nie völlig offen reden außer mit Gott oder mit sich selbst — und ein Papst, der Selbstgespräche führt, kann leicht überspannt wirken, wie die Geschichte einiger meiner Vorgänger gezeigt hat.
Meine Schwäche besteht darin, mich vor Einsamkeit und Abgeschiedenheit zu fürchten. So werde ich Sicherheitsventile benötigen — zunächst einmal das Tagebuch, das ein Kompromiß ist zwischen Selbstbeschwichtigung auf dem Papier und der Übermittlung von Tatsachen an die Nachwelt, die der eigenen Generation vorenthalten werden müssen. Natürlich hat das seine Schwierigkeit. Was tut man mit einem päpstlichen Tagebuch? Der Vatikanischen Bibliothek überlassen? Oder es im dreifachen Sarg mit dem eigenen Leichnam begraben? Besser vielleicht, es überhaupt nicht zu beginnen; wie sonst aber läßt sich in diesem noblen Gefängnis, zu dem ich verurteilt bin, ein wenig Heimlichkeit und Humor verbürgen?
Vor vierundzwanzig Stunden wäre mir der Gedanke an meine Wahl als Ausgeburt ungezügelter Phantasie erschienen. Auch jetzt kann ich nicht verstehen, warum ich sie angenommen habe. Ich hätte ablehnen können. Das tat ich nicht. Warum —?
Wenn ich denke, was ich bin: Kyrill I., Bischof von Rom, Statthalter Jesu Christi, Nachfolger des Apostelfürsten Petrus, oberster Pontifex der Universalkirche, Patriarch des Abendlandes, Primas von Italien, Metropolit der römischen Kirchenprovinz, Souverän des Staates der Vatikanstadt — natürlich glorreich regierend —!
Doch das ist erst der Anfang. Das Pontifikaljahrbuch wird eine zwei Seiten lange Liste der mir unterstehenden Abteien und Präfekturen veröffentlichen, auch der Orden, Kongregationen, Mönchs- und Nonnenklöster, die ich zu »beschützen« habe. Die übrigen zweitausend Seiten werden ein wahres Grundbuch sein, das meine Diener und Untertanen, meine Instrumente der Regierung, Erziehung und Verbesserung aufführt.
Mein Amt bringt es mit sich, daß ich mehrsprachig sein muß, obwohl sich der Heilige Geist mir gegenüber bei der Verleihung der Sprachbegabung weniger großzügig erwiesen hat als dem ersten Mann, der an meinem Platz stand. Meine Muttersprache ist Russisch, meine Amtssprache das Latein der Gelehrten, sozusagen ein Mandarin-Idiom, das die sublimste Definition der Wahrheit auf wundersame Weise wie ein Insekt im Bernstein bewahren soll. Mit meinen Amtsbrüdern muß ich Italienisch sprechen und allen gegenüber das hochtrabende »Wir« anwenden, das geheime Zwiesprache zwischen Gott und mir andeutet, auch wenn es sich um so weltliche Dinge handelt wie der Kaffee, den »Wir« zum Frühstück trinken, und die Benzinmarke, die »Wir« für die Autos der Vatikanstadt benutzen werden.
Das aber ist überlieferte Sitte, und ich darf mich nicht zu sehr dagegen auflehnen. Valerio Rinaldi gab mir einen guten Rat, als er mir heute vormittag eine Stunde nach der Wahl seine Treue entbot und gleichzeitig seinen Rücktritt verkündete. »Eure Heiligkeit sollten nicht versuchen, die Römer zu ändern, sich ihnen entgegenzustellen oder sie zu bekehren. In den letzten neunzehnhundert Jahren sind sie stets mit Päpsten fertig geworden, und sie werden eher Eurer Heiligkeit den Hals brechen, als daß es Eurer Heiligkeit gelänge, sie zu beugen. Doch mit sanftem Auftreten, freundlichen Worten und Zurückhaltung der eigenen Meinung werden Eure Heiligkeit sie zum Schluß wie Grashalme um den Finger wickeln können.«
Es ist wahrlich noch zu früh, vorauszusehen, ob sich die Beziehung zwischen Rom und mir erfolgreich gestalten wird; aber Rom ist nicht mehr die Welt, und so mache ich mir keine allzu großen Sorgen — zumal ich mir die Erfahrung jener, die mir als Kardinalfürsten der Kirche den Eid geleistet haben, zunutze machen kann. Zu einigen habe ich starkes Vertrauen. Andere sind da … Aber ich darf nicht vorschnell urteilen. Nicht alle können wie Rinaldi sein, der weise und gütig ist, Sinn für Humor hat und seine eigenen Grenzen kennt. Vorläufig muß ich nach Möglichkeit Lächeln und gute Laune bewahren, während ich mir den Weg durch den Irrgarten des Vatikans ertaste. Und ich muß meine Gedanken einem Tagebuch anvertrauen, ehe ich sie vor der Kurie oder dem Konsistorium äußere …
Einen Vorteil habe ich freilich insofern, als niemand weiß, welche Richtung ich einschlagen werde — ich weiß es nicht einmal selbst. Ich bin der erste Slawe auf dem Stuhl Petri, der erste Nichtitaliener seit viereinhalb Jahrhunderten. Die Kurie wird vor mir auf der Hut sein. Vielleicht wurden sie inspiriert, mich zu wählen; aber fragen sie sich nicht schon, was für einen Tataren sie sich da eingefangen haben? Schon werden sie erwägen, wie ich ihre Ernennungen und Einflußgebiete neu mischen werde. Wie können sie wissen, wie sehr ich bange und an mir selbst zweifle? Hoffentlich denken einige daran, für mich zu beten.
Das Amt des Papstes ist das paradoxeste der Welt, das absoluteste und zugleich das begrenzteste, das reichste an Einkünften und das ärmste an persönlichem Entgelt. Es wurde von einem Zimmermann aus Nazareth begründet, der nichts hatte, worauf er sein Haupt hätte betten können, und ist doch von mehr Pomp und Gepränge umgeben, als es in dieser hungernden Welt angebracht scheint. Es ist ohne Grenzen, ist aber ständig nationalen Intrigen und dem Druck der Parteien ausgesetzt. Der Mann, der es annimmt, erhebt damit Anspruch auf göttliche Bürgschaft gegen Irrtümer, ist aber des Seelenheils weniger sicher als der Geringste seiner Gläubigen. Die Schlüssel zum Himmelreich hängen an seinem Gürtel, und doch kann es sein, daß er sich für immer ausgeschlossen sieht vom Frieden der Erwählten und der Gemeinschaft der Heiligen. Wenn er behauptet, unberührt von Selbstherrlichkeit und Ehrgeiz zu sein, spricht er die Unwahrheit. Wenn er nicht manchmal von Furcht erfaßt ist und oft im Dunkeln betet, dann ist er ein Tor.
Ich begreife — oder jedenfalls beginne ich zu begreifen. Heute morgen hat man mich gewählt, und heute abend bin ich allein auf dem Berg der Heimsuchung. Er, dessen Statthalter ich bin, verhüllt Sein Antlitz vor mir. Diejenigen, deren Hirte ich sein muß, kennen mich nicht. Die Welt liegt ausgebreitet zu meinen Füßen wie eine Generalstabskarte — und ich sehe Flammenzeichen an jeder Grenze. Ratlose Augen sind aufwärts gewandt, und babylonisches Stimmengewirr ruft einen Unbekannten an … O Gott, gib mir Licht, zu sehen, und Kraft, zu erkennen, und Tapferkeit, auszuharren in der Knechtschaft der Knechte Gottes!
Mein Diener hat soeben mein Schlafgemach vorbereitet. Er ist ein schwermütiger Mann und sieht einem Wärter in Sibirien ähnlich, der mich abends immer einen ukrainischen Hund und am Morgen einen ehebrecherischen Pfaffen schimpfte. Dieser Mann aber fragt demütig, ob Seine Heiligkeit noch irgend etwas brauche. Dann kniet er nieder und erbittet meinen Segen für sich und seine Familie. Verlegen wagt er den Vorschlag, wenn ich nicht zu müde sei, möchte ich doch geruhen, mich noch einmal den Leuten zu zeigen, die noch auf dem Petersplatz warten.
Sie jubelten mir heute morgen zu, als ich auf den Balkon trat, um der Stadt und der Welt meinen ersten Segen zu erteilen. Doch solange bei mir Licht brennt, wird es anscheinend immer einige geben, die auf irgendein Zeichen der Macht oder der Milde aus dem päpstlichen Schlafzimmer warten. Wie kann ich ihnen sagen, daß sie von einem Manne mittleren Alters in gestreiftem Baumwollpyjama nicht zuviel erhoffen dürfen? Doch heute abend ist es anders. Auf der Piazza wimmelt es von Römern und Besuchern der Stadt, und es wäre höflich — entschuldigen Eure Heiligkeit, sehr leutselig! — mit einem kleinen Segen zu erscheinen …
Ich geruhe leutselig; und abermals werde ich von den brandenden Hochrufen emporgetragen. Ich bin der Papst, ihr Vater, und sie wünschen mir inbrünstig ein langes Leben. Ich segne sie, ich strecke ihnen die Arme entgegen, und wieder jubeln sie, und ich erlebe einen seltsamen, herzergreifenden Augenblick, in dem es mir vorkommt, als umfaßten meine Arme die Welt — und als wäre sie mir zu schwer. Dann führt mich mein Diener — oder ist es mein Wärter? — ins Zimmer zurück, schließt das Fenster und zieht die Vorhänge zu, zum Zeichen, daß Seine Heiligkeit Kyrill I., zumindest offiziell, im Bett liege und schlafe.
Der Diener heißt Gelasio — den gleichen Namen hatte ein Papst. Er ist ein guter Bursche, und es freut mich, kurze Zeit seine Gesellschaft zu genießen. Wir unterhalten uns eine Weile, und dann fragt er mich errötend und stammelnd nach meinem Namen. Er ist der erste, der es wagt, diese Frage zu stellen, abgesehen von Rinaldi, der nach meiner Ankündigung, daß ich meinen Taufnamen zu behalten wünsche, mit spöttischem Lächeln sagte: »Ein erhabener Stil, Heiligkeit — auch herausfordernd. Aber lassen Sie ihn um Gottes willen nicht ins Italienische abwandeln.«
Ich folgte seinem Rat und erklärte den Kardinälen wie auch jetzt meinem Kammerdiener, daß ich den Namen behalten habe, weil der Apostel der Slawen so hieß, der die kyrillische Schrift geschaffen haben soll und der sich hartnäckig für das Recht des Volkes einsetzte, den Glauben in der eigenen Sprache zu bewahren. Ich erklärte ihnen auch, daß es mir lieber wäre, wenn mein Name in der slawischen Form als Zeugnis für die Universalität der Kirche benutzt würde. Nicht alle billigen es, denn es ist ihnen durchaus klar, daß die erste Handlung eines Mannes für die Zukunft entscheidend ist.
Niemand erhob jedoch einen Einwand außer Leone, der Dekan des Heiligen Kollegiums, der den Ruf eines neuzeitlichen Hieronymus hat; ob wegen seiner Vorliebe für die Überlieferung, wegen seines spartanischen Lebenswandels oder seiner berühmten rauhen Schale, könnt ich noch nicht feststellen. Leone fragte spitz, ob sich ein slawischer Name im reinen Latein der päpstlichen Enzyklika nicht etwas absonderlich ausnähme. Obwohl er mich im Konklave als erster proklamiert hat, mußte ich ihm freundlich sagen, es liege mir mehr am Herzen, daß meine Enzykliken vom Volk gelesen würden, als daß sie die Lateiner entzückten; zudem könne es uns nicht schaden, gleichsam mit der Schuhspitze im anderen Lager zu stehen, da das Russische die kanonische Sprache der marxistischen Welt sei.
Er nahm den Tadel in guter Haltung hin, aber ich glaube, daß er ihn nicht so leicht vergessen wird. Menschen, die Gott von Berufs wegen dienen, betrachten Ihn gern als Privatbesitz. Manche von ihnen würden auch Seinen Statthalter gern zum Privatbesitz machen. Ich will damit nicht sagen, daß Leone zu diesen gehört; doch ich muß mich vorsehen. Ich werde anders arbeiten müssen als alle meine Vorgänger, und ich kann mich nicht dem Diktat irgendeines Mannes unterwerfen, wie hoch er auch stehen oder wie gut er auch sein mag.
All dies hat natürlich nichts mit meinem Diener zu tun, der nur eine einfache Geschichte von einem Missionsheiligen nach Hause nehmen und sich durch das Vertrauen eines Papstes geehrt fühlen wird. Der Osservatore Romano wird morgen genau dieselbe Geschichte bringen, aber für die Zeitung wird es »ein Sinnbild der väterlichen Sorge Seiner Heiligkeit um jene sein, die sich, obwohl guten Glaubens, in schismatische Gemeinden spalten …« Ich muß mich, sobald ich kann, mit dem Osservatore befassen. Wenn meine Stimme in der Welt gehört werden soll, muß man ihren echten Ton vernehmen.
Ich weiß, daß schon mein Bart Anstoß erregt. Ich hörte Gemurmel von »allzu byzantinischem Aussehen«. Die Römer sind in diesen Dingen empfindlicher als wir; vielleicht wäre es deshalb entgegenkommend gewesen, ihnen zu erklären, daß meine Kinnlade bei einem Verhör gebrochen wurde und daß ich ohne Bart etwas entstellt bin. Das ist zwar nur eine Kleinigkeit, und doch haben sich schon wegen noch geringerer Dinge Kirchenkämpfe ergeben.
Ich möchte wissen, was Kamenew gesagt hat, als er die Neuigkeit von meiner Wahl erfuhr. Ich bin neugierig, ob er genügend Humor hat, mir einen Gruß zu senden.
Ich bin müde — müde bis ins Mark, und mir bangt. Meine Aufgabe ist so einfach: den Glauben rein erhalten und die verstreuten Schafe unversehrt in die Hürde bringen. Doch auf welch unbekanntes Feld mich das führen mag, kann ich nur vermuten. — Führe uns nicht in Versuchung, o Herr, sondern erlöse uns von dem Übel. Amen.