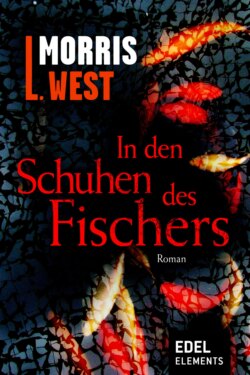Читать книгу In den Schuhen des Fischers - Morris L. West - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
2
ОглавлениеIm weißen Marmorsaal des Ausländer-Presseklubs streckte George Faber die Beine aus und gab sein Urteil über die Wahl kund: »Für den Osten ein Stein des Anstoßes, für den Westen eine Torheit, für die Römer eine Katastrophe.«
Beifälliges Gelächter erhob sich ringsum. Ein Mann, der so viele Jahre im Bereich des Vatikans gearbeitet hatte, durfte Sprüche machen, auch einmal billige. Da er der Aufmerksamkeit seiner Zuhörer gewiß war, sprach er ruhig und selbstsicher weiter:
»Wie man es auch anschaut, Kyrill I. bedeutet ein politisches Schlamassel. Siebzehn Jahre lang war er ein Gefangener der Russen, also wird mit einem Schlag jede Hoffnung auf Verständigung zwischen dem Vatikan und den Sowjets ausgelöscht. Amerika ist ebenfalls einbezogen. Ich denke, wir können damit rechnen, daß die Neutralitätspolitik immer mehr aufgegeben und daß sich der Vatikan allmählich ganz nach dem Westen ausrichten wird. Wir kehren zum Pacelli-Spellman-Bündnis zurück. Für Italien …« Beredsam streckte er die Hände aus, als wollte er die ganze Halbinsel umarmen. »Na — und was wird nun aus Italiens Wiederaufbauwunder? Es entstand durch die Zusammenarbeit mit dem Vatikan — Vatikangeld, Vatikanprestige im Ausland, vatikanische Flüchtlingshilfe, Autorität des Klerus, der die Linke in Schach hielt —. Was wird nun werden? Wenn er mit neuen Ernennungen anfängt, könnte das Band zwischen dem Vatikan und der Republik reißen. Das heikle Gleichgewicht kann sehr leicht gestört werden.« Faber entspannte sich wieder und bedachte seine Kollegen mit einem gewinnenden und entschuldigenden Lächeln. »Jedenfalls ist das meine Ansicht, und ich bleibe dabei. Sie können mich mit einem Hinweis auf meinen Artikel zitieren — aber wenn mir jemand meine Schlagzeilen stiehlt, werde ich ihn verklagen!«
Collins von der Londoner Times zuckte unzufrieden die Schultern und kehrte mit einem Deutschen aus Bonn zur Bar zurück. »Faber ist zwar ein Scharlatan, aber mit seiner Beurteilung der italienischen Lage hat er nicht so unrecht. Mich hat diese Wahl bestürzt. Nach allem, was ich höre, sollen die meisten Italiener dafür gewesen sein — allerdings ließ sich keiner von ihnen etwas davon anmerken, bevor sie ins Konklave gingen. Es ist eine wunderbare Waffe für die Rechte wie für die Linke. Sowie der Papst von irgendwelchen italienischen Angelegenheiten spricht, kann man ihn als einen Ausländer bezeichnen, der sich in die Lokalpolitik einmischt. So erging es auch dem Holländer — welcher war es doch noch, Hadrian VI.? Die Geschichte zeigt ihn als einen klugen Mann und vernünftigen Administrator, aber nach seinem Tode war die Kirche in noch größeren Schwierigkeiten als zuvor. Ich habe diesen barocken Katholizismus, den die Italiener der Welt bieten, nie gemocht; doch politisch hat das seinen Wert — das ist wie bei den Iren. Wenn Sie verstehen, was ich meine.«
»Für einen Bildartikel ist der Bart wundervoll.« Das kam von einer Brünetten mit gierigem Mund am anderen Ende der Bar. »Und es könnte lustig werden, ein paar griechisch- oder ruthenisch-byzantinische Zeremonien im Vatikan zu haben. All die prachtvollen Gewänder und die Ikonen, die auf der Brust baumeln. Man könnte damit eine neue Mode ins Leben rufen — Anhänger für den Winter!« Sie lachte.
»Es ist rätselhaft«, sagte Boucher, der Franzose mit dem Fuchsgesicht. »Ein vollständiger Außenseiter — nach dem kürzesten Konklave der Geschichte! Ich sprach mit Morand und mit einigen unserer Freunde. Es macht den Eindruck der Verzweiflung — als ob sie den Weltuntergang voraussähen und einen besonderen Menschen brauchten, der sie ihm entgegenführt. Nun, sie könnten recht haben. Die Chinesen sind nach Moskau gegangen, und es heißt, sie wollten einen Krieg, oder sie würden die marxistische Welt zerspalten. Vielleicht kommt es zum Krieg? Und dann ist es mit aller Politik zu Ende, und wir sollten lieber zu beten anfangen.«
»Ich hörte heute vormittag etwas Merkwürdiges.« Der Schweizer Feuchtwanger trank einen Kaffee und sprach im Flüsterton mit dem Schweden Erikson. »Gestern kam ein Kurier aus Moskau über Warschau und Prag nach Rom. Heute früh war jemand von der Russischen Gesandtschaft bei Kardinal Potocki. Natürlich läßt niemand ein Wort verlauten — aber ich wüßte gern, ob Rußland von diesem Mann etwas erwartet. Kamenew steckt in Schwierigkeiten mit den Chinesen, und er hat von jeher weit über seine Nase hinaus gesehen.«
»Seltsam«, sagte Fedorow von der Nachrichtenagentur TASS leise, »seltsam! Wohin man heute schaut, überall fühlt man Kamenews Finger. Auch dabei ist wieder seine Hand im Spiel.« Der Tscheche Beron nickte weise, schwieg jedoch. Der große Kamenew war außerhalb der Reichweite seiner bescheidenen Feder; und nachdem es ihm gelungen war, die letzten zwanzig Jahre zu überleben, hatte er gelernt, daß es besser war, ein Jahr lang nichts zu sagen, als sich einen Augenblick lang ein unüberlegtes Wort zu erlauben.
Der Russe sprach weiter mit dem ruhigen Eifer des Orthodoxen. »Vor Monaten hörte ich ein Gerücht — damals war es nur ein Gerücht —, Kamenew hätte die Flucht dieses Mannes in die Wege geleitet, und das Präsidium verlange deswegen seinen Kopf. Obwohl wir nicht darüber sprechen durften, ist das Geheimnis jetzt enthüllt. Es war Kamenew. Und er muß sich ins Fäustchen lachen, wenn er einen Mann, der sein Mal trägt, auf dem apostolischen Thron sitzen sieht.«
»Und was hält das Präsidium davon?« fragte der Tscheche vorsichtig.
Fedorow zuckte die Schultern und spreizte seine stumpfen Finger auf dem Tisch. »Es ist natürlich einverstanden — warum nicht? Jeder von ihnen trägt ja Kamenews Mal. Außerdem ist der Mann ein Genie. Wer sonst hätte das zuwege gebracht, was allen Fünfjahresplänen nicht gelungen ist — die sibirische Ebene zur Blüte zu bringen? Vom Baltikum bis Bulgarien. Schauen Sie, was er geleistet hat! Zum erstenmal haben wir in den Westsümpfen Frieden. Sogar die Polen hassen uns nicht mehr allzu sehr. Wir exportieren Getreide. Man denke! Ich sage Ihnen, was dieser Mann auch tut, das Präsidium und das Volk müssen ihm Beifall zollen.«
Der Tscheche nickte und stellte dann noch eine Frage. »Dieses — dieses Mal von Kamenew: Worin besteht es?«
Der Mann von der Agentur trank einige Schlucke und antwortete dann: »Er sprach einmal davon, glaube ich. Ich war nicht dabei, aber man erzählte es mir. Er sagte: ›Wenn man einen Menschen beim Verhör einmal seziert hat, wenn man die einzelnen Teile auf den Tisch gelegt und wieder zusammengesetzt hat, dann geschieht etwas Sonderbares. Entweder liebt oder haßt man ihn für den Rest des Lebens. Man wird von ihm ebenso geliebt oder gehaßt. Man kann einen Menschen oder ein Volk nicht durch eine Hölle führen, ohne sich zu wünschen, auch einen Himmel mit ihm zu teilen!‹ Darum liebt das Volk ihn. Er hat die Leute drei Jahre lang auf die Folter gespannt und ihnen dann plötzlich eine neue Welt gezeigt.« Fedorow leerte sein Glas in einem Zug und stellte es auf den Tisch. »Ein großer Mann, der größte, den wir seit Zar Peter hatten!«
»Und dieser Papst — dieser Kyrill —, was für ein Mensch ist er wohl?«
»Ich weiß nicht«, sagte der Russe nachdenklich. »Wenn Kamenew ihn liebt, können seltsame Dinge geschehen. Vielleicht werden beide seltsame Dinge erleben.«
Papst Kyrill war noch nicht gekrönt, doch schon hatte er das Gewicht der Macht zu spüren bekommen. Der Schock war größer, als er sich’s hätte träumen lassen. Zweitausend Jahre und die ganze Ewigkeit lagen in seinen Händen. Fünfhundert Millionen Menschen waren ihm untertan, und in jeder Währung wurde ihm Tribut gezollt. Täglich erging er sich im Garten des Vatikans. Er konnte die Grenzen seines Reiches mit einem Tagesspaziergang abmessen; doch dieses kleine Gebiet war nur ein Standplatz, von dem aus seine Macht über den ganzen Erdball ausstrahlte.
Die Männer, die ihn erhoben hatten, konnte er nun mit einem Wort stürzen. Die jahrhundertealten Schätze, die sie ihm mit den Schlüsseln übergeben hatten, konnte er klug einteilen oder töricht vergeuden. Sein Regierungssystem war komplexer und doch weniger kostspielig als jedes andere in der Welt. Die Spielzeugsoldaten, die ihn bewachten, waren durch das Gelübde an ihn gebunden, ihm mit ihren Fähigkeiten, ihrem Herzen, ihrem Willen und ihrem enthaltsamen Leben zu dienen. Andere Herrschende behaupteten das Feld durch die Stimmen wankelmütiger Wähler, den Druck einer Partei oder die Tyrannei einer Militärjunta. Er allein behauptete es durch göttliche Berufung, und keiner seiner Untergebenen wagte, sie ihm abzusprechen.
Doch das Bewußtsein der Macht war etwas anderes als ihre Ausübung. Was er für die Kirche vorhaben und welche Umwälzungen er für die Zukunft auch planen mochte, vorläufig mußte er sich der Instrumente bedienen, die ihm zur Verfügung standen, und der Organisation, die ihm seine Vorgänger überliefert hatten. Er mußte vieles sehr schnell lernen, obwohl es ihm in den Tagen vor seiner Krönung fast so schien, als bestünde eine Art Verschwörung, ihm die Zeit zum Denken oder Planen zu nehmen. Es gab Augenblicke, in denen er sich wie eine für das Spiel auf der Bühne kostümierte und postierte Marionette vorkam.
Die Schuhmacher erschienen, um Maß für neue Schuhe zu nehmen, die Schneider, um seine weißen Soutanen anzufertigen. Juweliere legten ihm Entwürfe für seinen Ring und das Brustkreuz vor. Die Heraldiker unterbreiteten ihm Zeichnungen für sein Wappen: Gekreuzte Schlüssel als Sinnbild der Mission Petri, ein aufgerichteter Bär auf weißem Feld, darüber die Taube des Heiligen Geistes, darunter der Leitspruch: »Ex oriente lux — Aus dem Osten kommt das Licht.«
Das Wappen gefiel ihm auf den ersten Blick. Es sagte seiner Vorstellungskraft und seinem Sinn für Humor zu. Bis ein Bär die Höhe seiner Kraft erreichte, bedurfte es einiger Zeit; doch voll ausgewachsen war er gewaltig. Wenn der Heilige Geist den Papst leitete, durfte er hoffen, viel für die Kirche zu tun. Und vielleicht war der Osten allzu lange im Dunkel geblieben, weil der Westen das universale Evangelium nach eigenen Gesichtspunkten geformt hatte.
Der Kämmerer führte ihn durch eine Audienz nach der anderen — mit der Presse, mit dem Diplomatischen Corps, mit den adligen Familien, die Anspruch auf einen Platz beim päpstlichen Thron erhoben, mit Präfekten und Sekretären von Kongregationen, Tribunalen und Kommissionen. Die Brevekanzlei und die Sekretarie der Fürstenbreven sorgten dafür, daß sich auf seinem Schreibtisch in untadeligem Latein abgefaßte Dankschreiben auf alle Glückwünsche und Telegramme häuften. Die Staatssekretarie erinnerte ihn täglich an Krisen, Wirren und Intrigen in den Gesandtschaften.
Bei jedem Schritt, den er tat, stieß er auf Geschichte, Ritual und Protokoll und auf die beschwerliche Methodik des vatikanischen Regierungssystems. Wohin er sich auch wendete, immer stand ein Amtsvertreter neben ihm und lenkte das Augenmerk Seiner Heiligkeit auf dieses oder jenes — eine Ernennung mußte erfolgen, eine Höflichkeit erwiesen oder eine Begabung gefördert werden. Das Bühnenbild war großartig, die Regie emsig an der Arbeit; aber er brauchte fast eine Woche, um den Titel des Stückes zu finden. Es war eine alte römische Komödie, einstmals sehr beliebt, doch jetzt etwas in Verruf geraten; ihr Titel lautete: Das Beherrschen der Herrscher. Das Thema war einfach — es ging darum, wie man einem Menschen absolute Macht verleiht und dann ihre Ausübung beschränkt. Die Technik bestand darin, ihm das Gefühl seiner eigenen Wichtigkeit zu geben und ihn so sehr mit pompösen Bagatellen zu beschäftigen, daß er keine Zeit fand, eine Richtlinie festzulegen oder sie zu verfolgen.
Als der Ukrainer Kyrill die Komik erfaßte, die darin lag, lachte er im stillen und beschloß, sich einen eigenen Einfall zu erlauben. So berief er zwei Tage vor seiner Krönung unvermittelt alle Kardinäle in die Borgiasäle des Vatikans zu einer Privatbesprechung. Die Plötzlichkeit war Absicht und das Wagnis wohlbedacht.
Am Tage nach der Krönung sollten alle auswärtigen Kardinäle Rom verlassen und in ihre Länder zurückkehren. Jeder konnte sich als williger Helfer der päpstlichen Politik oder als heimliches Hindernis erweisen. Ohne Ehrgeiz und ohne Geschmack an der Macht wurde man selten Kirchenfürst. Und man alterte in einem solchen Amt selten ohne eine gewisse Verhärtung des Herzens und des Willens. Sie waren nicht schlichte Untertanen, diese Kardinäle; sie waren auch Berater, die eifrig über ihre apostolische Nachfolge und die damit zusammenhängende Autonomie wachten. Auch ein Papst mußte sie behutsam behandeln und durfte ihrer Klugheit und Treue oder ihrem nationalen Stolz nicht Gewalt antun.
Als Kyrill sie vor sich sitzen sah, alt, weise, scharfsinnig und erwartungsvoll, sank ihm das Herz, und er fragte sich zum hundertsten Male, was er ihnen und der Kirche zu bieten habe. Dann schien es ihm abermals, als ob sich die Kraft in ihm erneuerte; er bekreuzigte sich, rief den Heiligen Geist an und sprang mit einem Satz in die Geschäfte des Konsistoriums. Er machte keinen Gebrauch vom Pluralis majestatis, sondern sprach vertraulich und persönlich und schien eine Atmosphäre von Freundschaft und Verständnis schaffen zu wollen:
»Meine Brüder, meine Helfer in Christo …« Seine Stimme war kraftvoll, doch seltsam zart. »Ihr habt mich zu dem gemacht, was ich heute bin. Aber wenn unser Glaube der Wahrheit entspricht, bin ich nicht durch euch, sondern durch Gott an die Stelle des Fischers gesetzt worden. Tag und Nacht habe ich mir die Frage vorgelegt, was ich Ihm und Seiner Kirche bieten kann — denn ich habe so wenig. Wie Lazarus bin ich des Lebens beraubt und dann durch die Hand Gottes gerettet worden. Ihr alle seid Menschen dieser Zeit. Ihr seid mit ihr gewachsen, seid durch sie verändert worden, habt zur besseren oder schlechteren Wandlung beigetragen. Es ist nur natürlich, daß jeder von euch seinen Platz und sein Wissen mit Eifer hütet und auch die Autorität, die ihr mit der Zeit erworben habt. Nun aber muß ich euch bitten, großmütig mit mir zu sein und mir im Namen Gottes von eurem Wissen und eurer Erfahrung abzugeben.« Seine Stimme schwankte ein wenig, und den Greisen kam es einen Augenblick lang vor, als sei er den Tränen nahe. Dann faßte er sich, und er schien zu wachsen, während seine Stimme einen festeren Ton annahm. »Im Gegensatz zu euch bin ich kein Mensch dieser Zeit, da ich siebzehn Jahre im Gefängnis verbracht habe und die Zeit an mir vorbeigegangen ist. So vieles in der Welt ist mir neu. Die einzige Ausnahme bildet der Mensch; ihn kenne und liebe ich, und ich habe die einfachen Erfahrungen des Lebenskampfes lange mit ihm geteilt. Doch sogar die Kirche ist mir nahezu fremd, weil ich lange Zeit allem äußerlich Kirchlichen entsagen und mich um so verzweifelter an das halten mußte, was ihre innere Natur und ihr Wesen ausmacht: das Glaubensbekenntnis, das Opfer und die Sakramente.«
Zum erstenmal lächelte er sie an: er spürte ihr Unbehagen und suchte, sie zu beschwichtigen. »Ich weiß, was ihr denkt — daß ihr vielleicht einen Neuerer zum Papst habt, einen veränderungssüchtigen Mann. Dem ist nicht so. Mancherlei Umwälzungen zwar sind notwendig, aber wir müssen sie gemeinsam bewerkstelligen. Ich möchte mich hier nur erklären, damit ihr mich versteht und mir helft. Ich kann mich nicht so eifrig wie manche dem Ritual und den überlieferten Formen ergeben, weil ich jahrelang keinen Halt hatte außer den schlichtesten Formen des Gebets und der Sakramente. Ich weiß, glaubt mir, ich weiß, daß es Menschen gibt, für welche der geradeste Weg der sicherste ist. Ich wünsche ihnen innerhalb der Bindungen des Glaubens so viel Freiheit wie möglich. Ich will die lange Tradition des priesterlichen Zölibats nicht brechen. Ich selbst war enthaltsam wie ihr. Aber ich habe gesehen, wie der Glaube von verfolgten und verheirateten Priestern bewahrt wurde, die ihn ihren Kindern weitergaben wie ein kostbares Juwel. Ich kann mich über die Gesetze der Kanonisten und über die Zwistigkeiten religiöser Kongregationen nicht ereifern, weil ich Frauen gesehen habe, die von ihren Gefängniswärtern vergewaltigt wurden, und ich habe sie mit diesen geheiligten Händen von ihren Kindern entbunden.« Wieder lachte er und streckte seine verkrümmten Hände in bittender Gebärde aus. »Vielleicht bin ich nicht der richtige Mann für euch, meine Brüder, aber Gott hat mich euch gegeben, und ihr müßt mit mir vorliebnehmen.«
Es entstand eine lange Pause, und danach fuhr er noch kräftiger fort, nicht bittend, nicht erklärend, sondern fordernd mit all der Gewalt, die ihn bedrängte:
»Ihr fragt mich, wohin ich euch führen will, wohin ich die Kirche führen will. Ihr sollt es erfahren. Ich will euch durch die Menschen zu Gott zurückführen. Begreift das, begreift es mit Geist und Herz und gehorsamem Willen. Wir dienen Gott durch den Dienst am Menschen. Wenn wir den Kontakt mit den Menschen verlieren — mit leidenden, sündigen, verirrten, verwirrten Männern, die nachts weinen, mit gequälten Frauen und schreienden Kindern —, dann sind auch wir verloren. Dann sind wir nachlässige Hirten, die alles getan haben außer dem einen, das notwendig ist.« Groß, blaß und fremdartig stand er ihnen gegenüber mit seinem vernarbten Gesicht und dem schwarzen Bart. Wie eine Herausforderung warf er ihnen die förmliche Frage zu: »Quid vobis videtur? … Was meint ihr dazu?«
Für diesen Augenblick bestand ein Ritual wie für alles im vatikanischen Leben. Die Kardinäle nahmen die rote Kappe ab, beugten den Kopf und warteten, bis es ihnen freistand, den vernommenen Rat zu befolgen oder nicht. Eine päpstliche Ansprache war selten ein Dialog, aber diesmal machten sich starke Spannungen, ja sogar die Anzeichen eines Konfliktes in der Versammlung bemerkbar.
Kardinal Leone erhob sich schwerfällig von seinem Sessel, warf die weiße Löwenmähne zurück und wandte sich an den Papst: »Wir alle hier haben gelobt, unser Leben in den Dienst Eurer Heiligkeit und der Kirche zu stellen. Aber wir würden diesen Dienst schlecht versehen, wenn wir nicht unseren Rat anböten, sobald wir es notwendig finden.«
»Darum habe ich ja gebeten«, antwortete Kyrill milde. »Bitte sprechen Sie offen.«
Leone dankte ernst und fuhr mit Festigkeit fort: »Es ist noch zu früh, die Wirkung der Wahl Eurer Heiligkeit auf die Welt im allgemeinen und auf die römische und italienische Kirche im besonderen zu bemessen. Ich meine es nicht unehrerbietig, wenn ich sage, daß bei äußeren und öffentlichen Anlässen kluge Zurückhaltung geübt werden sollte, bis wir diese Reaktion kennen.«
»Dagegen habe ich keinen Widerspruch«, sagte Kyrill im gleichen milden Ton. »Aber Sie dürfen mir nicht entgegentreten, wenn ich meinen Wunsch äußere, daß meine Stimme von allen Menschen gehört werden soll — nicht eine andere Stimme mit anderem Tonfall oder anderer Diktion, sondern meine Stimme. Ein Vater spricht mit seinen Kindern nicht durch eine Maske. Er spricht einfach, offen und aus dem Herzen, und genau das habe ich vor.«
Der alte Löwe wich und wankte nicht; hartnäckig entgegnete er: »Man muß der Wirklichkeit ins Auge sehen. Die Stimme Eurer Heiligkeit wird sich ändern, ganz gleich, was Sie tun. Sie wird sich vervielfachen, sie wird aus dem Munde eines mexikanischen Bauern kommen, eines englischen Akademikers und eines deutschen Missionars in der Südsee. Sie wird von einer feindseligen Zeitung oder einem theatralischen Fernsehkommentator gedeutet werden. Eure Heiligkeit können höchstens damit rechnen, daß die erste Stimme die Ihre ist und der erste Bericht echt.« Er erlaubte sich ein grimmiges Lächeln. »Auch wir sind die Stimmen Eurer Heiligkeit, und sogar uns mag es mitunter schwerfallen, den richtigen Ton zu treffen.« Er setzte sich inmitten beifälligen Gemurmels.
Hierauf ergriff Pallenberg, der magere, kühle Deutsche, das Wort und legte sein Problem dar. »Eure Heiligkeit haben von Veränderungen gesprochen. Meiner Ansicht nach — und das ist auch die Ansicht meiner bischöflichen Brüder — sind bestimmte Änderungen längst überfällig. Wir sind ein geteiltes Land. Wir haben eine gewaltige Wirtschaftsblüte und eine zweifelhafte Zukunft. Die katholische Bevölkerung strebt von der Kirche weg, denn unsere Frauen müssen Nichtkatholiken heiraten, da die Zahl der Männer durch den Krieg verringert ist. In dieser Beziehung haben wir unzählige Probleme. Wir können sie nur auf menschlicher Basis lösen. Doch hier in Rom werden sie vielfach von Monsignori behandelt, die nicht einmal unsere Sprache beherrschen, die nur nach dem Kanon arbeiten und weder für unsere geschichtliche Entwicklung noch für unsere gegenwärtigen Probleme den rechten Sinn haben. Sie zögern, suchen Zeit zu gewinnen und zentralisieren; sie behandeln seelische Dinge wie Eintragungen in ein Hauptbuch. Unsere Last ist schon groß genug, wir können nicht auch noch Rom auf dem Rücken tragen — für mich und für meine Brüder: Appello ad Petrum … Ich flehe zu Petrus!«
Eine solche Unverblümtheit rief hörbare schwere Atemzüge hervor. Leone errötete vor Zorn, und Rinaldi verbarg ein Lächeln hinter einem seidenen Taschentuch.
Nach einem Augenblick sprach Papst Kyrill weiter. Sein Ton war sanft wie zuvor, doch diesmal fiel auf, daß er den Pluralis majestatis anwendete. »Wir versprechen unseren deutschen Brüdern, daß Wir Uns mit ihren besonderen Problemen sofort gründlich beschäftigen werden, und Wir werden Uns mit ihnen beraten, bevor sie in ihre Heimat zurückkehren. Wir müssen sie jedoch um Geduld und Nachsicht mit ihren Kollegen in Rom bitten. Sie sollten auch daran denken, daß manche Dinge oft eher aus Gewohnheit und Überlieferung als aus Mangel an gutem Willen ungetan bleiben.« Er schaltete eine Pause ein, um dem Tadel Nachdruck zu verleihen. Dann lächelte er.« Ich hatte meine eigenen Schwierigkeiten mit einer anderen Bürokratie. Sogar den Männern, die mich folterten, fehlte es nicht an gutem Willen. In einer Generation wollten sie eine neue Welt errichten, aber die Bürokratie war stets stärker als sie. Wir wollen versuchen, mehr Priester und weniger Beamte zu sein, weniger bürokratisch und schlichtere Seelen, die das Menschenherz verstehen.«
Jetzt kam der Franzose an die Reihe, der ebenso ungeschminkt sprach wie Pallenberg. »Was wir auch in Frankreich tun — was immer wir aus Frankreich vorschlagen, hier in Rom gerät es in den Schatten alter Geschichte. Unsere Pläne, vom Arbeiterpriester bis zum Studium der Entwicklung des Dogmas und der Schaffung einer intelligenten katholischen Presse, werden wie neue Auflehnungen aufgefaßt. In solchem Klima vermögen wir nicht, frei und kontinuierlich zu arbeiten. Wenn über allen unseren Plänen und Vorschlägen eine Wolke der Zensur hängt, können wir nicht das Gefühl haben, von der Bruderschaft der Kirche unterstützt zu werden.« Streitbar fuhr er fort: »Es gibt hier in Rom auch falsche Anschauungen, und dies ist eine davon: daß Einigkeit dasselbe sei wie Einförmigkeit, daß die römische Anschauung für alle von Hongkong bis Peru stets am besten sei. Eure Heiligkeit haben den Wunsch geäußert, Ihre Stimme in ihrem echten Tonfall hören zu lassen. Auch wir wünschen, daß unsere Stimme unverzerrt am Throne Petri gehört werden möge. Männer sollten ernannt werden, die uns und das Klima, in dem wir leben, in Wahrheit und mit Verständnis vertreten.«
»Sie berühren ein Problem«, antwortete Kyrill bedachtsam, »das auch Uns beschäftigt. Wir tragen die Last der Geschichte, so daß Wir Uns mit einer einfachen Sachlage nicht immer voraussetzungslos befassen können, sondern eine Vielfalt von geschichtlichen Verflechtungen und Gedankenverbindungen zu bedenken haben.« Er hob die Hand zum Bart und lächelte. »Sogar das hier ist, soviel ich weiß, für manche ein Stein des Anstoßes, obwohl unser Herr und die ersten Apostel einen Bart trugen. Ich möchte nicht annehmen, daß der Felsen Petri ins Wanken geraten könnte, weil jemand sich nicht rasiert. Quid vobis videtur?«
Sie lachten, und in diesem Augenblick liebten sie ihn. Die gegenseitige Verstimmung wich, und sie hörten friedlicher zu, während die Männer aus den südamerikanischen Staaten ihre Probleme nannten: Verarmte Bevölkerung, Mangel an geschultem Klerus, geschichtlich begründete Verbindung der Kirche mit den Reichen und den Ausbeutern, schließlich fehlende Geldmittel — so daß sich die Entrechteten um die marxistische Idee wie um eine Fackel scharten.
Danach berichteten die Männer aus dem Osten, wie dem christlichen Gedanken immer mehr Grenzen gezogen wurden. Nacheinander wurden die alten Missionsgründungen liquidiert, während die Vorstellung von einem irdischen Paradies in den Köpfen der Menschen spukte; sie ersehnten es sich um so verzweifelter, weil ihnen sowenig Zeit blieb, es zu genießen. Es war ein brutaler Kontoauszug für Männer, die ihre Rechnung mit dem Allmächtigen machen mußten. Danach lag Stille über der ganzen Versammlung, und alle warteten auf das Schlußwort des Papstes.
Er erhob sich und trat ihnen gegenüber — eine seltsam junge, seltsam einsame Gestalt, wie eine Christusfigur aus einem byzantinischen Triptychon.
»Es gibt Menschen«, sprach er feierlich, »die glauben, wir hätten das letzte Zeitalter der Welt erreicht, weil dem Menschen jetzt die Macht gegeben ist, sich vom Antlitz der Erde zu tilgen, und jeden Tag die Gefahr zunimmt, daß er es tun wird. Doch wir, meine Brüder, haben zur Erlösung der Welt nicht mehr und nicht weniger zu bieten als zu Anbeginn. Wir predigen von Christus und Seiner Kreuzigung — die Juden mögen es als Taktlosigkeit empfinden, die Heiden als Dummheit. Das ist die ›Torheit des Glaubens‹, und wenn wir nicht daran festhalten, dann sind wir einer Täuschung ausgeliefert. Was sollen wir also tun? Wohin gehen wir von diesem Punkt aus? Meines Erachtens gibt es nur einen einzigen Weg. Wir ergreifen die Wahrheit wie eine Lampe, und wir ziehen aus wie die ersten Apostel, um allen, die hören wollen, die gute Botschaft zu bringen. Wenn uns die Geschichte im Wege steht, beachten wir sie nicht. Wenn Systeme uns hindern, wenden wir sie nicht an. Wenn Würden uns belasten, werfen wir sie ab. Ich habe jetzt einen Auftrag für euch alle — für diejenigen, die Rom verlassen, und für diejenigen, die hierbleiben: Findet mir Menschen! Sucht gute Menschen, die begreifen, was es heißt, Gott und Seine Kinder zu lieben. Findet mir Menschen mit Feuer im Herzen und Flügeln an den Füßen. Schickt sie zu mir, und ich will sie aussenden, den Ungeliebten Liebe zu bringen und Hoffnung denen, die im Dunkel sind. Gehet nun im Namen Gottes!«
Gleich nach dem Konsistorium ersuchte Potocki, der Kardinal Polens, um eine dringende Privataudienz beim Papst. Zu seiner Überraschung wurde die Eingabe binnen einer Stunde mit einer Einladung zum Abendessen beantwortet. Als er in der päpstlichen Wohnung ankam, saß der neue Papst allein in einem Gemach im Sessel und las in einem kleinen verblaßten Lederband. Potocki kniete nieder, um seine Reverenz zu erweisen, aber Kyrill streckte die Hand aus und zog ihn mit einem Lächeln in die Höhe.
»Heute abend sollten wir brüderlich zusammen sein. Das Essen ist schlecht; ich hatte noch keine Zeit, die päpstliche Küche zu reformieren. Hoffentlich bekomme ich dank Ihrer Gesellschaft ein besseres Abendessen als sonst.« Er wies auf die vergilbten Seiten des Buches und lächelte. »Unser Freund Rinaldi hat Sinn für Humor. Anläßlich meiner Wahl machte er mir ein Geschenk. In diesem Buch ist die Regierungszeit des Holländers Hadrian des Sechsten beschrieben. Wissen Sie, wie die Kardinäle, die ihn wählten, genannt wurden? ›Verräter am Blute Christi, die den reinen Vatikan fremdländischer Raserei auslieferten und die Kirche und Italien in die Sklaverei der Barbaren führten.‹ Was wird man in diesem Augenblick über Sie und mich sagen?« Er klappte das Buch zu. »Es ist erst der Anfang, und doch fühle ich mich sehr allein. Wie kann ich Ihnen helfen, mein Freund?«
Potocki war angerührt vom Zauber seines neuen Herrn, aber die Gewohnheit der Vorsicht hatte Wurzeln geschlagen in ihm, und er begnügte sich mit Förmlichkeit. »Heute morgen wurde mir ein Brief gebracht. Er soll aus Moskau kommen. Ich wurde gebeten, ihn Eurer Heiligkeit persönlich zu übergeben.« Er holte einen großen, mit grauem Wachs versiegelten Umschlag hervor und reichte ihn Kyrill, der ihn einen Augenblick in der Hand behielt und dann auf den Tisch legte.
»Ich werde ihn später lesen, und wenn er Sie betrifft, werde ich Sie rufen. Nun sagen Sie mir …« Er lehnte sich vor, und sein Blick bat um Vertrauen. »Sie meldeten sich heute im Konsistorium nicht zum Wort, obwohl Sie ebenso viele Probleme wie die andern haben. Ich möchte sie hören.«
Potockis gefurchtes Gesicht wurde gespannt, und seine Augen bewölkten sich. »In erster Linie hege ich eine private Furcht.«
»Teilen Sie sie mir mit«, sagte Kyrill freundlich. »Ich habe so viele eigene Ängste, daß es mir vielleicht Erleichterung bringen wird.«
»Die Geschichte stellt uns allen Fallen, das wissen Eure Heiligkeit«, begann der Pole ernst. »Die Geschichte der Ruthenischen Kirche in Polen ist bitter. Wir haben nicht immer wie Brüder im Glauben gehandelt, sondern wie gegenseitige Feinde. Die Zeit der Zwietracht ist vorbei; aber wenn Eure Heiligkeit sich allzu schmerzlich daran erinnerten, könnte das für uns alle schlimm sein. Wir Polen haben das Temperament und die Loyalität der Südländer. Es gab eine Zeit, wo die polnische Kirche ihre Brüder verfolgte, die nach ruthenischem Ritus lebten. Damals waren wir beide noch jung, aber es ist möglich — und das wissen wir beide —, daß viele, die jetzt tot sind, noch am Leben wären, wenn wir die Einigkeit des Geistes im Glauben hochgehalten hätten.« Er zögerte, dann stolperte er verlegen durch die nächste Frage. »Ich meine es nicht unehrerbietig, aber ich muß Euerer Heiligkeit in treuer Ergebenheit eine Frage stellen, die andere mit Hintergedanken vorbringen werden. Wie sind Eure Heiligkeit zu uns Polen eingestellt? Wie betrachten Eure Heiligkeit unserer Bemühungen?«
Es entstand eine lange Pause. Papst Kyrill blickte auf seine knorrigen Hände. Unvermittelt erhob er sich und legte seinem Glaubensbruder die Hände auf die Schultern. Er sagte leise: »Wir waren beide im Gefängnis, Sie und ich. Wir wissen beide, daß wir keine Liebe empfanden, als man uns zerbrechen wollte, sondern daß wir tief im Innern Groll begruben. Als Sie in der Dunkelheit saßen und zitternd auf das nächste Verhör mit den grellen Lichtern warteten, was stellte Sie da am meisten auf die Probe?«
»Rom«, antwortete Potocki unumwunden, »wo man so viel wußte und sich so wenig zu kümmern schien.«
Papst Kyrill nickte. »Für mich war es die Erinnerung an den großen Andreas Szeptyckyj, den Metropoliten von Galizien. Ich liebte ihn wie einen Vater. Was man ihm angetan hatte, war mir bitterlich verhaßt. Ich sah ihn vor mir vor seinem Tode, einen Hünen von Gestalt, gelähmt, von Schmerz zerrissen, der zusehen mußte, wie alles zerstört wurde, was er aufgebaut hatte, die Bildungsstätten, die Seminare, die alte Kultur, um deren Erhaltung er sich so angestrengt bemüht hatte. Diese Fruchtlosigkeit bedrückte mich, und ich fragte mich, was für einen Sinn es hätte, nachdem so viele Menschenleben, so viele edle Geister vernichtet wurden, es nochmals zu versuchen. Das waren böse Tage und noch bösere Nächte.«
Potocki errötete bis zu den Wurzeln seiner schütteren Haare. »Ich schäme mich, Eure Heiligkeit. Ich hätte nicht zweifeln dürfen.«
Kyrill zuckte die Schultern und lächelte traurig. »Warum nicht? Wir sind alle Menschen. Sie tanzen auf einem Seil in Rußland, ich gehe auf einem anderen in Rom. Wir können beide ausrutschen, und wir werden ein Netz benötigen, das uns auffängt. Bitte glauben Sie mir, daß es mir nicht an Liebe fehlt, auch wenn es mir manchmal an Verständnis mangelt.«
»Was wir in Warschau tun, wird in Rom nicht immer verstanden«, bemerkte Potocki.
»Wenn Sie einen Dolmetscher brauchen«, fiel Kyrill rasch ein, »schicken Sie mir einen. Ich verspreche ihm ein stets williges Ohr.«
»Es werden so viele sein, und sie werden in so vielen Zungen sprechen. Wie können Eure Heiligkeit allen Gehör schenken?«
»Ich weiß.« Kyrills magerer Körper schien plötzlich wie unter einer Bürde zusammenzuschrumpfen. »Seltsam. Wir erklären und lehren, der Papst sei vor grundlegenden Irrtümern bewahrt, weil ihm der Heilige Geist innewohnt. Ich bete, aber ich höre keine Stimme auf dem Berg. Meine Augen sehen kein Licht auf den Hügeln. Ich stehe zwischen Gott und den Menschen, aber ich höre nur die Menschen und die Stimme meines Herzens.«
Zum erstenmal entspannte sich das Gesicht des Polen, und er breitete die Hände aus, in einer Geste der freudigen Niederlage. »Hören Sie darauf, Erleuchteter. Cor ad cor loquitur … Herz spricht zum Herzen. Und das mag wohl Gottes Zwiegespräch mit dem Menschen sein.«
»Gehen wir essen«, sagte Papst Kyrill, »und verzeihen Sie meinen Nonnen die schwerfällige Hand bei der Soße. Es sind wertvolle Geschöpfe, aber ich muß ihnen ein gutes Kochbuch suchen.«
Sie aßen nicht besser, als er vorausgesagt hatte, und sie tranken einen dünnen jungen Wein aus dem Albaner Gebirge; aber sie äußerten sich freier, und Wärme entstand zwischen ihnen, und als sie zu Obst und Käse kamen, sprach sich Papst Kyrill über eine andere Angelegenheit aus.
»In zwei Tagen soll ich gekrönt werden. Vielleicht ist es nicht wichtig, aber all diese vielen Zeremonien beunruhigen mich. Der Herr zog auf einem Esel in Jerusalem ein. Ich werde zwischen den Federfächern eines römischen Kaisers von Edlen auf Schultern getragen. In der ganzen Welt gibt es barfüßige Menschen mit leerem Magen. Ich soll mit Gold gekrönt werden, und tausend Lichter werden meinen Triumph erhellen. Ich schäme mich, daß der Nachfolger des Zimmermanns wie ein König behandelt wird. Das würde ich gern ändern.«
Mit kargem Lächeln schüttelte Potocki den Kopf. »Man wird es Eurer Heiligkeit nicht erlauben.«
»Ich weiß.« Kyrills Finger spielten mit den Krumen auf seinem Teller. »Ich gehöre auch den Römern, und sie müssen ihren Feiertag haben. Ich darf nicht zu Fuß durch das Schiff des Petersdoms gehen, weil ich dann nicht gesehen werden könnte, und wenn viele Teilnehmer auch nicht kommen, um zu beten, so kommen sie doch, um den Papst zu sehen. Ich bin laut Vertrag ein Fürst, wie man mich erinnert, und ein Fürst muß eine Krone tragen.«
»Tragen Sie sie, Heiligkeit«, sagte Potocki mit grimmigem Humor. »Tragen Sie sie diesen einen Tag, und seien Sie unbesorgt. Bald genug wird man Sie mit Dornen krönen!«
Achtzehn Kilometer entfernt, in seiner Villa im Albaner Gebirge, gab Valerio Kardinal Rinaldi ein Gastmahl. Die Gäste bildeten eine merkwürdige, aber mächtige Versammlung, und er leitete sie mit der Geschicklichkeit eines Mannes, der sich soeben als Königsmacher erwiesen hatte. Leone war da, auch Semmering, der General der Jesuiten, den das Volk den »schwarzen Papst« nannte. Zu den Teilnehmern gehörten Goldoni von der Staatssekretarie, Benedetti, Fürst der vatikanischen Finanzen, und Orlando Campeggio, der kluge dunkelhäutige Redakteur des Osservatore Romano. Am Fußende des Tisches saß, wie als Konzession gegenüber den Mystikern, der sanfte, friedliche und immer überraschende Syrer Rahamani.
Sie tafelten in einem Pavillon, der Ausblick auf einen klassischen Garten bot, wo einst ein orphischer Tempel gestanden hatte; dahinter sah man Ackerland und den fernen Schimmer von Rom. Die Luft war lind, der Nachthimmel bestirnt, und Rinaldis emsige Diener hatten eine behagliche Stimmung geschaffen.
Campeggio, der Laie, rauchte seine Zigarre und äußerte sich offen, ein Fürst unter Fürsten. »Mir scheint, in erster Linie müssen wir den Papst in günstigstem Licht zeigen. Ich habe viel darüber nachgedacht, und Sie alle haben wohl gelesen, was die Presse bereits gebracht hat. Bisher lautete das Thema: Im Gefängnis für den Glauben. Das Echo war erfreulich — eine Welle der Sympathie, Kundgebungen lebhafter Zuneigung und Treue. Natürlich ist das erst der Anfang, und alle unsere Probleme sind damit nicht gelöst. Als nächstes dachten wir daran, einen ›Papst des Volkes‹ vorzustellen. Dabei brauchen wir Unterstützung, besonders vom italienischen Standpunkt aus. Zum Glück spricht er gut italienisch, er kann sich also bei öffentlichen Anlässen und im Kontakt mit der Bevölkerung verständigen. Hier werden wir von der Kurie Rat und Hilfe brauchen.« Er war geschickt genug, an diesem Punkt abzubrechen und den eigentlichen Plan den Klerikern zu überlassen.
Leone, der mit einem Silbermesser einen Apfel schälte und in Scheiben schnitt, nahm das Stichwort auf; auf seine hartnäckige Weise machte er sich Sorgen. »Nichts ist ganz so einfach, wie es klingt. Wir müssen ihn präsentieren, ja, aber wir müssen ihn auch redigieren und kommentieren. Sie hörten, was heute im Konsistorium vorging.« Er wies mit der Messerklinge auf Rinaldi und Rahamani. »Wenn seine Worte ohne Erklärung gedruckt werden, lesen sie sich, als ob er eine zweitausendjährige Überlieferung zum Fenster hinauswerfen wollte. Ich begriff, was er meinte — wir begriffen es alle —, aber ich erkannte auch, wo wir ihn beschützen müssen.«
»Und das wäre?« Semmering, der schlanke blonde Jesuit, lehnte sich vor.
»Er selbst zeigte uns seine Achillesferse«, antwortete Leone fest. »Er bezeichnete sich als einen Menschen, der nicht in seiner eigenen Zeit steht. Er wird, glaube ich, immer wieder daran erinnert werden müssen, wie unsere Zeit ist und mit welchen Instrumenten wir zu arbeiten haben.«
»Glauben Sie, daß er sie nicht kennt?« fragte der Jesuit.
Leone runzelte die Stirn. »Ich bin nicht sicher. Ich habe noch nicht damit angefangen, seine Gedanken zu lesen. Ich weiß nur, daß er etwas Neues fordert, bevor er Zeit gehabt hat, zu untersuchen, was an der Kirche alt und dauerhaft ist.«
»Soweit ich mich entsinne«, warf der Syrer sanft ein, »bat er uns, ihm Menschen zu finden. Das ist nichts Neues. Das ist die Grundlage jeder apostolischen Arbeit. Wie drückte er sich aus? ›Menschen mit Feuer im Herzen und Flügeln an den Füßen.‹«
»Wir haben vierzigtausend«, bemerkte der Jesuit gelassen, »und alle sind durch feierliches Gelübde verpflichtet, ihm zu dienen. Wir alle stehen ihm zur Verfügung.«
»Nicht alle von uns«, erwiderte Rinaldi ohne Bosheit. »Und wir sollten ehrlich genug sein, es zu bekennen. Wir bewegen uns im Hauptsitz der Kirche auf vertrautem Boden, der ihm noch fremd ist, so daß er eine Weile ungeschickte Schritte machen muß. Wir nehmen das Beharrungsvermögen, den Ehrgeiz und die Bürokratie hin, weil wir damit erzogen worden sind und teilweise dazu beigetragen haben. Wissen Sie, was er gestern zu mir sagte?« Er machte eine Kunstpause wie ein Schauspieler, um zu warten, bis er im Mittelpunkt ihrer Aufmerksamkeit stand. »Er sagte: ›In siebzehn Jahren zelebrierte ich nur einmal die Messe. Ich lebte an einem Ort, wo hundert Millionen sterben werden, ohne einen Priester gesehen oder das Wort Gottes gehört zu haben; doch hier sehe ich Hunderte von Priestern, die Dokumente stempeln und wie gewöhnliche Büroangestellte Zeitkarten lochen …‹ Ich verstehe seinen Standpunkt.«
»Was erwartet er denn von uns?« fragte Benedetti scharf. »Daß wir den Vatikan mit IBM-Maschinen betreiben und sämtliche Priester im Missionsgebiet einsetzen? So naiv kann doch kein Mensch sein.«
»Für naiv halte ich ihn nicht«, entgegnete Leone. »Weit davon entfernt. Aber ich glaube, daß er zuwenig in Betracht zieht, was Rom für die Kirche bedeutet — für Ordnung und Disziplin und für die Verwaltung des Glaubens.«
Zum erstenmal beteiligte sich Goldoni, der untersetzte grauhaarige Staatssekretär, an dem Gespräch. Seine harte Römerstimme knackte wie Zweige in einem Feuer, als er seine Ansicht über den neuen Pontifex kundtat. »Er war mehrmals bei mir. Er ruft mich nicht zu sich, sondern kommt ruhig herein und stellt mir Fragen über meine Arbeit und meine Mitarbeiter. Ich habe den Eindruck, daß er von Politik sehr viel versteht, besonders von der marxistischen Politik, aber sich für Einzelheiten und Persönliches wenig interessiert. Ein Wort benutzt er oft: Druck. Er erkundigt sich, wo der Druck in jedem Lande anfängt, wie er sich auf das Volk und auf die Herrschenden auswirkt. Als ich ihn um eine Erklärung bat, sagte er, der Glaube sei dem Menschen von Gott eingepflanzt, hingegen müsse die Kirche auf den menschlichen und materiellen Hilfsmitteln eines jeden Landes aufgebaut werden, und um Bestand zu haben, müsse sie dem Druck wiederstehen können, dem die Volksmasse ausgesetzt sei. Er sagte noch etwas anderes: Wir hätten uns zu sehr zentralisiert, und wir hätten es versäumt, diejenigen auszubilden, die die Universalität der Kirche in der Autonomie nationaler Kultur erhalten können. Er sprach von einer Leere, die Rom geschaffen habe — bei den Klassen und in den Ländern, und auch bei örtlichen Geistlichen. Ich weiß nicht, wie erleuchtet seine eigene Politik sein mag, aber ganz gewiß ist er nicht blind gegen die vorhandenen Mängel.«
»Ein neuer Besen«, spottete Benedetti. »Er will alle Zimmer gleichzeitig ausfegen. Er kann auch einen Rechnungsabschluß lesen! Er wendet ein, daß wir unbeschränkt Kredit haben, während in Uruguay oder unter den Indern Armut herrscht. Ich frage mich, ob er überhaupt weiß, daß der Vatikan vor vierzig Jahren beinahe bankrott war und Gasparri zehntausend Pfund Sterling borgen mußte, um die Papstwahl zu finanzieren. Jetzt können wir wenigstens für alles selbst aufkommen und uns zum Besten der Kirche kräftig bewegen.«
»Als er seine Ansprache hielt«, meldete sich Rahamani wieder zu Wort, »erwähnte er Geld überhaupt nicht. Ich mußte daran denken, wie die ersten Apostel ohne einen Groschen ausgesandt wurden, ohne Schrift und Noten. Wie ich hörte, kam unser Kyrill genauso aus Sibirien nach Rom.«
»Möglich«, antwortete Benedetti gereizt. »Aber haben Sie sich jemals die Reisespesen von zwei Missionaren angesehen oder ausgerechnet, wieviel es kostet, einen Seminarlehrer auszubilden?«
Unvermittelt warf Leone die weiße Mähne zurück und lachte, daß sich die schlafenden Vögel in den Zypressen regten und der Widerhall durch das sternbeleuchtete Tal rollte. »Das ist es! Wir wählen ihn im Namen Gottes, und jetzt haben wir auf einmal Angst vor ihm. Er hat keine Drohung ausgestoßen, keine Ernennung geändert und nichts verlangt, was wir nicht freiwillig bieten würden. Doch da sitzen wir nun, schätzen ihn ab wie Verschwörer und bereiten uns darauf vor, ihm in den Weg zu treten. Was hat er uns denn getan?«
»Vielleicht hat er besser in uns gelesen, als uns lieb ist«, bemerkte der Jesuit Semmering.
»Vielleicht«, sagte Valerio Rinaldi, »vielleicht vertraut er uns mehr, als wir verdienen.«