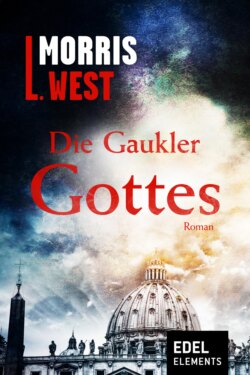Читать книгу Die Gaukler Gottes - Morris L. West - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
1
ОглавлениеSie sah wie eine Frau vom Lande aus – rundlich und rotwangig –, sie trug ein Kleid aus grobem Wollstoff, und ihre schütteren, grauen Haare lugten unter einem Strohhut hervor. Sie saß kerzengerade auf dem Stuhl und hielt die Hände über einer großen, altmodischen Handtasche aus braunem Leder gefaltet. Sie war argwöhnisch, aber nicht verängstigt, als prüfte sie das Warenangebot auf einem ihr unbekannten Markt.
Karl Mendelius, Professor für Kirchengeschichte am Wilhelmsstift, dem einstigen Collegium illustre der Universität Tübingen, streckte die Beine unter dem Schreibtisch aus, legte die Fingerspitzen aneinander und lächelte die Besucherin an. Er meinte in freundlichem Tonfall:
»Sie wollten mit mir sprechen, Madame?«
»Man hat mir gesagt, daß Sie Französisch verstehen.« Sie sprach im breiten Tonfall des Midi.
»Ja.«
»Ich heiße Thérèse Mathieu. Im Orden bin ich – war ich Schwester Mechtilda.«
»Wollen Sie damit sagen, daß Sie aus dem Konvent ausgetreten sind?«
»Ich wurde von meinem Gelübde entbunden. Aber er sagte, ich solle den Ring, den ich am Tage meines Gelöbnisses erhielt, weiter tragen, denn ich stehe noch immer im Dienste des Herrn.«
Sie hielt ihm eine große, abgearbeitete Hand entgegen und zeigte ihm den schlichten Silberring, den sie am Finger trug.
»Er? Wer ist er?«
»Seine Heiligkeit Papst Gregor. Ich gehörte zu den Schwestern, die in seinem Haushalt tätig waren. Ich habe sein Arbeitszimmer und seine Privatgemächer gereinigt. Ich habe ihm den Kaffee gebracht. Manchmal habe ich an Festtagen, wenn sich die anderen Schwestern ausruhten, eine richtige Mahlzeit für ihn zubereitet. Er sagte, er esse gern, was ich koche. Es erinnere ihn an sein Zuhause… Dann unterhielt er sich mit mir. Er kenne meinen Geburtsort sehr gut. Seine Familie habe dort Weinberge besessen… Als meine Nichte ihren Mann verlor, mit fünf kleinen Kindern zurückblieb und das Restaurant weiter betreiben mußte, erzählte ich ihm davon. Er war sehr mitfühlend. Er meinte, vielleicht brauche mich meine Nichte mehr als der Papst, der sowieso zu viele Bedienstete habe. Er half mir, in aller Freiheit zu begreifen, daß die Barmherzigkeit die wichtigste aller Tugenden sei… Den Entschluß, in die Welt zurückzukehren, faßte ich zu jener Zeit, als die Menschen im Vatikan begannen, alle diese schrecklichen Dinge zu sagen – daß der Heilige Vater geistig krank sei, daß er gefährlich werden könne – und all das. Als ich Rom verließ, ging ich zu ihm, um seinen Segen zu erbitten. Er bat mich um eine besondere Gefälligkeit, nämlich nach Tübingen zu gehen und seinen Brief in Ihre Hände zu übergeben. Er ermahnte mich, niemandem weiterzuerzählen, was er gesagt habe oder was ich zu überbringen hätte. Ja, und jetzt bin ich hier…«
Sie kramte in der Handtasche, brachte einen dicken Umschlag zum Vorschein und legte ihn auf den Schreibtisch. Karl Mendelius nahm ihn in die Hand und sah ihn prüfend an. Dann legte er ihn beiseite. Er fragte:
»Sind Sie von Rom direkt hierhergekommen?«
»Nein. Ich fuhr erst zu meiner Nichte und blieb eine Woche bei ihr. Seine Heiligkeit meinte, das sollte ich tun. Es sei natürlich und richtig. Er gab mir Geld für die Reise und ein Geschenk, das meiner Nichte helfen sollte.«
»Hat er Ihnen für mich noch eine weitere Nachricht mitgegeben?«
»Nur, daß er Sie herzlich grüßen läßt. Er hat mir gesagt, ich solle alle Ihre Fragen beantworten.«
»Er hat in Ihnen eine getreue Botin gefunden.« Karl Mendelius fügte ernst und in freundlichem Ton hinzu: »Möchten Sie eine Tasse Kaffee trinken?«
»Nein, vielen Dank.«
Sie faltete die Hände über ihrer Tasche und wartete: das vollkommene Bild einer Nonne trotz ihrer bäuerlichen Aufmachung. Mendelius stellte die nächste Frage mit Bedacht, aber sie klang wie beiläufig.
»Diese Probleme, dieses Gerede im Vatikan – wann fing das an? Was war die Ursache?«
»Ich weiß, wann alles anfing.« Sie gab ihre Antwort ohne Zögern. »Als er von seinem Besuch in Südamerika und den Vereinigten Staaten zurückkam, wirkte er müde und krank. Dann kamen die Besuche der Chinesen und der Russen und der Leute aus Afrika, was ihm große Sorgen zu machen schien. Als die Besucher abgereist waren, beschloß er, sich für zwei Wochen nach Monte Cassino zurückzuziehen. Nach seiner Rückkehr aus dem Kloster setzte die Unruhe ein…«
»Was für eine Unruhe?«
»Ich habe es nie ganz begriffen. Sie dürfen nicht vergessen, daß ich nur eine unbedeutende Nonne war und Hausarbeit verrichtet habe. Wir waren gehalten, über Dinge, die uns nichts angingen, keinerlei Bemerkungen zu machen. Die Frau Oberin konnte Tratsch nicht leiden. Aber mir fiel auf, daß der Heilige Vater krank aussah, viele Stunden in der Kapelle verbrachte und häufig Mitglieder der Kurie empfing, die dann mit zornigen Gesichtern wieder herauskamen und sich tuschelnd miteinander unterhielten. Ich kann mich an die Worte nicht erinnern – außer einmal, als ich Kardinal Arnaldo sagen hörte: ›Großer Gott im Himmel! Wir haben es mit einem Verrückten zu tun!‹«
»Und der Heilige Vater selbst – welchen Eindruck, wenn ich fragen darf, machte er auf Sie?«
»Mir gegenüber blieb er immer gleich – freundlich und gütig. Aber es war klar, daß er große Sorgen hatte. Einmal bat er mich, ihm Aspirin zu bringen, das er zu seinem Kaffee einnehmen wollte. Ich fragte, ob ich den Arzt rufen solle. Er lächelte mich seltsam an und sagte: ›Schwester Mechtilda, ich brauche keinen Arzt, sondern tausend Zungen. Manchmal scheint es mir, als ob ich die Tauben Musik und die Blinden das Malen lehren sollte‹… Natürlich kam schließlich doch der Arzt, und in den folgenden Tagen noch mehrmals. Danach suchte ihn Kardinal Drexel auf – er ist Dekan des Heiligen Kollegiums und ein sehr gestrenger Mann. Er brachte den ganzen Tag in den Gemächern des Heiligen Vaters zu. Ich half beim Hereintragen des Mittagessens. Und dann, ja… dann geschah es.«
»Haben Sie etwas von dem, was sich dann ereignete, verstanden?«
»Nein. Uns wurde gesagt, daß sich der Heilige Vater aus Gesundheitsgründen und zum Wohle der Seelen entschlossen habe, abzudanken und Gott für den Rest seines Lebens in einem Kloster zu dienen. Wir wurden aufgefordert, für ihn und für die Kirche zu beten.«
»Und er selbst – er hat Ihnen keine Erklärung für seinen Schritt gegeben?«
»Mir?« Sie sah ihn mit unschuldigem Erstaunen an. »Warum mir? Ich war ein Niemand. Aber als er mir den Segen für die Reise erteilte, legte er mir die Hände auf die Wangen und sagte: ›Vielleicht, kleine Schwester, ist es für uns beide ein Glück, daß wir uns gefunden haben.‹ Dann habe ich ihn nicht mehr gesehen.«
»Und was wollen Sie jetzt tun?«
»Ich will zu meiner Nichte fahren, ihr mit den Kindern helfen und im Restaurant kochen. Es ist zwar klein, aber das Geschäft geht gut, wenn wir alles zusammenhalten können.«
»Das wird Ihnen sicher gelingen«, sagte Karl Mendelius anerkennend. Er stand auf und streckte ihr die Hand entgegen. »Ich danke Ihnen, Schwester Mechtilda. Ich danke Ihnen, daß Sie zu mir gekommen sind – und für alles, was Sie für ihn getan haben.«
»Es war nicht viel. Er war ein guter Mensch. Er verstand, was das einfache Volk empfindet.«
Die Haut ihrer Handfläche war trocken und schuppig vom vielen Abwaschen und Schrubben. Er schämte sich seiner eigenen weichen Hände, in die Gregor XVII., Nachfolger des Apostelfürsten, seine letzte, seine geheimste Denkschrift gelegt hatte.
Er saß in jener Nacht noch lange in seinem geräumigen Arbeitszimmer, dessen bleigefaßte Fenster auf den grauen Bau der Stiftskirche St. Georg hinausgingen. Einzige Zeugen seiner Meditation waren die Marmorbüsten von Melanchthon und Hegel – der eine Dozent an dieser alten Universität, der andere Schüler am Tübinger Stift; aber sie waren lange tot, so daß ihnen jede Verlegenheit erspart blieb.
Der Brief von Jean Marie Barette, dem siebzehnten Gregor in der Reihe der Päpste, lag auseinandergefaltet vor ihm: dreißig mit der Hand gestochen sauber beschriebene Seiten, makellos in ihrem gallischen Stil, das Zeugnis einer persönlichen Tragödie und einer politischen Krise von globalem Ausmaß:
Mein lieber Karl,
in dieser, der langen dunklen Nacht meiner Seele, da die Vernunft ins Wanken gerät und der Glaube eines ganzen Lebens fast verloren zu sein scheint, wende ich mich um die Gnade des Verstehens an Dich.
Wir sind seit langer Zeit Freunde. Deine Bücher und Deine Briefe haben mich stets begleitet: ein Gepäck, das wesentlicher ist als meine Hemden und meine Schuhe. Dein Ratschlag hat mir in manch einem Augenblick der Furcht die Ruhe zurückgegeben. Deine Weisheit war ein Licht auf meinem Weg durch das dunkle Labyrinth der Macht. Obwohl unsere Lebenswege auseinandergegangen sind, glaube ich, daß unsere Herzen eine Einheit geblieben sind.
Wenn ich während dieser letzten Monate der Läuterung geschwiegen habe, so deshalb, weil ich Dich nicht belasten wollte. Seit einiger Zeit werde ich ständig beobachtet und kann die Vertraulichkeit selbst meiner persönlichsten Papiere nicht mehr gewährleisten. Ich muß Dir sogar sagen, daß Du, falls dieser Brief in die falschen Hände kommen sollte, in große Gefahr geraten kannst; und noch mehr: Wenn Du Dich entschließt, den Auftrag auszuführen, den ich Dir hiermit erteile, wird sich die Gefahr tagtäglich verdoppeln.
Ich beginne am Ende meiner Geschichte. Im letzten Monat beschlossen die Kardinäle des Heiligen Kollegiums mit großer Mehrheit – ich hatte einige von ihnen für meine Freunde gehalten –, daß ich, wenn nicht geistesgestört, so doch geistig nicht mehr in der Lage sei, den Aufgaben eines Papstes gerecht zu werden. Durch diesen Beschluß, dessen Hintergründe ich später im einzelnen erläutern werde, gerieten sie in ein sowohl komisches als auch tragisches Dilemma.
Es gab nur zwei Möglichkeiten, mich loszuwerden: Absetzung oder Abdankung. Um mich abzusetzen, mußten sie triftige Gründe anführen können, und das, glaubte ich, würden sie nicht wagen. Sie würden zu leicht in den Ruch der Verschwörung geraten, und das Risiko eines Schismas wäre zu groß. Eine Abdankung andererseits würde ein legaler Akt sein, den ich, falls ich geisteskrank wäre, nicht rechtskräftig würde ausführen können.
Meine persönliche Zwangslage war von anderer Art. Ich hatte nicht darum gebeten, gewählt zu werden. Ich hatte die Wahl mit schweren inneren Bedenken angenommen und auf den Heiligen Geist vertraut, daß er mir Erleuchtung und Kraft schenken möge. Ich glaubte – und ich versuche auch jetzt noch verzweifelt, mir diesen Glauben zu bewahren –, daß mir die Erleuchtung auf eine besondere Art zuteil werde und daß es meine Pflicht sei, eine Welt, die bereits in die Finsternis der letzten Stunde vor Mitternacht getaucht ist, an diesem Lichte teilhaben zu lassen. Ohne die Unterstützung meiner wichtigsten Mitarbeiter, dem Führungsgremium der Kirche, war ich jedoch machtlos. Meine Äußerungen konnten entstellt wiedergegeben, meine Weisungen mißachtet werden. Die Kinder Gottes konnten in Verwirrung gestürzt oder zur Rebellion verführt werden.
Dann kam Drexel, um mit mir zu sprechen. Er ist, wie Du weißt, Dekan des Heiligen Kollegiums, und ich selbst habe ihn zum Präfekten der Glaubenskongregation ernannt. Er ist ein gefürchteter Wachhund, was Dir aus gutem Grund nicht unbekannt sein dürfte. Im persönlichen Umgang ist er jedoch ein barmherziger und verständnisvoller Mann. Es kostete ihn einige Mühe, sich klar auszudrücken. Er sei Emissär der übrigen Kardinäle. Er teile ihre Auffassung nicht, sei aber beauftragt worden, mir ihren Beschluß zu übermitteln. Sie forderten mich auf, abzudanken und mich in ein Kloster zurückzuziehen.
Sollte ich mich weigern, würden sie, aller Risiken ungeachtet, Schritte unternehmen, um mich gerichtlich für unzurechnungsfähig erklären und unter ärztlicher Aufsieht in eine Anstalt einweisen zu lassen.
Ich war, wie Du Dir vorstellen kannst, tief schockiert. Ich hatte nicht geglaubt, daß sie so weit gehen würden. Dann ergriff mich zunächst ehrliches Entsetzen. Ich kannte genug von der Geschichte dieses Amtes und seiner Inhaber, um zu wissen, daß die Drohung ernst zu nehmen war. Die Vatikanstadt ist ein unabhängiger Staat, und was innerhalb ihrer Mauern geschieht, findet außerhalb keinen Richter.
Dann schwand das Entsetzen, und ich fragte Drexel in aller Ruhe, wie er die Situation einschätze. Er antwortete ohne Zögern. Er zweifele nicht, daß seine Kollegen imstande und entschlossen seien, ihre Drohung wahrzumachen. In einer so kritischen Zeit würde der Schaden zwar groß, aber nicht irreparabel sein. Die Kirche habe die Theophylakten und die Borgias und die Ausschweifungen von Avignon überlebt. Sie würde auch den Wahnsinn eines Jean Marie Barette überleben. Es sei Drexels persönliche, in Freundschaft vorgetragene Meinung, daß ich mich dem Unvermeidlichen fügen und aus Gesundheitsgründen abdanken sollte. Dann fügte er eine Bemerkung an, die ich für Dich wörtlich zitiere: »Tun Sie, was sie verlangen, Heiligkeit – aber keinen Deut mehr! Gehen Sie! Ziehen Sie sich in die Abgeschiedenheit zurück! Ich persönlich werde mich jedem Dokument widersetzen, mit dem man versuchen sollte, Ihnen weitere Verpflichtungen aufzuerlegen. Was jene Erleuchtung anbetrifft, die Ihnen Ihrer Ansicht nach zuteil geworden ist, so kann ich nicht beurteilen, ob sie von Gott stammt oder ob sie die Sinnestäuschung eines überarbeiteten Geistes ist. Wenn sie eine Sinnestäuschung ist, hoffe ich, daß Sie ihr nicht allzu lange anhängen werden. Wenn sie von Gott stammt, wird Er Sie nach Seinem Ratschluß befähigen, sie zu verkünden… Falls Sie aber für geistesgestört erklärt werden, gelten Sie als völlig unglaubwürdig, und das Licht wird für immer gelöscht sein. Die Geschichte, insbesondere die Kirchengeschichte, ist stets geschrieben worden, um die Überlebenden zu rechtfertigen…«
Ich verstand, was er mir sagte, aber ich konnte eine so einschneidende Lösung noch nicht akzeptieren. Wir besprachen uns den ganzen Tag und prüften jeden nur möglichen Ausweg. Ich betete allein bis tief in die Nacht. Schließlich gab ich völlig erschöpft auf. Am nächsten Morgen rief ich Drexel um neun Uhr zu mir und sagte ihm, ich sei bereit abzudanken. Soweit, mein lieber Karl, wie es geschah. Das Warum ist nicht so leicht zu erzählen; auch Du wirst dann gezwungen sein, über mich zu Gericht zu sitzen. Sogar jetzt, beim Schreiben dieser Zeilen, fürchte ich, daß Dein Spruch gegen mich ausfallen könnte. Soviel zur Schwachheit des Menschen! Ich habe noch nicht gelernt, auf den Herrn zu bauen, dessen Botschaft ich verkünde…
Der erschütternde Appell ergriff Mendelius zutiefst. Die Schrift verschwamm vor seinen schmerzenden Augen. Er lehnte sich im Sessel zurück und überließ sich seinen Erinnerungen. Sie waren einander vor über zwei Jahrzehnten in Rom begegnet, als Jean Marie Barette Kardinaldiakon und jüngstes Mitglied der Kurie war und Pater Karl Mendelius, SJ, seine ersten Vorlesungen über die Grundzüge der Bibelauslegung an der Gregorianischen Universität hielt. Der junge Kardinal hatte seinem Vortrag über die jüdischen Gemeinden der Frühkirche beigewohnt. Danach hatten sie zusammen zu Abend gegessen und sich bis tief in die Nacht miteinander unterhalten. Als sie sich trennten, gingen sie als Freunde auseinander.
In den schweren Tagen, als Mendelius wegen des Verdachts der Ketzerei bei der Glaubenskongregation angezeigt worden war, hatte ihn Jean Marie Barette während der monatelangen Inquisition unterstützt. Als ihn sein Priesterberuf nicht länger befriedigte, hatte er um die Versetzung in den Laienstand und um die Dispens gebeten, sich verheiraten zu dürfen. Barette hatte seine Sache vor einem unwilligen und leicht erregbaren Papst vertreten. Als er sich um den Lehrstuhl in Tübingen bewarb, trug das wärmste Empfehlungsschreiben die Unterschrift »Gregor XVII., Pont. Max.«
Jetzt waren ihre Rollen vertauscht. Jean Marie Barette befand sich im Exil, während Karl Mendelius die Freiheit einer glücklichen Ehe und eines erfüllten Berufslebens genoß. Was es auch kostete, er mußte seine Schuld als Freund abtragen. Er senkte den Blick und las weiter:
… Du kennst die Begleitumstände meiner Wahl. Mein Vorgänger, unser dem Populismus zuneigender Papst, hatte seine Mission erfüllt. Er hatte die Kirche wieder zentralisiert. Er hatte die Disziplin gestrafft. Er hatte die traditionelle dogmatische Linie wiederhergestellt. Seine starke persönliche Ausstrahlungskraft – die Ausstrahlungskraft eines großen Schauspielers – hatte lange seine im Grunde starre Einstellung verschleiert. Im Alter war er zunehmend intoleranter und Vernunftgründen gegenüber immer unzugänglicher geworden. Er sah sich als den Hammer Gottes, der die Macht der Gottlosen zerschlägt. Es war schwer, ihn zu überzeugen, daß nur durch ein Wunder letzten Endes nicht alle auf der Strecke bleiben würden: Gläubige und Ungläubige gleichermaßen. Wir standen in der letzten Dekade des Jahrhunderts, und bis zum globalen Krieg war es nur noch ein Schritt. Als ich – die Kompromißlösung nach einem sechs Tage dauernden Konklave – mein Amt antrat, stand ich vor einer beängstigenden Situation.
Ich brauche Dir nicht den ganzen apokalyptisch anmutenden Sachverhalt in Erinnerung zu rufen: das Elend der Dritten Welt, die bis an den Rand des Hungertodes gedrängt war, die Gefahr, daß es jeden Tag zu einem wirtschaftlichen Zusammenbruch des Westens kommen konnte, das ungezügelte Wettrüsten, die ins Ungemessene steigenden Energiekosten, die Versuchung für die Militaristen, alles auf eine Karte zu setzen, solange das Atompotential noch kalkulierbar blieb. Für mich war das am meisten beängstigende Phänomen die Atmosphäre schleichender Hoffnungslosigkeit, die sich unter den Führern dieser Welt breitmachte, das Gefühl der Machtlosigkeit, die seltsame atavistische Rückkehr zu einer magischen Weltbetrachtung.
Wir beide haben uns oft über die Verbreitung neuer Kulte und deren Manipulation durch Profit- und Machtstreben unterhalten. Der Fanatismus brach auch in den alten Religionen wieder durch. Einige Fanatiker in unseren eigenen Reihen wollten, ich solle ein Marianisches Jahr proklamieren und zu großangelegten Pilgerfahrten zu allen Schreinen der Heiligen Jungfrau auf der ganzen Welt aufrufen. Panikstimmung unter den Gläubigen aber war das letzte, was wir brauchen konnten.
Ich war überzeugt, daß die Kirche auf dem Boden der Vernunft und der Nächstenliebe eine Vermittlerrolle übernehmen müsse. Diese war außerdem der Auftrag, für dessen Erfüllung ich als Papst am besten geeignet war. Ich ließ die Welt wissen, daß ich im Interesse des Friedens bereit sei, überallhin zu reisen und jeden zu empfangen. Ich versuchte, den Menschen klarzumachen, daß ich keine Zauberformel kannte und keinerlei Machtgelüste hegte. Nur zu gut kannte ich die tödliche Trägheit der Institutionen und den mathematischen Irrsinn, der Menschen dazu bringt, über die einfachste Kompromißformel bis zum Tode zu kämpfen. Ich versuchte, die Führer der Nationen davon zu überzeugen, daß auch das Hinausschieben der endzeitlichen Katastrophe um ein einziges Jahr schon ein Sieg sei. Trotzdem verfolgte mich die Furcht vor einem nahenden Untergang Tag und Nacht und zehrte meine Kraftreserven auf.
Schließlich kam ich zu dem Schluß, daß ich, um wenigstens ein gewisses Gefühl für die Größenordnungen zu behalten, mich eine Weile ausruhen und meine geistigen Kräfte erneuern müsse.
Deshalb zog ich mich vierzehn Tage in das Kloster Monte Cassino zurück. Du kennst das Kloster gut. Es wurde im sechsten Jahrhundert vom heiligen Benedikt gegründet. Papst Paul I. schrieb dort seine historischen Werke, mein Namensvetter Gregor IX. schloß dort Frieden mit dem Stauferkaiser Friedrich II. Vor allem aber herrscht an diesem Ort eine Atmosphäre der Abgeschiedenheit und Heiterkeit. Abt Andreas ist ein Mann von einzigartiger Klugheit und Frömmigkeit. Ich wollte mich seiner geistigen Leitung unterstellen und mich für kurze Zeit dem Schweigen, der Meditation und der inneren Erneuerung widmen.
So war mein Vorsatz, mein lieber Karl. Und so fing es auch an. Ich war drei Tage dort, als das Ereignis stattfand…
Der Satz endete am unteren Rand der Seite. Mendelius zögerte, bevor er umblätterte. Er empfand ein gewisses Unbehagen, als wäre er Zeuge einer körperlichen Intimität geworden. Er mußte sich zum Weiterlesen zwingen.
… Ich nenne es ein Ereignis, denn ich möchte Deine Beurteilung nicht von vornherein beeinflussen, und auch deshalb, weil der Vorgang für mich absolut greifbare Dimensionen besaß. Es ereignete sich. Ich habe es mir nicht eingebildet. Das Erlebnis war so real wie das Frühstück, das ich kurz zuvor im Refektorium zu mir genommen hatte.
Es war neun Uhr vormittags, ein klarer, sonniger Tag. Ich saß im Klostergarten auf einer Steinbank. Einige Meter entfernt jätete ein Mönch ein Blumenbeet. Ich fühlte mich friedvoll und entspannt. Ich begann, das vierzehnte Kapitel des Johannesevangeliums zu lesen, das mir der Abt zur Meditation für diesen Tag empfohlen hatte. Du weißt, wie es beginnt – mit der Ansprache Christi beim Heiligen Abendmahl: »Euer Herz erschrecke nicht! Glaubet an Gott, und glaubet an mich…« Der Text, voller Tröstung und aufrichtender Wirkung, entsprach meiner Stimmung. Als ich zu der Stelle kam »Wer mich aber liebt, der wird von meinem Vater geliebt werden…«, klappte ich das Buch zu und blickte auf.
Alles um mich herum hatte sich verändert. Da war kein Kloster mehr, kein Garten, kein arbeitender Mönch. Ich war allein auf einem hohen, öden Berggipfel. Um mich herum ragten zerklüftete Berge hoch, die sich schwarz von einem gespenstisch gefärbten Himmel abhoben. Der Ort war still und ruhig wie ein Grab. Ich empfand keine Furcht, nur eine schreckliche, trübe Leere, als wäre der Kern meines Wesens entfernt worden und nur die leibliche Hülle übriggeblieben. Ich wußte, was ich sah: die Folgen der letzten Torheit des Menschen – einen toten Planeten. Für das, was dann geschah, kann ich die passenden Worte nicht finden. Es war, als hätten mich plötzlich glühende Flammen erfaßt, in einen wilden Wirbelsturm hineingerissen und aus jeglicher menschlichen Dimension in das Zentrum eines gewaltigen, unerträglichen Lichtes geschleudert. Das Licht war eine Stimme, und die Stimme war ein Licht, und es war, als würde ich von seiner Botschaft getränkt. Ich war am Ende aller Dinge, am Anfang aller Dinge; am Endpunkt der Zeit und am Beginn der Ewigkeit. Es gab keine Symbole mehr, nur noch die einzige, schlichte Realität. Die Prophezeiung hatte sich erfüllt. Ordnung war aus dem Chaos entstanden, die letzte Wahrheit offenbar geworden. In einem Augenblick tiefster Qual begriff ich, daß ich dieses Ereignis verkünden und die Welt darauf vorbereiten müsse. Ich war berufen anzukündigen, daß die letzten Tage nahe seien und daß sich die Menschheit auf die Parusie, die Wiederkunft Jesu Christi, vorbereiten müsse. Und als mich diese Qual ins Nichts versenken zu wollen schien, war sie vorüber. Ich saß wieder im Klostergarten. Der Mönch jätete das Rosenbeet. Das Neue Testament lag auf meinem Schoß, aufgeschlagen beim vierundzwanzigsten Kapitel Matthäus: »Denn gleichwie der Blitz ausgeht vom Aufgang und scheint bis zum Niedergang, also wird auch sein die Zukunft des Menschensohnes.«
Zufall oder Omen? Es schien nun nicht mehr darauf anzukommen.
Und da hast Du es, Karl, so gut ich es mit Worten auszudrücken vermag – Dir, dem besten Freunde meines Herzens. Als ich es meinen Kollegen in Rom zu erklären versuchte, konnte ich das Entsetzen auf ihren Gesichtern sehen: ein Papst mit einer persönlichen Offenbarung, ein Vorläufer der Wiederkunft? Irrsinn! Die endgültige verheerende Unvernunft! Ich war eine wandelnde Zeitbombe, die so rasch wie möglich entschärft werden mußte. Und dennoch konnte ich mein Erlebnis ebensowenig verhehlen, wie ich die Farbe meiner Augen ändern konnte. Die Erscheinung war mir in jede Faser meines Wesens eingeprägt, so wie das genetische Erbteil meiner Eltern. Ich war gezwungen, davon zu reden, ich war verurteilt, es einer Welt, die achtlos ihrer Vernichtung entgegenstürzt, zu verkünden.
Ich begann mit der Arbeit an einer Enzyklika, einer Botschaft an die Universalkirche. Sie begann mit den Worten: »His in ultimis annis fatalibus… In diesen letzten Schicksalsjahren des Jahrtausends…« Mein Sekretär entdeckte den Entwurf auf meinem Schreibtisch, fotokopierte ihn heimlich und verteilte Abzüge unter die Angehörigen der Kurie. Sie waren entsetzt. Einzeln und gemeinsam drangen sie in mich, das Dokument nicht zu veröffentlichen. Als ich mich weigerte, versetzten sie meine Gemächer praktisch in einen Belagerungszustand und unterbanden alle meine Verbindungen mit der Außenwelt.
Dann beriefen sie eine außerordentliche Sitzung des Heiligen Kollegiums ein, zogen ein aus Ärzten und Psychiatern bestehendes Gutachterteam bei, das über meinen Geisteszustand berichten sollte, und setzten auf diese Weise den Lauf der Ereignisse in Gang, der zu meiner Abdankung führte. Jetzt wende ich mich in meiner Not an Dich – nicht nur deshalb, weil Du mein Freund bist, sondern weil auch Du der Inquisition ausgesetzt warst und verstehst, wie die Vernunft unter dem gnadenlosen Druck pausenloser Fragen ins Wanken gerät. Wenn Du der Überzeugung bist, daß ich geisteskrank bin, dann entbinde ich Dich im voraus von jedem Vorwurf und danke Dir für die Freundschaft, die wir so lange haben teilen können.
Falls Du mir auf halbem Wege entgegenkommen kannst und glaubst, daß ich Dir die schlichte, schreckliche Wahrheit erzählt habe, dann studiere die beiden diesem Brief beigefügten Dokumente: eine Kopie meiner unveröffentlichten, an die Universalkirche gerichteten Enzyklika und eine Liste jener Personen in verschiedenen Ländern, mit denen ich während meines Pontifikats freundschaftliche Beziehungen unterhalten habe und die noch immer bereit sein werden, mir oder einem von mir Entsandten Vertrauen entgegenzubringen. Versuche, Verbindung mit ihnen aufzunehmen und ihnen klarzumachen, was sie in diesen letzten, schicksalsschweren Jahren tun können. Ich glaube nicht, daß wir die Sintflut aufhalten können, aber es ist mir aufgetragen, bis zum Ende mit der Verkündigung der Frohen Botschaft der Liebe und Erlösung fortzufahren.
Wenn Du Dich hierzu bereit erklärst, wirst Du Dich in große Gefahr begeben – vielleicht sogar in Lebensgefahr. Gedenke des Evangeliums Matthäus: »Dann werden sie dich ausliefern und dem Tode überantworten… und viele werden erschreckt sein und einander betrügen und hassen.«
Ich werde diesen Ort bald verlassen und mich in die Einsamkeit von Monte Cassino zurückziehen. Ich glaube, ich werde dort wohlbehalten eintreffen. Wenn nicht, empfehle ich mich wie Dich und Deine Familie der Liebe Gottes.
Es ist schon spät. Die Gnade des Schlafs ist mir lange vorenthalten worden, aber jetzt, da dieser Brief geschrieben ist, wird sie mir vielleicht gewährt.
Ich bin wie immer in Christo
der Deinige
Jean Marie Barette
Hinter der Unterschrift war ein kurzer ironischer Zusatz angefügt: »Feu le pape… ehemals der Papst.«
Karl Mendelius war vom Schock und der Übermüdung wie gelähmt. Er konnte sich nicht dazu aufraffen, die engbeschriebenen Seiten der Enzyklika zu lesen. Die lange Liste mit Personen- und Ländernamen hätte ebensogut in Sanskrit abgefaßt sein können. Er faltete den Brief und die Anlagen zusammen und verschloß sie dann in dem alten, schwarzen Safe, in dem er die Papiere für sein Haus, seine Versicherungspolicen und die wesentlichsten Teile seines Forschungsmaterials aufbewahrte. Lotte würde unten auf ihn warten und friedlich mit ihrer Strickarbeit vor dem Kamin sitzen. Er konnte ihr nicht gegenübertreten, solange er sich nicht gefaßt und eine Antwort auf ihre unvermeidlichen Fragen bereit hatte: »Was stand in dem Brief, Karl? Was ist mit unserem lieben Jean Marie tatsächlich geschehen?«
Ja, was denn? Was Karl Mendelius auch sonst noch sein mochte – gescheiterter Priester, liebender Gatte, verwirrter Vater, Skeptiker in Glaubensfragen –, er war ein ausgebildeter Historiker, der sich bei der Anwendung primärer und sekundärer Quellen streng an die Regeln hielt. Er konnte eine nachträglich vorgenommene Einschiebung im Text schon auf den ersten Blick spüren und diese mit peinlicher Genauigkeit auf ihren Ursprung zurückverfolgen – mochte sie auf die Gnostiker, Manichäer oder Essener zurückgehen.
Er wußte, daß die Lehre von der Parusie – der Wiederkunft des Erlösers, die das Ende aller zeitlichen Dinge bedeuten würde – zu den ältesten und gesichertsten Lehrsätzen der Überlieferung gehörte. Sie war verzeichnet in den Evangelien, in das Glaubensbekenntnis eingebettet und wurde jeden Tag in der Liturgie erwähnt: »Christus ist gestorben, Christus ist auferstanden, Christus wird wiederkehren.« Dieser Satz bildete die tiefste Hoffnung der Gläubigen auf die letzte Rechtfertigung des göttlichen Planes, den endgültigen Sieg der Ordnung über das Chaos, des Guten über das Böse. Daß Jean Marie Barette, der ehemalige Papst, daran glauben und diese These als Glaubensartikel predigen würde, war ebenso natürlich und notwendig wie das Atmen.
Aber daß er sich der naheliegendsten, primitivsten Form des Glaubens – einer unmittelbar bevorstehenden Weltkatastrophe, gefolgt vom Jüngsten Gericht, auf das sich die Auserwählten vorbereiten müssen – verpflichtet fühlte, war, gelinde ausgedrückt, beunruhigend. Die jahrtausendealte Überlieferung nahm mancherlei Formen an, und nicht alle waren religiöser Natur. Sie kam in Hitlers Vorstellung von einem tausendjährigen Reich ebenso zum Ausdruck wie in der marxistischen Idee, daß der Kapitalismus absterben und einer universalen Bruderschaft des Sozialismus Platz machen werde. Jean Marie Barette hätte keiner Vision bedurft, um seiner Auslegung des tausendjährigen Reiches Christi Ausdruck zu verleihen. Er hätte sie fertig formuliert aus hundert Quellen, vom Buch Daniel bis zu den Kamisarden-Propheten des siebzehnten und achtzehnten Jahrhunderts, ablesen können.
Auch seine angebliche Vision war ein bekanntes und beunruhigendes Element in diesem Zusammenhang. Das Haupt einer Religionsgemeinschaft war berufen und verpflichtet, eine seit langer Zeit festgefügte Lehre kraft seines Amtes zu verkünden. Wenn es diesen Auftrag überschritt, konnte es von derselben Autorität, die es in sein Amt berief, zum Schweigen gebracht oder exkommuniziert werden.
Bei einem Propheten war das völlig anders. Er nahm für sich in Anspruch, eine direkte Verbindung mit dem Allmächtigen zu besitzen. Deshalb konnte ihm sein Amt auch nicht durch einen Mittler in Menschengestalt entzogen werden. Er war in der Lage, auch die geheiligtste Tradition mit dem klassischen Satz, den auch Jesus selbst gebrauchte, in Frage zu stellen: »Es steht geschrieben so und so… aber ich sage euch so und so.« Infolgedessen blieb der Prophet immer der Fremdling, der Herold des Wandels, der Herausforderer bestehender, traditioneller Ordnungen.
Das Problem der Kardinäle war nicht die Geistesgestörtheit eines Jean Marie Barette, sondern die Tatsache, daß er die Funktion des Hohenpriesters und obersten Lehrers akzeptiert, dann aber eine weitere, möglicherweise der ersten zuwiderlaufende Rolle übernommen hatte.
Theoretisch brauchte hierin natürlich kein Widerspruch zu liegen. Die Lehre von der persönlichen Offenbarung, von der direkten Verbindung zwischen Schöpfer und Geschöpf, war so alt wie die von der Parusie. Die Ausgießung des Heiligen Geistes über die Apostel zu Pfingsten, Saul, der auf dem Weg nach Damaskus bekehrt wird, Johannes, der auf Patmos eine apokalyptische Erleuchtung hat – alle diese Ereignisse galten seit alters als geheiligt. War es so undenkbar, daß in dieser letzten, verhängnisvollen Dekade des ausgehenden Jahrtausends, da die Möglichkeit planetarischer Vernichtung eine bewiesene Tatsache und nicht zu leugnende Gefahr war, Gott einen neuen Propheten erwählt hatte, um Seinen Ruf nach Buße und Erlösung zu erneuern?
Im theologischen Sinne handelte es sich zum mindesten um einen durchaus vertretbaren Gedankengang. Für Karl Mendelius, den Historiker, der über die geistige Zurechnungsfähigkeit eines Freundes urteilen sollte, hatten diese Gedanken einen gefährlich spekulativen Charakter. Er war jedoch im Augenblick so abgespannt und müde, daß er seiner Einschätzung selbst der einfachsten Fragen nicht mehr trauen konnte; deshalb schloß er die Tür zu seinem Arbeitszimmer ab und ging hinunter.
Lotte, blond, rundlich, liebevoll und vollkommen zufrieden mit ihrer Rolle als Mutter zweier Kinder und ihrer Stellung als Frau Professor Mendelius, lächelte zu ihm hinauf und hob in Erwartung seines Kusses den Kopf. In einem plötzlichen Anfall von Leidenschaftlichkeit zog er sie an sich und hielt sie lange an sich gedrückt. Sie sah ihn fragend an und meinte:
»Warum das?«
»Ich liebe dich.«
»Ich liebe dich auch.«
»Laß uns ins Bett gehen.«
»Ich kann noch nicht. Johann hat angerufen – er hat seinen Schlüssel vergessen. Ich habe ihm gesagt, ich werde so lange aufbleiben. Möchtest du einen Cognac?«
»Hm, das ist immerhin das Nächstbeste.«
Als sie ihm einschenkte, stellte sie genau jene Frage, die er befürchtet hatte. Er wußte, daß er bei ihr keine Ausflüchte gebrauchen konnte. Sie war für Halbwahrheiten zu intelligent, deshalb sagte er ihr rundheraus: »Die Kardinäle haben ihn zur Abdankung gezwungen, weil sie ihn für verrückt halten.«
»Verrückt? Großer Gott! Ich würde sagen, niemand ist klarer bei Verstand.«
Sie reichte ihm das Glas und setzte sich neben ihm auf den Teppich, den Kopf auf seinen Knien. Sie tranken sich zu. Mendelius strich ihr über Stirn und Haare. Sie fragte wieder:
»Warum glauben sie, daß er geisteskrank ist?«
»Weil er – wie auch in seinem Brief – behauptet hat, die persönliche Offenbarung erfahren zu haben, daß das Ende der Welt nahe und er der Vorläufer der Wiederkunft Christi sei!«
»Was?« Sie verschluckte sich mit dem Cognac. Mendelius reichte ihr sein Taschentuch, damit sie sich die Bluse abwischen konnte.
»So ist es, Liebes. Er schildert das Erlebnis in seinem Brief. Er glaubt felsenfest daran. Jetzt, wo er mundtot gemacht worden ist, bittet er mich um Hilfe, diese Botschaft zu verbreiten.«
»Ich kann es immer noch nicht glauben. Er war immer so – so französisch und praktisch veranlagt. Vielleicht ist er tatsächlich übergeschnappt.«
»Ein Verrückter hätte den Brief, den er mir geschrieben hat, nicht schreiben können. Eine fixe Idee, eine phantastische Vorstellung – das würde ich noch gelten lassen. So etwas kann passieren, als Folge von Streßsituationen oder auch als Folge mangelnden Umgangs mit der Logik. Geistig gesunde Menschen haben früher einmal geglaubt, die Welt sei eine flache Scheibe. Ganz normale Menschen richten ihr Leben nach dem Horoskop, das sie in der Abendzeitung lesen… Millionen wie du und ich glauben an einen Gott, dessen Existenz sie nicht beweisen können.«
»Aber wir laufen nicht herum und behaupten, morgen gehe die Welt unter.«
»Nein, Liebling, das tun wir nicht, aber wir wissen auch, daß es so kommen kann, falls die Sowjets und die Amerikaner auf den roten Knopf drücken. Wir alle leben im Schatten dieser realen Möglichkeit. Unsere Kinder sind sich dessen ebenso bewußt wie wir.«
»Bitte, Karl, laß das!«
»Verzeihung.«
Er beugte sich hinab und küßte ihre Haare; dann drückte sie seine Hand gegen ihre Wange. Nach einigen Augenblicken fragte sie leise:
»Und wirst du tun, worum Jean Marie dich bittet?«
»Ich weiß es nicht, Lotte. Wirklich, ich weiß es nicht. Ich muß darüber nachdenken. Ich werde mit Menschen sprechen müssen, die ihm nahegestanden haben. Danach will ich ihn persönlich aufsuchen… Das bin ich ihm schuldig. Wir beide sind es ihm schuldig.«
»Das heißt, du wirst verreisen müssen.«
»Nur für kurze Zeit.«
»Ich hasse es, wenn du fort bist. Ich vermisse dich so sehr.«
»Dann komm doch mit! Es ist eine Ewigkeit her, seit du in Rom gewesen bist. Du wirst dort viele Menschen wiedersehen.«
»Ich kann nicht, Karl. Das weißt du doch. Die Kinder brauchen mich. Dies ist ein wichtiges Jahr für Johann, und ich möchte Kathrin und ihren Freund im Auge behalten.«
Es war immer derselbe kleine Zwist zwischen ihnen: Lotte gluckte ständig über ihren erwachsenen Kindern, und er war deswegen eifersüchtig. Aber heute abend war er zu müde, um sich zu wehren, deshalb vertagte er die Entscheidung.
»Wir werden ein anderes Mal darüber sprechen, Liebling. Ich brauche den Rat eines Spezialisten, bevor ich von Tübingen abreise.«
Mit dreiundfünfzig war Anneliese Meißner im Besitz diverser akademischer Auszeichnungen – die bemerkenswerteste davon dürfte die gewesen sein, daß man sie einstimmig zur häßlichsten Frau aller Fakultäten der Universität gewählt hatte. Sie war untersetzt, dick und blaß; sie hatte einen Froschmund und Augen, die hinter dicken Brillengläsern kaum zu sehen waren. Ihre Haare wirkten wie das Haupt einer Medusa, und ihre Stimme klang rauh und blechern. Sie war wie ein Mannweib und ständig unordentlich gekleidet. Wenn man zu all dem noch eine scharfe Zunge und die Verachtung für jegliche Mittelmäßigkeit hinzufügte, hatte man, wie es ein Kollege einmal ausdrückte, »das vollkommene Profil einer Persönlichkeit vor sich, die sich der Welt entfremdet hat«.
Aber wie durch ein Wunder war sie diesem Schicksal entronnen und hatte sich im Schatten des Schlosses Hohentübingen zu einer Art von Schutzpatronin entwickelt. Ihr Quartier an der Burgsteige war eher ein Klub als eine Wohnung, wo sich Studenten und Dozenten auf Hockern und Kisten niederließen, um Wein zu trinken und bis in die frühen Morgenstunden miteinander zu debattieren. Ihre Vorlesungen über klinische Psychologie waren überfüllt, und ihre Arbeiten wurden in Fachzeitschriften in mehreren Sprachen veröffentlicht. In Studentenkreisen dichtete man ihr sogar einen Geliebten an, ein wie ein Troll aussehendes Wesen, das im Harz lebte und sie an Sonntagen und den größeren Festtagen des Universitätsjahrs heimlich besuchte.
Am Tag, nachdem er Jean Maries Brief bekommen hatte, lud Karl Mendelius sie zum Mittagessen in die Weinstube »Forelle« ein. Anneliese Meißner aß und trank reichlich, führte aber trotzdem noch bissige Monologe über die Verwendung der Universitätsmittel, über die Politik des Landes Baden-Württemberg, über die Abhandlung eines Kollegen zum Thema »Endogene Depressionen«, die sie als »kindisches Gewäsch« abtat, und über das Geschlechtsleben der türkischen Gastarbeiter in der einheimischen Papierindustrie. Sie waren bereits beim Kaffee, als es Mendelius für angebracht hielt, seine Frage zu stellen.
»Wenn ich Ihnen einen Brief zeige – wären Sie in der Lage, ein klinisches Urteil über den Schreiber abzugeben?«
Sie fixierte ihn mit kurzsichtigen Augen und lächelte. Das Lächeln war furchterregend. Es war, als wolle sie ihn mitsamt den Resten ihres Apfelstrudels verschlingen.
»Werden Sie mir den Brief zeigen, Karl?«
»Falls Sie ihn als vertrauliche Mitteilung unter Berufskollegen ansehen.«
»Von Ihnen, Karl, ja. Aber bevor Sie ihn mir zeigen, möchte ich noch auf ein paar Grundsätze meiner Disziplin hinweisen. Ich möchte nicht, daß Sie mir ein Dokument zugänglich machen, das Ihnen offenbar wichtig ist, und sich nachher beschweren, mein Kommentar sei unzureichend. Einverstanden?«
»Einverstanden.«
»Zunächst also: Handschriftenproben bilden, wenn sie in ausreichender Menge vorliegen, einen recht zuverlässigen Hinweis auf geistige Zustände. Sogar einfache Hypoxie – die unzureichende Sauerstoffversorgung des Gehirns – wird rasch zu einer Entstellung des Schriftbildes führen. Zweitens: Auch bei schwersten psychotischen Zuständen kann der Patient lichte Momente haben, in denen seine Schrift und seine Äußerungen völlig normal wirken. Hölderlin ist in dieser unserer Stadt als hoffnungslos schizophren gestorben. Aber würden Sie das vermuten, wenn Sie ›Brot und Wein‹ oder die ›Empedokles‹-Fragmente lesen? Nietzsche starb, geistig umnachtet, an Paralyse, die wahrscheinlich auf eine syphilitische Infektion zurückging. Könnten Sie das lediglich auf der Grundlage von ›Also sprach Zarathustra‹ diagnostizieren? Dritter Punkt: Jeder persönliche Brief enthält Hinweise auf emotionale Zustände oder sogar psychische Neigungen; aber dies sind nur Indikatoren. Die Zustände können nur schwach ausgeprägt sein und die Neigungen noch durchaus in den Grenzen der Normalität liegen. Habe ich mich klar ausgedrückt?«
»Bewunderungswürdig klar, Frau Professor!« Karl Mendelius gab mit einer komisch anmutenden Handbewegung zu erkennen, daß er sich ihr ausliefere. »Ich lege meinen Brief in sichere Hände.« Er reichte ihn ihr über den Tisch hinweg. »Es sind auch noch andere Papiere da, aber ich habe noch keine Zeit gehabt, sie durchzusehen. Verfasser ist Papst Gregor XVII., der letzte Woche abdankte.«
Anneliese Meißner warf ihre wulstigen Lippen auf und ließ einen Pfiff der Überraschung hören, sagte aber nichts. Sie las den Brief langsam, ohne Kommentar, während Mendelius seinen Kaffee trank und Petits fours dazu kaute – zwar schlecht für die schlanke Linie, aber besser als das Zigarettenrauchen, das er sich unbedingt abgewöhnen wollte. Schließlich beendete Anneliese die Lektüre. Sie legte den Brief vor sich auf den Tisch und bedeckte ihn mit ihren großen, dicken Händen. Sie wählte die ersten Worte mit klinischer Sorgfalt.
»Ich bin mir nicht sicher, Karl, daß ich die richtige Person für eine Stellungnahme zu diesem Brief bin. Ich bin kein gläubiger Christ, bin es nie gewesen. Was einen auch befähigen mag, den Sprung vom Verstand zum Glauben zu machen, ich habe diese Fähigkeit nie besessen. Ich bin eine unverbesserliche Atheistin. Ich habe es oft bedauert. In der Praxis habe ich es oft als Nachteil empfunden, wenn ich mit Patienten zu tun hatte, die starke religiöse Bindungen besaßen. Sie sehen also, Karl«, sagte sie und gab ein langgezogenes, meckerndes Kichern von sich, »von meinem Standpunkt aus leben Sie und Ihresgleichen in einem fixen Wahnzustand, der als Geisteskrankheit definiert werden könnte. Da ich aber andererseits Ihre Wahnvorstellungen nicht widerlegen kann, muß ich einräumen, vielleicht selbst die Kranke zu sein.«
Mendelius lächelte und schob ihr das letzte der Petits fours in den Mund.
»Wir sind uns einig, daß Ihre Schlußfolgerungen gewissen Einschränkungen unterliegen werden. Ihr guter Ruf ist bei mir in sicheren Händen.«
»Also – der Befund, wie ich ihn sehe.« Sie hob den Brief hoch und begann ihre Stellungnahme. »Handschrift: Kein Hinweis auf geistige Störungen. Es ist eine schöne, regelmäßige Schrift. Der Text ist präzise und logisch formuliert. Die erzählenden Abschnitte sind von klassischer Schlichtheit. Der Schreiber hat seine Emotionen unter Kontrolle. Auch wenn er sagt, er stehe unter Bewachung, gibt es keine Überbetonung, die einen paranoiden Zustand andeuten könnte. Der Teil, der das visionäre Erlebnis behandelt, ist – in seinen Grenzen – klar. Es gibt keine pathologischen Vorstellungen mit entweder gewalttätiger oder sexueller Beimischung… Prima facie war also der Mann, der diesen Brief geschrieben hat, geistig gesund, als er ihn schrieb.«
»Aber er deutet Zweifel an seiner Zurechnungsfähigkeit an.«
»Das tut er eigentlich nicht. Er meint, daß vielleicht anderen solche Zweifel kommen könnten. Er ist von der Realität seines visionären Erlebnisses völlig überzeugt.«
»Und was halten Sie von diesem Erlebnis?«
»Ich bin überzeugt, daß er es gehabt hat. Wie ich es deuten würde, ist eine andere Frage. In der gleichen Weise bin ich überzeugt, daß Martin Luther glaubte, den Teufel in seiner Zelle gesehen zu haben, als er das Tintenfaß nach ihm schleuderte. Das soll heißen, daß ich nicht an den Teufel glaube, sondern lediglich daran, daß Luther von der Realität seines Erlebnisses überzeugt war.« Sie lachte wieder und fuhr in gelösterem Ton fort: »Sie sind ein alter Jesuit, Karl. Sie wissen, wovon ich spreche. Ich habe ständig mit Patienten zu tun, die unter Wahnvorstellungen leiden. Ich muß davon ausgehen, daß sie selbst diese Vorstellungen für echt halten.«
»Sie sagen also, daß Jean Marie bestimmten Wahnvorstellungen unterliegt?«
»Legen Sie mir diese Worte nicht in den Mund, Karl!« Ihr Tadel kam schnell und scharf. Sie schob ihm den Brief mit einer energischen Handbewegung wieder zu. »Sehen Sie sich noch einmal die Stelle an, wo er die Erscheinung schildert, und die Absätze davor und danach. Das Ganze paßt genau in einen Wachtraum. Er liest und meditiert in einem sonnigen Garten. Bei jeder Meditation kommt es bis zu einem gewissen Grade zur Autohypnose. Er träumt in zwei Teilen: Er sieht die Folgen der Weltkatastrophe auf einer leeren Erde und erlebt dann den wilden Wirbel, wenn er in das Weltall geschleudert wird. Beide Bilder sind deutlich, aber im Grunde banal. Man hätte sie ebensogut aus irgendeinem Science-fiction-Film nehmen können. Er hat sie vorher oft durchdacht. Jetzt erscheinen sie ihm in einem Wachtraum. Wenn er erwacht, befindet er sich wieder im Garten. Es ist ein Phänomen, das häufig vorkommt.«
»Aber er glaubt, es handle sich um eine übernatürliche Intervention.«
»Er behauptet, daß er es glaubt.«
»Was wollen Sie damit sagen?«
»Ich will damit sagen«, meinte Anneliese Meißner ungerührt, »daß er auch lügen könnte.«
»Nein! Ausgeschlossen! Ich kenne diesen Mann. Wir stehen uns so nahe wie Brüder.«
»Eine unglückliche Analogie«, sagte Anneliese Meißner nachsichtig. »Familiäre Beziehungen können teuflisch kompliziert sein. Beruhigen Sie sich, Karl! Sie wollten eine fachliche Meinung hören, und die gebe ich Ihnen. Nehmen Sie sich wenigstens die Zeit, eine Hypothese zu prüfen, die etwas für sich hat.«
»Aber diese ist reine Phantasie!«
»Ist sie es wirklich? Sie sind Historiker. Denken Sie einmal zurück. Wie viele Wunder können Sie nennen, die sehr gelegen gekommen sind? Wie viele gerade rechtzeitig eingetroffene Erscheinungen? Jede Sekte auf der Welt muß sie ihren Anhängern bieten. Die Mormonen haben Joseph Smith und seine wundersamen goldenen Tafeln; der Geistliche Sun Myung Moon erklärte sich zum Herren der Zweiten Wiederkunft, und sogar Jesus soll sich verneigt haben, um ihn zu verehren. Nehmen Sie deshalb einmal an, daß Ihr Gregor XVII. zu dem Schluß kam, daß die Institution des Papsttums in eine Krise geraten und die Zeit reif sei für irgendeine neue Offenbarung Gottes.«
»Dann ist er ein gewaltiges Risiko eingegangen.«
»Und hat verloren. Könnte es nicht so sein, daß er jetzt versucht, aus dem Trümmerhaufen noch etwas zu retten, und sich dabei Ihrer Mithilfe vergewissern will?«
»Das ist ein ungeheuerlicher Gedanke.«
»Für mich nicht. Warum regen Sie sich so auf? Ich werde es Ihnen sagen. Weil Sie, obwohl Sie sich für einen liberal eingestellten Denker halten, immer noch Mitglied der römisch-katholischen Familie sind. Aus eigenem Interesse müssen Sie den Mythos schützen. Ich habe bemerkt, daß Sie nicht zusammenzuckten, als ich die Mormonen und die Anhänger Moons erwähnte. Ach, kommen Sie, mein Freund! Wo ist Ihr Verstand geblieben?«
»Ich habe ihn anscheinend verlegt«, antwortete Mendelius grimmig.
»Wenn ich Ihnen etwas raten darf – lassen Sie die ganze Affäre auf sich beruhen.«
»Warum?«
»Sie sind ein Gelehrter von internationalem Ansehen. Sie werden sich doch nicht mit Verrückten oder Magiern auf eine Stufe stellen wollen.«
»Jean Marie ist mein Freund. Ich schulde ihm wenigstens eine ehrliche Untersuchung.«
»Dann brauchen Sie einen Beisitzer, der Ihnen bei der Abwägung des Beweismaterials hilft.«
»Würden Sie diesen Job übernehmen, Anneliese? Er könnte Ihnen zu neuen wissenschaftlichen Erkenntnissen verhelfen.«
Er meinte es als Scherz, um ihre Diskussion zu entschärfen. Der Scherz kam aber nicht an. Anneliese dachte lange über den Vorschlag nach und verkündete dann entschlossen:
»Gut. Ich mache mit. Es wird eine ganz neue Erfahrung für mich sein, den Inquisitor eines Papstes zu spielen. Aber, lieber Kollege«, fuhr sie fort und legte ihm die Hand auf den Arm, »ich bin mehr daran interessiert, Ihre Glaubwürdigkeit zu bewahren.«
Als seine letzte Vorlesung vorüber war, wanderte Karl Mendelius spät am Nachmittag das Flußufer entlang, setzte sich auf eine Bank und sah den Schwänen zu, die auf dem grauen Wasser würdevoll an ihm vorbeiglitten.
Nach dem Gespräch mit Anneliese Meißner fühlte er sich tief beunruhigt. Sie hatte nicht nur sein Verhältnis zu Jean Marie Barette, sondern auch seine Integrität als Gelehrter und seine moralische Festigkeit als Wahrheitssucher in Frage gestellt. Sie hatte geschickt den schwächsten Punkt seiner geistigen Rüstung aufs Korn genommen: seine Neigung, über seine eigene Religionsgemeinschaft nachsichtiger als über andere zu urteilen. Trotz seiner skeptischen Veranlagung war er immer noch ein Gottesmann, der seiner jesuitischen Vergangenheit verhaftet blieb. Er würde eher seine historischen Forschungsergebnisse mit der Glaubenstradition in Einklang bringen, als sich mit den Widersprüchlichkeiten zwischen den beiden zu befassen. Er zog die Tröstung des häuslichen Herdes der Vereinsamung des Erneuerers vor. Bis jetzt hatte er sich selbst nicht verraten. Er konnte immer noch mit Selbstachtung in den Spiegel schauen. Aber die Gefahr war da – wie eine schwache, prickelnde Begierde, die bereit war, im richtigen Augenblick bei der richtigen Frau Feuer zu fangen.
Im Falle von Jean Marie Barette konnte die Gefahr des Selbstbetrugs tödlich sein. Das Problem war klar, und er konnte es nicht beschönigen. Es gab drei Möglichkeiten, die sich gegenseitig ausschlossen: Jean Marie war geistesgestört. Jean Marie war ein Lügner. Jean Marie war ein Mann, der vom Finger Gottes berührt und beauftragt war, eine entscheidende Offenbarung zu verkünden.
Er hatte die Wahl: Entweder ließ er sich auf nichts ein – was das Recht jedes aufrichtigen Menschen war, der sich für eine solche Aufgabe ungeeignet fühlte –, oder er unterzog den ganzen Fall einer strengen Prüfung und handelte dann vorurteilslos aufgrund des Untersuchungsergebnisses. Bei Anneliese Meißner, seiner brüsken und kompromißlosen Beisitzerin, konnte er kaum anders handeln.
Aber wie stand es mit Jean Marie Barette, seinem langjährigen Freund? Wie würde er reagieren, wenn man ihn mit der harten Wirklichkeit konfrontierte? Was würde er empfinden, wenn sich der Freund, den er sich als Anwalt seiner Sache ausgesucht hatte, als Großinquisitor entpuppte? Wieder schrak Karl Mendelius vor dieser Gegenüberstellung zurück.
Aus dem Viertel, in dem das Klinikum lag, drang das Sirenengeheul eines Rettungswagens herüber – ein langgezogener, sich wiederholender Klagelaut, der in der hereinbrechenden Dunkelheit unheimlich klang. Mendelius überkamen Kindheitserinnerungen: der Ton der Sirenen bei Fliegeralarm und danach das Gedröhn von Flugzeugen und die Detonation von Bomben, die auf Dresden niederprasselten.
Als er nach Hause kam, fand er die Familie vor dem Fernsehschirm versammelt. Der neue Papst war in einer Nachmittagssitzung des Konklaves gewählt worden und wurde jetzt gerade als Leo XIV. proklamiert. Über dem Ereignis lag keinerlei Zauber. Die Kommentare blieben ohne Begeisterung. Sogar die versammelte Menschenmenge in Rom machte einen gleichgültigen Eindruck, und die traditionelle Akklamation hatte einen hohlen Klang.
Ihr Papst war neunundsechzig Jahre alt, ein kräftiger Mann mit Adlernase, kalten Augen, einem rauhen aemilischen Akzent und einer fünfundzwanzigjährigen Kurienerfahrung. Seine Wahl war das Ergebnis sorgfältig geplanter, aber nur allzu offenkundiger Staatsraison.
Nach zwei ausländischen Amtsinhabern brauchte man einen Italiener, der die päpstlichen Spielregeln verstand. Nach einem Schauspieler, der zum Eiferer, und einem Diplomaten, der zum Mystiker geworden war, stellte Roberto Arnaldo, der Bürokrat mit Eiswasser in den Adern, die gefahrloseste Wahl dar. Er würde keine leidenschaftlichen Kontroversen entfachen und keine Visionen verkünden. Er würde nur die allernotwendigsten Erklärungen abgeben, und diese würden mit solcher Sorgfalt in italienische Rhetorik eingekleidet sein, daß Liberale und Konservative sie mit gleicher Genugtuung zur Kenntnis nehmen würden. Und was das Wichtigste war: Er litt an Gicht und zu hohem Cholesteringehalt des Blutes, so daß nach der Versicherungsstatistik seine Amtszeit weder zu kurz noch zu lang zu dauern versprach.
Die Papstwahl bildete den Hauptgesprächsstoff beim Abendessen. Mendelius war froh über die Ablenkung, denn Johann war wegen eines Essays, der ihm Schwierigkeiten bereitete, schlecht gelaunt, Kathrin gab sich schnippisch und Lotte litt wieder einmal unter Depressionen, die mit den Wechseljahren zusammenhingen. Es war einer jener Abende, wo er sich mit bitterem Humor fragte, ob der Zölibat nicht doch viel für sich habe und eine Junggesellenexistenz ohne Zölibat noch mehr. Er besaß jedoch genügend Erfahrung in Ehedingen, um solche Gedanken für sich zu behalten.
Als die Mahlzeit vorüber war, zog er sich in sein Arbeitszimmer zurück und rief Hermann Frank, den Direktor der Deutschen Akademie Villa Massimo in Rom, an.
»Hermann? Hier spricht Karl Mendelius. Ich rufe an, weil ich dich um einen Gefallen bitten möchte. Ich komme Ende des Monats für acht bis zehn Tage nach Rom. Könntest du mich unterbringen?«
»Großartig!« Frank war ein gutaussehender Mann mit silbergrauen Haaren – ein Kunsthistoriker, Spezialgebiet: die italienische Malerei des sechzehnten Jahrhunderts, und er war einer der besten Gastgeber Roms. »Wird Lotte mitkommen? Wir haben viel Platz.«
»Möglich. Es steht noch nicht fest.«
»Bring sie mit! Hilde wäre begeistert. Sie könnte ein Gespräch von Frau zu Frau brauchen.«
»Vielen Dank, Hermann. Sehr nett von dir.«
»Ach was. Du könntest mir auch einen Gefallen tun.«
»Und zwar?«
»Während du hier bist, wird die Akademie eine Gruppe evangelischer Pfarrer empfangen. Das übliche: tagsüber Vorträge, abends Diskussionen, nachmittags Busfahrten. Es wäre eine Auszeichnung für mich, wenn ich bekanntgeben könnte, daß der berühmte Mendelius ein paar Vorträge halten und vielleicht auch eine Gruppendiskussion leiten würde…«
»Mit Vergnügen, mein Freund.«
»Großartig! Großartig! Laß mich wissen, wann du ankommst, dann hole ich dich am Flugplatz ab…«
Mendelius legte den Hörer auf und brummte zufrieden. Hermann Franks Aufforderung, Vorträge zu halten, war ein glücklicher Zufall. Die Deutsche Akademie gehört zu den ältesten und angesehensten ausländischen Akademien in Rom. Im Jahr 1910 unter Kaiser Wilhelm II. gegründet, hatte sie zwei Weltkriege und das Dritte Reich überlebt; es war ihr gelungen, sich den Ruf solider deutscher Gelehrsamkeit zu erhalten. Die Akademie bot Mendelius deshalb eine gute Ausgangsbasis und ein vorzügliches Alibi für seine heiklen Ermittlungen.
Die deutsche Kolonie im Vatikan würde hocherfreut auf eine Essenseinladung von Hermann Frank reagieren. Sein Gästebuch war ein dicker Wälzer, in dem es von hochtrabenden Titulaturen wie »Seine Magnifizenz, der Rektor des Päpstlichen Bibelinstituts« und »Großkanzler des Instituts für Biblische Archäologie« nur so wimmelte. Wie Lotte auf den Vorschlag reagieren würde, war eine andere Frage. Er mußte einen günstigeren Augenblick abwarten, um ihr diese kleine Überraschung mitzuteilen.
Als nächstes mußte er eine Liste von Kontaktpersonen vorbereiten, denen er schreiben und seinen Besuch ankündigen wollte. Er hatte lange in Rom gewohnt und eine Vielzahl von Freundschaften und Bekanntschaften geschlossen: von dem verknöcherten, alten Kardinal, der seinen Austritt aus dem Orden zwar mißbilligte, aber großzügig genug war, seine wissenschaftlichen Leistungen anzuerkennen, bis zum Kustos der Inkunabelnsammlung in der Vatikanischen Bibliothek und der letzten Grande Dame der Pierleoni, die den Gesellschaftsklatsch Roms von ihrem Rollstuhl aus dirigierte. Er war noch dabei, sich alle diese Namen ins Gedächtnis zurückzurufen, als Lotte hereinkam; sie trug ein Tablett mit Kaffee. Sie machte einen etwas verlorenen Eindruck und schien sich nicht sicher zu sein, ob ihr Besuch willkommen war.
»Die Kinder sind ausgegangen. Unten ist es so einsam. Hast du etwas dagegen, wenn ich mich hier oben etwas zu dir setze?« Er nahm sie in den Arm und küßte sie.
»Auch hier oben ist es so einsam, Liebling. Setz dich hin und mach es dir bequem. Ich gieße den Kaffee ein.«
»Was machst du gerade?«
»Ich bereite unsere Ferien vor.«
Er erzählte ihr von seinem Gespräch mit Hermann Frank. Er schilderte ihr begeistert die sommerlichen Vergnügungen in Rom, die Gelegenheit, alte Freunde wiederzusehen und ein paar Ausflüge zu machen. Sie nahm alles mit erstaunlicher Ruhe auf. Dann sagte sie:
»In Wirklichkeit geht es um Jean Marie, nicht wahr?«
»Ja, aber es geht auch um uns. Ich möchte dich bei mir haben, Lotte. Ich brauche dich. Wenn die Kinder mitkommen wollen, werde ich dafür sorgen, daß sie in einer Pension unterkommen.«
»Sie haben andere Pläne, Karl. Wir haben darüber gesprochen, bevor du nach Hause kamst. Kathrin will mit ihrem Freund nach Paris fahren. Johann wird per Anhalter durch Österreich gondeln. Alles gut und schön – nur Kathrin…«
»Kathrin ist jetzt eine Frau, Liebling. Sie wird tun, was sie will – ob es uns paßt oder nicht. Schließlich…« – er beugte sich nieder und küßte sie – »sind sie uns nur geliehen; und wenn sie uns verlassen, sind wir wieder da, wo wir begonnen haben. Wir sollten uns wieder daran gewöhnen, ein Liebespaar zu sein.«
»So ist es wohl.« Sie zuckte die Achseln, als gebe sie sich geschlagen. »Aber, Karl…« Sie brach ab, als fürchte sie sich, den Gedanken in Worte zu kleiden. Mendelius versuchte, ihr auf die Sprünge zu helfen.
»Aber was, Liebling?«
»Ich weiß, daß die Kinder uns verlassen werden. Ich gewöhne mich allmählich an den Gedanken – wirklich. Aber was ist, wenn Jean Marie dich mir wegnimmt? Diese – diese Sache, die er von dir will, ist sehr merkwürdig und irgendwie schreckt sie mich.« Unvermittelt brach sie in Schluchzen aus. »Ich habe Angst, Karl… schreckliche Angst.«