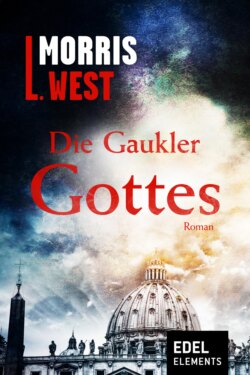Читать книгу Die Gaukler Gottes - Morris L. West - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
2
ОглавлениеIn diesen letzten Schicksalsjahren des Jahrtausends… So begann die unveröffentlichte Enzyklika Jean Marie Barettes. In dieser dunklen Zeit der Verwirrung, der Gewalt und des Terrors bin ich, Gregor, Euer Bruder im Fleische, Euer Diener in Jesu Christo, vom Heiligen Geist beauftragt worden, Euch zur Warnung und Euch zum Troste diese Worte niederzuschreiben…
Mendelius traute seinen Augen nicht. Päpstliche Enzykliken waren, trotz ihrer in die Zukunft weisenden Bedeutung, gewöhnlich Dokumente wie andere auch – sie gaben die traditionelle Einstellung zu Glaubens – und Moralfragen wieder. Jeder gute Theologe konnte den Gedankengang formulieren. Jeder gute Lateiner konnte den Text sprachlich lebendig machen.
Der Aufbau erinnerte an die Methode der alten Rhetoriker. Das Thema wurde dargelegt. Die Heilige Schrift und die Kirchenväter zog man zur Unterstützung heran. Weisungen ergingen, die für das Gewissen der Gläubigen bindend waren. Zum Schluß wurden alle zum Glauben, zur Hoffnung und zur immerwährenden Nächstenliebe ermahnt. Das stets verwendete »wir« sollte nicht nur der Würde des Papstes gerecht werden; es wies auch auf die Gemeinschaft und die Kontinuität des Amtes und der Lehre hin. Der Sinn war klar: Der Papst lehrte nichts Neues; er erläuterte eine uralte und unwandelbare Wahrheit und wandte sie lediglich auf die Bedürfnisse seiner Zeit an.
Mit einem Federstrich hatte Jean Marie Barette mit dieser Tradition gebrochen. Er hatte auf die Rolle des Exegeten verzichtet und sich den Mantel des Propheten umgehängt. Ich, Gregor, bin vom Heiligen Geist beauftragt worden… Sogar in dem förmlichen Latein war die Wucht dieser Worte zu spüren. Kein Wunder, daß die Männer der Kurie erbleichten, als sie das lasen. Was folgte, fiel noch weit mehr aus dem Rahmen:
… Die Tröstung, die ich Euch biete, ist das ewige Gelöbnis unseres Herrn Jesus Christus: »Ich will Euch nicht als Waisen zurücklassen. Sehet, ich bin bei Euch alle Tage, bis an das Ende der Welt.« Die Warnung, die ich Euch gebe, ist, daß das Ende nahe ist, daß diese Generation nicht vorübergehen wird, bevor alle diese Dinge erfüllt sind… Ich sage Euch dieses nicht aus eigenem Antrieb oder weil es die Aussage menschlicher Vernunft wäre, sondern weil ich es erfahren habe in einer Vision, die ich nicht zu verbergen wage und die der ganzen Welt kundzutun ich beauftragt bin. Aber auch diese Offenbarung war nichts Neues. Sie war einfach eine Bestätigung dessen, was uns in der Heiligen Schrift offenbart wird…
Dann folgte die Auslegung längerer Textstellen der Synoptiker und eine Reihe eindrucksvoller Analogien zwischen den biblischen »Zeichen« und den in der letzten Dekade des zwanzigsten Jahrhunderts herrschenden Verhältnissen: Kriege und Kriegsgefahr, Hungersnöte und Epidemien, falsche Christusgestalten und falsche Propheten.
Für Karl Mendelius, der tief innerlich und kraft seines Berufs in der apokalyptischen Literatur von der frühesten Zeit bis in die Gegenwart bewandert war, stellte die Enzyklika ein beunruhigendes und gefährliches Dokument dar. Von einer so hochgestellten Persönlichkeit kommend, mußte sie alarmierend wirken und eine Panik auslösen. Unter den Militanten konnte sie leicht als Aufruf zum letzten Kreuzzug der Auserwählten gegen die Ungläubigen dienen. Die Schwachen und Furchtsamen konnte sie sogar zum Selbstmord verleiten, bevor die Schrecken der letzten Tage über sie hereinbrachen.
Er fragte sich, was er wohl an Stelle des Sekretärs getan hätte, wenn er des Textes auf dem Schreibtisch des Papstes gewahr geworden wäre. Ohne Zweifel hätte er versucht, die Veröffentlichung zu verhindern. Und genau dies hatten die Kardinäle getan: Sie hatten das Dokument unterdrückt und den Verfasser zum Schweigen gebracht.
Dann kam ihm ein neuer Gedanke: War dies nicht das Schicksal aller Propheten, der Preis, den sie für eine schreckliche Gabe zu zahlen hatten, das blutige Siegel der Wahrheit auf ihrer Weissagung? Aus dem Wogen biblischer Beredsamkeit hallte ein weiteres Zitat in seinen Gedanken wider: die letzte Klage Christi über die Heilige Stadt.
»Jerusalem, Jerusalem, die du tötest die Propheten und steinigst, die zu dir gesandt sind! Wie oft habe ich deine Kinder versammeln wollen, wie eine Henne versammelt ihre Küchlein unter ihre Flügel; und ihr habt nicht gewollt!… Deshalb wird der Tag kommen, da deine Feinde einen Graben um dich legen und dich dem Erdboden gleichmachen werden, und deine Kinder, die bei dir sind. Und sie werden in dir keinen Stein auf dem anderen lassen, denn du hast nicht erkannt, was deinem Frieden dient!«
Es war eine unheimliche Vorstellung zu dieser mitternächtlichen Stunde, in der das Mondlicht durch die verbleiten Scheiben hereinfiel und der kalte Wind durch das Neckartal und die Gassen der Altstadt strich, wo Hölderlin in geistiger Umnachtung gestorben war und Melanchthon, geistig gesund wie kaum ein zweiter, gelehrt hatte: »Gott zieht nur die Willigen zu sich.« Nach seiner persönlichen Erfahrung war Jean Marie Barette der willigste und zugänglichste Mensch, der als letzter der Illusion eines Fanatikers zum Opfer fallen würde.
Gewiß, er hatte ein höchst unkluges Schriftstück verfaßt. Aber vielleicht kam es gerade darauf an: daß in der Stunde äußerster Not nur eine solche Torheit die Aufmerksamkeit der Welt erregen konnte.
Aber wozu? Wenn die endgültige Katastrophe bevorstand und ihr Zeitpunkt unwiderruflich in den Ablauf der Schöpfung eingegeben war, warum dann überhaupt diese Proklamation? Welcher Ratschlag hätte Bestand vor der Ungeheuerlichkeit dieser Erkenntnis? Was für ein Gebet war stark genug, gegen einen Erlaß aus der Ewigkeit zu bestehen? In Jean Maries Antwort auf diese Fragen lag ein gewaltiges Pathos:
… Meine lieben Brüder und Schwestern, meine kleinen Kinder, wir alle fürchten den Tod, wir schrecken vor dem Leiden zurück, das ihm vorangehen mag. Wir verzagen vor dem Geheimnis des letzten Sprunges, den wir alle machen müssen, des Sprunges in die Ewigkeit. Aber wir sind Gefolgsleute des Herrn, des Gottessohnes, der in Menschengestalt gelitten hat und gestorben ist. Wir sind die Erben der Frohen Botschaft, die er uns hinterlassen hat: daß der Tod das Tor zum Leben ist, daß er einen Sprung nicht in die Finsternis, sondern in die Hand ewiger Gnade bedeutet. Er ist ein Akt des Vertrauens, ein Akt der Liebe, durch den wir uns, wie es Liebende tun, selbst aufgeben und eins werden mit dem Geliebten…
Mendelius wurde durch ein Klopfen an der Tür aus seinen Gedanken aufgeschreckt. Seine Tochter Kathrin trat zögernd und schüchtern ein. Sie trug ihren Morgenmantel und hatte die blonden Haare mit einem rosa Bändchen hinten zusammengebunden; ihr Gesicht war abgeschminkt, und die geröteten Augen ließen erkennen, daß sie geweint hatte. Sie fragte:
»Kann ich mit dir sprechen, Papa?«
»Natürlich, mein Herz.« Er war sofort besorgt. »Was ist denn los? Du hast geweint.« Er gab ihr einen Kuß und geleitete sie zu einem Sessel. »So, und jetzt erzähl mir, was dich bedrückt.«
»Diese Reise nach Paris. Mutter ist böse deswegen, sie sagt, ich soll es mit dir besprechen. Sie versteht es nicht, Papa – sie versteht es wirklich nicht. Ich bin neunzehn. Ich bin jetzt eine Frau, genauso wie sie, und…«
»Jetzt mal langsam, Kleines! Fangen wir noch einmal von vorn an. Du willst über den Sommer nach Paris gehen. Wer fährt mit dir?«
»Franz, natürlich. Du weißt doch, daß wir seit Ewigkeiten beisammen sind. Du hast gesagt, daß er dir sehr gut gefällt.«
»Allerdings. Er ist ein sehr netter junger Mann. Und außerdem ein vielversprechender Maler. Liebst du ihn?«
»Ja, das tue ich.« In der Antwort lag ein Anflug von Trotz. »Und er liebt mich!«
»Dann kann ich euch beiden nur gratulieren!« Er lächelte und tätschelte ihre Hand. »Es ist das beste Gefühl auf der Welt. Und was kommt jetzt? Habt ihr vom Heiraten gesprochen? Wollt ihr euch verloben? Ist es das?«
»Nein, Papa.« Sie schien sehr fest in ihrer Ansicht zu sein. »Jedenfalls noch nicht… Und das ist es ja gerade: Mama will es einfach nicht verstehen.«
»Hast du versucht, es ihr zu erklären?«
»Immer wieder! Aber sie will mir einfach nicht zuhören.«
»Dann versuche es mal mit mir«, sagte Mendelius liebevoll.
»Es ist nicht einfach. Ich kann nicht so gut mit Worten umgehen wie du. Die Sache ist die: Ich habe Angst; wir beide haben Angst.«
»Wovor?«
»Vor dem Immer... das ist es. Zu heiraten und Kinder zu kriegen und ein Heim zu gründen, während uns die ganze Welt jeden Tag über dem Kopf einstürzen kann.« Plötzlich schien sie sich an dem Thema zu erwärmen. »Ihr Älteren versteht das nicht. Ihr habt einen Krieg überlebt. Ihr habt alles mögliche aufgebaut. Ihr habt uns bekommen; wir sind herangewachsen. Aber sieh dir doch die Welt an, die ihr uns hinterlassen habt! Überall an den Grenzen stehen Abschußbasen und Raketensilos. Das Öl wird knapp, deshalb verwenden wir Atomkraft und der Müll wird eines Tages unsere Kinder vergiften… Ihr habt uns alles gegeben, nur nicht das Morgen. Ich möchte nicht, daß mein Baby in einem Luftschutzkeller zur Welt kommt und an radioaktiver Strahlung stirbt… Alles, was wir haben, ist das Heute und unsere Liebe, und wir glauben, daß wir wenigstens darauf ein Recht besitzen.«
Ihre Heftigkeit erschreckte ihn, als hätte man ihm Wasser ins Gesicht geschüttet. Das kleine blonde Mädchen, das er auf den Knien gehalten hatte, war ihm für immer verloren. An ihrer Stelle stand jetzt eine zornige junge Frau, die tiefen Groll gegen ihn und seine ganze Generation hegte. Ihm kam plötzlich der Gedanke, daß es vielleicht sie und andere ihresgleichen waren, für die Jean Marie Barette seine Anweisung für das Leben in den letzten Tagen niedergeschrieben hatte. Mit Sicherheit waren es nicht die jungen Menschen gewesen, die den Text unterdrückt hatten, sondern Männer seiner Generation, die Älteren, die angeblich so Klugen, die ewigen Pragmatiker, deren Zeit bald abgelaufen sein würde. Er betete im stillen, er möge jetzt die richtigen Worte finden, und begann mit leiser Stimme, ihr gut zuzureden.
»Glaube mir, mein Kleines, ich verstehe, was ihr – ihr beide – empfindet. Auch deine Mutter versteht es, nur auf eine andere Weise, denn sie weiß, wie eine Frau verletzt sein kann und wie sie länger an den Folgen zu tragen hat als ein Mann. Sie streitet mit dir, weil sie dich liebt und sich um dich Sorgen macht… Siehst du, die Welt mag aus den Fugen geraten sein – und ich sitze hier bei der Lektüre eines Textes, in dem beschrieben wird, um wieviel schrecklicher die Verhältnisse vielleicht noch werden können –, aber du weißt aus Erfahrung, was Lieben und Geliebtwerden bedeutet. Du hast noch nicht die ganze Erfahrung, aber einen Teil von ihr; du weißt also, worum es bei der Liebe geht: um geben und nehmen und sich sorgen und nie den ganzen Kuchen für sich selbst beanspruchen… Und jetzt beginnst du das nächste Kapitel mit deinem Franz, und nur ihr beide könnt es schreiben – gemeinsam. Wenn du Schiffbruch erleidest, können deine Mutter und ich nichts anderes tun, als dir die Tränen trocknen und deine Hand halten, bis du wieder soweit bist, mit dem Leben beginnen zu können… Wir möchten euch nicht vorschreiben, wie ihr euer Gefühlsleben oder eure sexuellen Beziehungen gestalten sollt. Aber eines können wir euch sagen: Wenn ihr eure Herzen und jene ganz besondere Freude, die den Sex so schön macht, unnütz vergeudet, dann könnt ihr den Verlust nicht wieder gutmachen. Ihr könnt andere Erlebnisse haben, auch andere Freuden, aber nie wieder jene erste, ganz spezielle und ausschließliche Ekstase, die das ganze verwirrende Erlebnis von Leben und Sterben lohnend macht… Was kann ich dir sonst noch sagen, mein Kleines? Fahr nach Paris mit deinem Franz! Lernt, euch zu lieben! Und für das Morgen… Wie ist dein Latein?«
Sie lächelte unter Tränen.
»Du weißt, ich bin darin miserabel.«
»Versuch es einmal hiermit: ›Quid sit futurum cras, fuge quaerere.‹ Stammt vom alten Horaz.«
»Sagt mir immer noch nichts.«
»Ganz einfach. ›Frag nicht, was das Morgen bringen mag‹… Wenn du dein ganzes Leben nur auf den Sturm wartest, wirst du nie den Sonnenschein genießen.«
»Ach, Papa!« Sie warf ihm die Arme um den Hals und küßte ihn. »Ich habe dich ja so lieb! Du hast mich ganz glücklich gemacht.«
»Geh jetzt ins Bett, mein Kleines«, sagte Karl Mendelius leise.
»Ich habe noch etwa eine Stunde zu tun.«
»Du überanstrengst dich, Papa.«
Er tätschelte mit väterlicher Fürsorge ihre Wange und zitierte:
»Ein Vater ohne Arbeit bedeutet soviel wie eine Tochter ohne Mitgift. Gute Nacht, Liebes. Träume süß!«
Als sich die Tür hinter ihr geschlossen hatte, spürte er das Prickeln ungebetener Tränen – Tränen für alle ihre jugendlichen Hoffnungen und ihre bedrohte Unschuld. Er schnäuzte sich heftig, setzte die Brille auf und nahm die Lektüre von Jean Maries Apokalypse wieder auf.
… Es ist klar, daß in den Tagen weltweiten Unheils die traditionellen Gesellschaftsstrukturen nicht überleben werden. Es wird zu einem wilden Ringen um die einfachsten Lebensnotwendigkeiten kommen – um Nahrung, Wasser, Brennstoff und Unterkunft. Die Starken und die Grausamen werden die Macht an sich reißen.
Städtische Gemeinschaften werden sich in Stammesgruppen auflösen, die einander feindlich gegenüberstehen. Ländliche Gegenden werden geplündert werden. Der Mensch wird ebenso zur Jagdbeute werden wie die Tiere, die wir jetzt schlachten, um sie aufzuessen. Die Vernunft wird sich so verdunkeln, daß der Mensch Zuflucht bei den primitivsten und gewaltsamsten Formen der Magie suchen wird. Es wird sogar denjenigen, die fest in der Verheißung des Herrn verwurzelt sind, schwerfallen, ihren Glauben zu bewahren und Zeugnis abzulegen, wie sie es selbst bis zum bitteren Ende tun müßten… Wie sollten sich Christen in diesen Tagen der Anfechtung und des Schreckens verhalten?
… Da sie nicht mehr imstande sein werden, als große Gemeinschaften weiterzuleben, müssen sie sich in kleine Gemeinden aufteilen, deren jede fähig ist, sich durch Ausübung des gemeinsamen Glaubens und wahrer gegenseitiger Barmherzigkeit zu unterhalten. Sie müssen sich als Christen bewähren, indem sie diese Barmherzigkeit auch denjenigen erweisen, die außerhalb des Glaubens stehen, indem sie den in Not Geratenen helfen und ihre Mittel, auch wenn diese noch so dürftig sind, mit denjenigen teilen, deren Leiden am größten ist. Wenn die priesterliche Hierarchie nicht mehr funktionsfähig ist, werden sie sich selbst Geistliche und Lehrer wählen, die das Wort in seiner reinsten Form verkünden und weiterhin das Abendmahl feiern...
»Gott der Allmächtige! Jetzt hat er es wirklich getan!« Mendelius hörte seine eigene Stimme im Raum widerhallen. Ob Erfindung oder Vorherbestimmung – dies war aus der Feder eines Papstes unsagbar, absolut unmöglich. Wenn die Weltpresse diesen Text in die Hände bekäme, würde sie Jean Marie Barette zum Narren und geisteskranken Weltuntergangspropheten stempeln. Und trotzdem war es im Hinblick auf eine atomare Katastrophe ein Fall simpler Logik. Es war ein Szenarium, das die Führer dieser Welt in ihren geheimsten Akten unter Verschluß hielten – das Drehbuch für die Zeit nach dem endgültigen Entscheidungskampf.
Und so gelangte Mendelius zu dem dritten und letzten Dokument: der Liste all jener, die nach Auffassung von Jean Marie bereit sein würden, seiner Botschaft und deren Überbringer Glauben zu schenken. Diese Aufstellung war vielleicht das erstaunlichste Schriftstück. Anders als der Brief und die Enzyklika war sie mit Schreibmaschine geschrieben, als gehörte sie zu einem offiziellen Aktenstück. Sie enthielt Namen, Adressen, Titel, Telefonnummern, Hinweise auf die Möglichkeit persönlicher Kontaktaufnahme und eine kurze, im Telegrammstil gehaltene Charakteristik jedes einzelnen. Es waren Politiker, Industrielle, Geistliche, Führer von Dissidentengruppen, Herausgeber bekannter Zeitungen, insgesamt mehr als hundert Namen. Zwei Eintragungen waren typisch für den Gesamtinhalt:
| USA | |
| Name: | Michael Grant Morrow |
| Beruf: | Außenminister |
| Privatanschrift: | 593 Park Avenue, New York |
| Telefon: | (212) 689-7611 |
| Religion: | evangelisch |
Bei Essen im Weißen Haus kennengelernt. Feste religiöse Überzeugungen. Spricht russisch, französisch und deutsch. In der Sowjetunion angesehen, aber Beziehungen in Asien schwach. Ist sich kritischer Lage an europäischen Grenzen voll bewußt. Hat privat eine Abhandlung über die Arbeit religiöser Gruppen im Rahmen einer in Auflösung befindlichen Gesellschaft geschrieben.
| UdSSR | |
| Name: | Sergej Andrejewitsch Petrow |
| Beruf: | Landwirtschaftsminister |
| Privatanschrift: | unbekannt |
| Telefon: | Moskau 53871 |
Privatbesuch im Vatikan mit Neffen des Ministerpräsidenten. Sieht die Notwendigkeit religiöser und ethnischer Toleranz in UdSSR und Satelliten ein, kann sich aber gegen Parteidogmatiker nicht durchsetzen. Fürchtet, daß russische Schwierigkeiten bei Lebensmittel- und Ölversorgung Konflikt auslösen könnten. Enge Freunde in führenden Militärkreisen, Feinde beim KGB. Stellung bei Mißernten oder Wirtschaftsblockade gefährdet.
Auf der letzten Seite stand in Jean Maries eigener, unverkennbarer Handschrift:
Alle in dieser Liste aufgeführten Personen sind mir persönlich bekannt. Jeder hat mir auf seine Weise zu verstehen gegeben, daß er sich der Krise bewußt und bereit ist, ihr im Geiste der Humanität entgegenzutreten, wenn auch nicht immer vom Standpunkt des gläubigen Christen aus. Ob sie sich unter dem Druck kommender Ereignisse ändern werden, weiß ich nicht. Alle haben mir jedoch ein hohes Maß an Vertrauen entgegengebracht, was ich zu erwidern versuchte. Als Privatperson wirst Du zunächst auf Mißtrauen stoßen; sie werden sich Dir gegenüber reservierter verhalten. Die Gefahren, vor denen ich Dich gewarnt habe, werden beim ersten Kontakt beginnen, denn Du genießt keine diplomatische Immunität, und die Sprache der Politik dient der Verschleierung der Wahrheit.
J. M. B.
Karl Mendelius nahm die Brille ab und versuchte, sich die Müdigkeit aus den Augen zu reiben. Er hatte den Text als Freund und als Wissenschaftler gelesen. In dieser einsamen Stunde nach Mitternacht mußte er jetzt den Urteilsspruch über die Worte, wenn nicht sogar über den Mann fällen, der sie niedergeschrieben hatte. Kalte Angst ergriff ihn plötzlich, als gingen in den Schatten des Raumes alte, vorwurfsvolle Geister um: die Geister von Männern, die als Ketzer verbrannt, und von Frauen, die als Hexen ertränkt worden waren, die Geister namenloser Märtyrer, welche die Vergeblichkeit ihres Opfers beklagten.
In diesen skeptischen mittleren Lebensjahren fiel ihm das Beten nicht leicht. Jetzt spürte er aber das Bedürfnis, Trost im Gebet zu suchen; doch die Worte wollten ihm nicht über die Lippen kommen. Er glich einem Menschen, der so lange in der Finsternis eingesperrt war, daß er den Klang der menschlichen Sprache vergessen hatte.
»Jetzt sitzen wir wirklich im Wolkenkuckucksheim!« Anneliese Meißner kaute an einer Essiggurke und spülte sie mit Wein hinunter. »Diese sogenannte Enzyklika ist ein Unsinn – ein Mischmasch aus Folklore und falscher Mystik!«
Sie saßen in ihrer unaufgeräumten Wohnung; vor ihnen auf dem Tisch stand neben den ausgebreiteten Dokumenten eine Flasche Trollinger, um den allgegenwärtigen Staub zu binden. Mendelius hatte sich geweigert, die Papiere aus der Hand zu geben, während Anneliese mit gleicher Vehemenz auf das Recht des Beisitzers, jede Zeile der Beweisunterlagen lesen zu können, gepocht hatte. Mendelius protestierte gegen die Art und Weise, wie sie das Dokument kurzerhand abtat.
»Hier sollten wir erst einmal stehenbleiben! Wenn wir diskutieren wollen, müssen wir es auf wissenschaftlicher Grundlage tun. Zunächst folgendes: Es gibt eine umfangreiche Literatur über das Ende der Welt vom Buch Daniel im Alten Testament bis zu Jakob Böhme im siebzehnten Jahrhundert und Teilhard de Chardin im zwanzigsten. Einiges davon ist Unsinn – gewiß! Einiges ist hochgradige Dichtung wie zum Beispiel die Schriften des Engländers William Blake. Viele Werke aber enthalten kritische Stellungnahmen zu einer der ältesten Überlieferungen dieser Welt. Dann: Jeder ernstzunehmende Wissenschaftler wird Ihnen sagen, daß es durch die Evolution oder aufgrund von Katastrophen zu einem Ende menschlichen Daseins auf unserem Planeten kommen kann. Was Jean Marie hier geschrieben hat, paßt durchaus in die vernünftigeren Bereiche solcher Gedanken. Das Drehbuch einer solchen Katastrophe ist bereits fester Bestandteil ernstzunehmender Spekulationen von Wissenschaftlern und Militärstrategen.«
»Einverstanden. Aber Ihr Mann schüttet das Kind mit dem Bade aus! Glaube, Hoffnung und Liebe, während die Wölfe draußen vor den Toren heulen! Ein liebender Gott, der über einem Chaos brütet, das er selbst in Szene gesetzt hat. Unsinn, Professor!«
»Was geschieht, falls der Text veröffentlicht wird?«
»Die halbe Welt würde sich totlachen. Die andere Hälfte würde sich dem allgemeinen Wahnsinn anschließen und auf die Straße gehen, um den Erlöser zu empfangen. Im Ernst, Karl, ich finde, Sie sollten das verdammte Ding vergessen und zur Tagesordnung übergehen!«
»Ich kann es verbrennen; aber ich kann nicht einfach zur Tagesordnung übergehen.«
»Weil auch Sie diesem Wahnsinn zum Opfer gefallen sind!«
»Und was halten Sie von diesem dritten Dokument, der Namensliste?«
»Ich sehe nicht ein, welche Bedeutung sie haben sollte. Sie ist eine Gedächtnisstütze, die aus dem Karteischrank herausgeholt worden ist. Jeder Politiker auf der Welt führt derartige Unterlagen. Was erwartet er denn von Ihnen? Sollen Sie etwa um die Welt fahren und alle diese Leute besuchen? Was wollen Sie ihnen sagen? ›Mein Freund, Gregor XVII., den man aus dem Vatikan hinausgeworfen hat, glaubt, das Ende der Welt sei nahe. Er hat eine entsprechende Vision gehabt. Er findet, Sie sollten rechtzeitig vorgewarnt sein.‹ Ich bitte Sie, Karl! Man würde Sie in eine Zwangsjacke stecken, bevor Sie noch das erste Gespräch beendet haben!«
Er sah plötzlich das Komische an der Situation und lachte – ein lauter Heiterkeitsausbruch, der schließlich in ein hilfloses Kichern absank.
Anneliese Meißner schenkte Wein nach und prostete ihm zu. »Das klingt schon besser! Ich hatte schon gedacht, ich hätte einen guten Kollegen verloren.«
»Vielen Dank, Frau Beisitzerin.« Mendelius nahm einen großen Schluck und setzte das Weinglas wieder ab. »Aber kommen wir zur Sache zurück. Ich fahre in vierzehn Tagen nach Rom.«
»Das ist doch nicht Ihr Ernst!« Sie sah ihn ungläubig an. »Und was glauben Sie dort erreichen zu können?«
»Ich will etwas Urlaub machen, an der Deutschen Akademie ein paar Vorträge halten und mit Jean Marie Barette sowie einigen Menschen, die ihm nahestanden, sprechen. Ich werde von jedem Gespräch ein Tonbandprotokoll aufnehmen und Ihnen zuschicken. Erst danach werde ich mich entscheiden, ob ich die ganze Sache auf sich beruhen lasse oder nicht. Ich habe dann wenigstens eine Freundespflicht erfüllt – und ich habe auch meine Beisitzerin informiert.«
»Hoffentlich ist Ihnen klar, mein Freund, daß Ihre Beweisunterlagen, auch wenn Sie dies alles tun werden, immer noch unvollständig bleiben.«
»Ich sehe nicht ein, warum dies so sein müßte.«
»Denken Sie mal darüber nach.« Anneliese Meißner spießte noch eine Essiggurke auf und hielt sie ihm unter die Nase. »Wie wollen Sie denn mit Gott sprechen? Wollen Sie Ihn auch auf Band aufnehmen?«
Er war von Natur ein ordnungsliebender Mensch und bereitete seine Romreise mit peinlicher Sorgfalt vor. Er führte Telefongespräche mit Freunden, schrieb Briefe an Bekannte, knüpfte Kontakte zu Persönlichkeiten des Vatikans und legte schon im voraus die Termine für Mittagessen, Abendessen sowie offizielle Gespräche fest. Er legte großen Wert darauf, den privaten Charakter seines Besuches zu betonen: Nachforschungen in der Vatikanischen Bibliothek und im Bibelinstitut nach Resten ebionitischer Literatur und eine Reihe von Vorträgen an der Akademie zur apokalyptischen Überlieferung.
Er hatte dieses Thema nicht nur deshalb gewählt, weil es ihm einen Aufhänger für seine Erkundungen bezüglich Jean Maries bot, sondern auch weil es ihm geeignet schien, von seinen evangelischen Zuhörern eine emotional gefärbte Reaktion auf das Thema »Weltuntergang« zu erhalten. In seiner Jugend hatte ihn Jung mit seiner Idee des »großen Träumens«, dem Gedanken eines Weiterlebens von Stammeserfahrungen im Unterbewußten und dessen nachhaltigem Einfluß auf das Individuum und die Gruppe, tief bewegt. Es bestand eine auffallende Ähnlichkeit zwischen dieser Idee und dem, was die Theologen »Eingebung« und »Innewohnen des Geistes« bezeichnen. Sie berührte auch die Frage seiner Beisitzerin Anneliese Meißner mit ihrer hartnäckigen Ablehnung jeglicher transzendentalen Erfahrung. Ihr Seitenhieb wegen des Gesprächs mit Gott ärgerte ihn noch immer – dies um so mehr, als er keine angemessene Antwort darauf hatte finden können.
Er saß lange Zeit über einem Brief an den Abt von Monte Cassino, der jetzt Jean Maries geistlicher Vorgesetzter war. Dieser Brief war ein wichtiger Akt der Höflichkeit. Jean Marie hatte sich dem Abt gegenüber zum Gehorsam verpflichtet, und die Einschränkungen des Klosterlebens konnten sich auch auf sein Kommen und Gehen, sogar auf seinen privaten Schriftverkehr auswirken. Mendelius, der selbst einmal dieser Lebensform zugehört hatte, besaß ein feines Gespür für Fragen des geistlichen Protokolls. In seinem Brief ging er auf seine langjährige Freundschaft mit Jean Marie Barette ein, und er brachte zum Ausdruck, wie sehr er sich scheue, letzteren in seiner augenblicklichen Abgeschiedenheit zu stören. Falls der Abt jedoch keine Einwände erhebe und der ehemalige Papst bereit sei, ihn zu empfangen, würde Professor Karl Mendelius dem Kloster zu einem für beide Seiten genehmen Zeitpunkt gern einen Besuch abstatten.
Er legte einen Brief bei und bat den Abt, ihn Jean Marie Barette auszuhändigen. Auch diesen hatte er mit großer Sorgfalt verfaßt.
Mein lieber Freund,
bitte verzeih mir die formlose Art, aber ich bin in den Protokollvorschriften für den Briefverkehr mit einem ehemaligen Papst, der sich zum demütigen Sohn des heiligen Benedikt gemacht hat, nicht bewandert.
Ich habe immer bedauert, daß es mir nicht möglich war, die Bürde Deiner letzten Tage im Vatikan mit Dir zu teilen; aber Du weißt ja, deutsche Professoren besitzen selten einen Einfluß, der über den Hörsaal hinausreicht.
Ich werde jedoch bald in Rom sein – denn ich will meine Forschungen über die Ebioniten fortsetzen und an der Deutschen Akademie einige Vorträge über die Lehre von der Wiederkunft Christi halten – und es wäre für mich eine große Freude, Dich, wenn auch nur kurz, bei dieser Gelegenheit wiedersehen zu können.
Ich habe dem Hochehrwürdigen Herrn Abt geschrieben und seine Erlaubnis erbeten, Dich aufzusuchen, natürlich vorausgesetzt, daß Du Lust hast, mich zu empfangen. Wenn wir uns treffen können, werde ich dankbar und glücklich sein. Wenn Dir der Zeitpunkt nicht gelegen kommt, habe keine Hemmungen, es mir zu sagen.
Ich hoffe, es geht Dir gut. Da die Welt so aus den Fugen geraten ist, glaube ich, daß Du klug gehandelt hast, indem Du Dich aus ihr zurückziehst. Lotte läßt Dich herzlich grüßen und meine Kinder senden ihre ergebensten Empfehlungen. Ich selbst bleibe stets
in der Verbundenheit mit Gott
der Deinige,
Karl Mendelius
Die Antwort wurde zehn Tage darauf von einem Boten des Kardinals von München-Freising überbracht: Der Hochehrwürdige Herr Abt Andreas werde sich glücklich schätzen, ihn in Monte Cassino zu empfangen, und der Hochehrwürdige Jean Marie Barette, OSB, wäre hocherfreut, wenn es sein Gesundheitszustand zulasse, seinen alten Freund wiederzusehen. Er möge den Abt unmittelbar nach seiner Ankunft in Rom anrufen und einen Besuchstermin mit ihm vereinbaren.
Von Jean Marie kam keine Antwort.
Am Abend, bevor er mit Lotte nach Rom abreiste, bat er seinen Sohn Johann auf eine Tasse Kaffee zu sich in sein Arbeitszimmer. Ihr beiderseitiges Verhältnis war seit längerer Zeit etwas gestört. Der Junge, ein brillanter Student der Wirtschaftswissenschaften, fühlte sich im Schatten seines Vaters, der ein führendes Mitglied des Universitätslehrkörpers war, nicht mehr recht wohl. Der Vater erwies sich oft als ungeschickt in seinem Bemühen, eine so offenkundige Begabung zu fördern. Die Folge war Geheimniskrämerei auf der einen und Groll auf der anderen Seite, und nur selten kam die Zuneigung zum Durchbruch, die sie beide noch immer verband. Diesmal war Mendelius entschlossen, taktvoll vorzugehen. Wie gewöhnlich, konnte er seine Unbeholfenheit nur schwer überwinden. Er fragte:
»Wann gehst du auf die Reise, mein Sohn?«
»In zwei Tagen.«
»Hast du schon eine bestimmte Route festgelegt?«
»Mehr oder weniger. Wir fahren mit der Bahn bis München und setzen von dort die Reise per Anhalter fort – über Salzburg und die Tauern nach Kärnten.«
»Eine wunderschöne Gegend. Ich wünschte, ich könnte mitkommen. Übrigens…«, er griff in die Brusttasche und brachte einen verschlossenen Umschlag zum Vorschein, »… dies ist ein kleiner Beitrag zu deinen Reisekosten.«
»Aber du hast mir doch schon Urlaubsgeld gegeben.«
»Dies hier ist extra. Du hast in diesem Jahr sehr fleißig gearbeitet. Deine Mutter und ich wollten das anerkennen.«
»Aber… vielen Dank.« Er war sichtlich verlegen. »Aber es war wirklich nicht nötig. Du bist mir gegenüber immer sehr großzügig gewesen.«
»Da ist noch etwas, das ich dir sagen wollte.« Er sah, wie der Junge zusammenzuckte. Der alte störrische Blick kehrte wieder zurück. »Es ist eine persönliche Angelegenheit. Es wäre mir lieb, wenn du darüber mit deiner Mutter nicht sprechen würdest. Einer der Gründe, warum ich nach Rom fahre, ist folgender: Ich möchte die Hintergründe untersuchen, die zur Abdankung Gregors XVII. geführt haben. Wie du weißt, ist er ein guter Freund von mir…« Er lächelte halb. »Auch von dir, nehme ich an, denn ohne seine Hilfe hätten deine Mutter und ich vielleicht nie geheiratet, und du wärst jetzt nicht auf der Welt… Meine Erkundigungen können eine längere Zeit in Anspruch nehmen und viele Reisen erfordern. Sie können auch gewisse Risiken nach sich ziehen. Wenn mir etwas zustößt, sollst du wissen, daß meine persönlichen Angelegenheiten geregelt sind. Dr. Mahler, unser Anwalt, hat die meisten Dokumente zur Aufbewahrung. Der Rest liegt dort drüben im Safe. Du bist längst ein Mann. Du müßtest dann an meine Stelle treten und für deine Mutter und deine Schwester sorgen.«
»Ich verstehe dich nicht. An was für Risiken denkst du denn? Und warum mußt du sie eingehen?«
»Das ist schwer zu erklären.«
»Ich bin dein Sohn.« Seine Stimme klang etwas gekränkt. »Gib mir wenigstens eine Chance, dich zu verstehen.«
»Bitte! Laß uns ruhig miteinander sprechen. Ich brauche dich jetzt, sogar sehr.«
»Es tut mir leid, es ist nur, weil ich…«
»Ich weiß. Wir kommen uns immer wieder in die Quere. Aber ich liebe dich, mein Sohn. Ich wünschte, ich könnte dir sagen, wie sehr.« Die Emotionen drohten ihn zu überwältigen, und er wollte aufstehen, um den jungen Mann zu umarmen, aber er fürchtete sich vor einer Zurückweisung. Mit leiser Stimme fuhr er fort: »Als Erklärung muß ich dir geheime Unterlagen zeigen, und ich muß dich bei deiner Ehre verpflichten, mit niemandem darüber zu reden.«
»Du hast mein Wort, Vater.«
»Ich danke dir.« Mendelius ging zum Safe, nahm die Barette-Papiere heraus und übergab sie seinem Sohn. »Lies das mal. Es erklärt alles. Wenn du durch bist, wollen wir darüber sprechen. Ich muß mir noch einige Notizen machen.«
Er setzte sich an den Schreibtisch, während sich Johann in seinem Sessel mit den Unterlagen beschäftigte. Im gedämpften Licht der Leselampe erinnerte er Mendelius an eines von Raffaels jungen Modellen, die gehorsam und regungslos dasaßen, während der Meister sie auf der Leinwand unsterblich machte. Die verlorenen Jahre taten ihm leid. So hätte es schon immer sein sollen: Vater und Sohn, friedlich beieinander sitzend, und alle kindlichen Streitereien längst vergessen.
Mendelius stand auf, um Johann Kaffee und Cognac nachzuschenken. Johann nickte dankend und setzte seine Lektüre fort. Es waren fast vierzig Minuten vergangen, bevor er zum letztenmal umblätterte, lange schweigend sitzen blieb, die Papiere dann sorgsam zusammenfaltete, aufstand und sie seinem Vater auf den Schreibtisch legte. Er sagte mit ruhiger Stimme:
»Ich verstehe dich jetzt, Vater. Ich halte das Ganze für einen gefährlichen Unsinn und möchte nicht, daß du dich in diese Sache hineinziehen läßt. Aber ich verstehe dich jetzt.«
»Ich danke dir. Willst du mir vielleicht auch noch sagen, warum du das alles für einen Unsinn hältst?«
»Nein.« Sein Tonfall war fest, aber respektvoll. Er hielt sich kerzengerade, wie ein Untergebener, der mit seinem Vorgesetzten spricht. »Ich habe dir schon seit langem etwas sagen wollen. Das kann ich ebensogut jetzt tun.«
»Vielleicht gibst du mir erst noch einen Cognac.« Mendelius lächelte ihn an.
»Selbstverständlich.« Er goß seinem Vater das Glas ein und stellte es auf den Schreibtisch. »Die Sache ist die, Vater: Ich glaube nicht mehr.«
»Nicht mehr an Gott oder speziell an die römisch-katholische Kirche?«
»An beide nicht mehr.«
»Es tut mir leid, dies von dir zu hören, mein Sohn.« Mendelius blieb äußerlich völlig ruhig. »Ich habe immer gefunden, daß die Welt ohne die Hoffnung auf ein Jenseits ein Jammertal ist. Aber ich bin froh, daß du es mir gesagt hast. Weiß es deine Mutter?«
»Noch nicht.«
»Ich werde es ihr sagen, wenn es dir nichts ausmacht – aber später. Ich möchte, daß sie diese Ferientage genießen kann.«
»Bist du böse auf mich?«
»Um Gottes willen, nein!« Mendelius stand langsam auf und umfaßte mit den Händen die Schultern des jungen Mannes. »Hör mir mal zu! Mein ganzes Leben habe ich gelehrt und geschrieben, daß der Mensch nur den Pfad beschreiten kann, den er vor sich sieht. Wenn du dich nicht ehrlich zum Glauben bekennen kannst, dann darfst du es auch nicht tun. Eher solltest du dich wie Giordano Bruno auf dem Scheiterhaufen verbrennen lassen. Und was deine Mutter und mich angeht, so haben wir keinerlei Recht, dir Vorschriften für dein Gewissen zu machen… Aber denk immer an eines, mein Sohn: Halte deine Seele offen, damit dich das Licht jederzeit erreichen kann. Bleib immer offenen Herzens, damit die Liebe nie draußen vor der Tür bleiben muß.«
»Ich… ich habe nie gedacht, daß du es so aufnehmen würdest.« Zum erstenmal schien Johann die Selbstbeherrschung zu verlieren. Mendelius zog ihn an sich und legte ihm die Arme um die Schultern.
»Ich liebe dich, Junge! Daran kann nichts etwas ändern. Außerdem... du hast jetzt eine neue Heimat. Du wirst erst wissen, ob sie dir gefällt, wenn du auch einen Winter überstanden hast... Wir wollen uns also von jetzt an keine Vorwürfe mehr machen, einverstanden?«
»Klar!« Johann löste sich aus der Umarmung seines Vaters und griff nach dem Cognacglas. »Laß mich darauf trinken.«
»Prost«, sagte Karl Mendelius.
»Wegen der anderen Sache, Vater.«
»Ja?«
»Ich kann dein Engagement verstehen. Ich weiß, was dir die Freundschaft von Jean Marie bedeutet. Aber ich glaube, du mußt das Wichtigste an die erste Stelle setzen. Mutter kommt zuerst; na ja… Kathrin und ich brauchen dich auch.«
»Ich versuche, alles in die richtige Reihenfolge zu bringen.« Mendelius lachte kaum hörbar in sich hinein. »Du glaubst vielleicht nicht an die Wiederkunft, aber wenn sie geschieht, wird sie die Prioritäten ein wenig durcheinanderbringen… findest du nicht auch?«
Aus der Luft sah die italienische Landschaft wie ein grünes Paradies aus – die Obstgärten standen in voller Blüte, auf den Wiesen blühten die Blumen, die Felder glänzten in neuem Grün und die alten, befestigten Städte lagen ruhig wie Bilder aus einem Märchen unter ihnen.
Im Gegensatz dazu wirkte der Flugplatz von Fiumicino wie die Generalprobe für das endgültige Chaos. Die Fluglotsen arbeiteten nach Vorschrift; die Gepäckträger streikten. An den Paßkontrollen bildeten sich lange Schlangen. Die Luft war von einem Stimmengewirr aus dutzend Sprachen erfüllt. Die Polizei durchsuchte die ungeduldige Menge mit Spürhunden nach Drogenschmugglern; junge Rekruten standen, mit Maschinenpistolen bewaffnet, an den Ausgängen und beobachteten die Szene mit gespannter Aufmerksamkeit.
Lotte war den Tränen nahe, und Mendelius brach aus Zorn und Verzweiflung der Schweiß aus. Sie brauchten anderthalb Stunden, um durch den Zoll in die Empfangshalle zu gelangen, wo sie von Hermann Frank erwartet wurden. Er hatte eine große Limousine mitgebracht – einen von der deutschen Botschaft geliehenen Mercedes. Er hatte Blumen für Lotte, eine überschwängliche Begrüßung für den Herrn Professor und eine Flasche Champagner parat, die während der langen Rückfahrt in die Stadt getrunken werden sollte. Die Verkehrsverhältnisse würden, wie immer, chaotisch sein; aber er wolle ihnen einen kleinen Vorgeschmack auf den himmlischen Frieden bieten.
Der Friede wurde ihnen schließlich in der Frankschen Wohnung zuteil; sie lag im obersten Stockwerk eines aus dem siebzehnten Jahrhundert stammenden Palazzo mit hohen, von Deckenfresken geschmückten Räumen, Marmorfußböden, Badezimmern, in denen eine ganze Flotte hätte schwimmen können, und einem wundervollen Blick über die Dächer des alten Rom. Zwei Stunden später, nachdem sie gebadet und sich umgezogen hatten, saßen sie beim Cocktail auf der Terrasse, lauschten den späten Kirchenglocken und beobachteten die Mauersegler, die um die Kuppeln und Dächer schwirrten.
»Dort unten ist es fürchterlich…« Hilde Frank wies auf die Straßen hinunter, die von Autos und Fußgängern verstopft waren. »Manchmal ist es wirklich lebensgefährlich, denn die Terroristen gehen jetzt rücksichtslos vor, und die dünne Kruste von Ruhe und Ordnung hat viele Löcher bekommen. Das Kidnapping ist zu einem großen Geschäft geworden. Wir gehen abends nicht mehr aus, wie wir es früher taten, denn man läuft immer Gefahr, von Banden überfallen zu werden. Aber hier oben«, sie wies auf die uralte Silhouette der Stadt, »ist es immer noch wie vor Jahrhunderten: die Wäsche auf der Leine, die Vögel, Musik, die kommt und geht, und die Frauen im Gespräch mit ihren Nachbarinnen. Ohne dies alles würden wir es hier, glaube ich, nicht länger aushalten.«
Sie war eine kleine, dunkelhaarige Frau, quicklebendig, elegant wie ein Mannequin und zwanzig Jahre jünger als ihr Mann, der sie anbetete. Auch sie war liebevoll und zärtlich wie ein Kätzchen. Mendelius erkannte einen Anflug von Eifersucht in Lottes Augen, als Hilde ihn bei der Hand nahm und in eine Ecke der Terrasse führte, um ihm in der Ferne die Peterskirche und die Engelsburg zu zeigen. Sie sagte so laut, daß es die anderen hören konnten:
»Hermann ist so glücklich, daß du dich bereit erklärt hast, einige Vorträge für ihn zu halten. Er nähert sich dem Pensionsalter und haßt die Vorstellung, in den Ruhestand zu treten. Die Akademie ist sein Leben – eigentlich unser beider Leben, denn wir haben keine Kinder… Lotte sieht sehr gut aus. Ein Einkaufsbummel wird ihr sicher Spaß machen. Ich dachte, ich nehme sie morgen zur Via Condotti mit, während du und Hermann in der Akademie seid. Die Seminarteilnehmer sind noch nicht da, aber er kann es kaum erwarten, dir die Villa Massimo zu zeigen.«
»… Und wir können dir in diesem Jahr viel Schönes bieten!« Hermann Frank trat mit Lotte am Arm zu ihnen. »Wir zeigen die erste umfassende Ausstellung von van Wittel, die je in diesem Lande zu sehen war, und Pietro Falcone hat uns seine Sammlung antiken Florentiner Schmucks geliehen. Das ist ein kostspieliges Unterfangen, denn wir brauchen ständig bewaffnetes Wachpersonal… Aber jetzt will ich euch erzählen, wer heute abend zum Essen kommen wird. Da ist zunächst Bill Utley und seine Frau Sonia. Er ist der Britische Botschafter beim Heiligen Stuhl. Bill ist ein trockener alter Bursche, aber er weiß, was los ist. Er spricht auch ganz gut deutsch, was der Unterhaltung zugute kommt. Sonia ist eine lustige Plaudertasche, die aus ihrem Herzen keine Mördergrube macht. Du wirst gut mit ihr auskommen, Lotte. Dann kommt Georg Rainer, der römische Korrespondent für ›Die Welt‹. Er ist ein interessanter Gesprächspartner. Es war Hildes Idee, ihn einzuladen, denn er hat eine Freundin, die noch niemand zu Gesicht bekommen hat. Eine Mexikanerin, glaube ich, und sie soll sehr reich sein… Wir setzen uns etwa um halb zehn zu Tisch… Übrigens, Karl, für dich ist ein Stapel Post angekommen. Ich habe dem Mädchen gesagt, daß es die Briefe in eurem Zimmer liegenlassen soll…«
Die überaus herzliche Aufnahme im Hause Frank erinnerte Mendelius an glücklichere Tage, bevor der Ölkrieg begann, das italienische Wunder zerrann und die erhoffte europäische Einigung unwiederbringlich in die Brüche ging. Als die Gäste erschienen, hatte sich Lotte bereits an die neue Umgebung gewöhnt und plauderte vergnügt mit Hilde über eine Fahrt nach Florenz und einen Ausflug nach Ischia, während Karl Mendelius dem begeistert zuhörenden Hermann den Inhalt seiner Vorträge in großen Zügen skizzierte.
Das Abendessen verlief in angenehmer Atmosphäre. Utleys Frau gab allerlei Klatschgeschichten zum besten. Georg Rainers Freundin, Pia Menendez, war eine auffallende Schönheit und verstand es, den verheirateten Damen auf liebenswürdige Art den Vortritt zu lassen. Georg Rainer wollte Neuigkeiten wissen; Utley erging sich gern in alten Erinnerungen; so war es für Mendelius nicht schwer, die Unterhaltung auf die jüngsten Ereignisse im Vatikan hinzusteuern. Der Brite Utley, der in seiner Muttersprache die Kunst nichtssagender Konversation perfekt beherrschte, drückte sich auf deutsch sehr präzise aus.
»… Auch dem Außenstehenden war es klar, daß Grego rXVII. alle in Panikstimmung versetzt hat. Die Organisation ist zu groß und deshalb zu anfällig, um einen Erneuerer oder auch nur einen zu anpassungsfähigen Mann an der Spitze zu verkraften. Es ist wie bei den Sowjets mit ihren Satelliten und ihren sozialistischen Regierungen in Afrika und Südamerika. Sie mußten, koste es, was es wolle, die Illusion der Einmütigkeit und Stabilität aufrechterhalten… Deshalb mußte Gregor gehen.«
»Es würde mich interessieren«, sagte Karl Mendelius, »genau zu erfahren, wie sie ihn zur Abdankung gebracht haben.«
»Darüber will sich niemand äußern«, sagte Utley. »Es war meines Erachtens das erste Mal, daß vom Monte Vaticano nichts Greifbares durchgesickert ist. Es hat offenbar erhebliche Auseinandersetzungen gegeben; aber man hat den Eindruck, daß hinterher einige ein ziemlich schlechtes Gewissen gehabt haben.«
»Man hat ihn erpreßt!« sagte der Mann von der »Welt« rundheraus. »Ich hatte die Beweise, konnte sie aber nicht veröffentlichen.«
»Warum nicht?« Die Frage kam von Utley.
»Weil ich es von einem Arzt erfahren hatte, der zu dem Ärzteteam gehörte, das ihn untersuchte. Er war offensichtlich nicht in der Lage, eine öffentliche Erklärung abzugeben.«
»Hat er Ihnen seine Diagnose mitgeteilt?«
»Er hat mir erzählt, was die Kurie als Ergebnis der Untersuchung von ihm erwartete: daß Gregor XVII. geistig nicht zurechnungsfähig sei.«
»Hat man es so unverblümt formuliert?« Mendelius war skeptisch.
»Nein. Das war ja gerade das Problem. Die Kurie ist sehr vorsichtig zu Werke gegangen. Sie hat die Ärzte – es waren insgesamt sieben – gebeten, zweifelsfrei festzustellen, ob der Papst psychisch und physisch in der Lage sei, in dieser kritischen Zeit seinen Amtspflichten nachzukommen.«
»Das ist ein dehnbarer Begriff«, sagte Utley. »Warum hat sich Gregor darauf eingelassen?«
»Er geriet in eine Falle. Wenn er sich weigerte, war er suspekt. Wenn er einverstanden war, unterwarf er sich dem ärztlichen Konsens.«
»Und wie sah dieser aus?« fragte Mendelius.
»Mein Gesprächspartner konnte mir das nicht sagen. Das war ja gerade das Raffinierte. Man bat jeden Arzt separat, schriftlich eine unabhängige Meinung zu äußern.«
»Wodurch die Kurie freie Hand hatte, anschließend ihre eigene Beurteilung zu formulieren.« Bill Utley lachte in sich hinein.
»Sehr schlau! Wie lautete also das Urteil Ihres Gesprächspartners?«
»Es war meines Erachtens ehrlich, für den Patienten jedoch nicht sehr hilfreich. Er leide unter Erschöpfungserscheinungen, Schlaflosigkeit und einem erhöhten, wenn auch nicht unbedingt chronisch erhöhten Blutdruck. Es bestünden deutliche Anzeichen von Angstzuständen und dauerndem Wechsel zwischen Heiterkeit und Depression. Falls diese Symptome bei einem Mann von fünfundsechzig aufträten, bestehe Grund, ernstere Komplikationen zu befürchten…«
»Wenn auch die anderen Berichte ähnlich aussahen…«
»Oder«, sagte Mendelius leise, »wenn sie nicht so ehrlich und ein bißchen frisiert waren…«
»Die Kardinäle haben ihn mattgesetzt«, sagte Georg Rainer. »Sie entnahmen den ärztlichen Gutachten die ihnen passenden Passagen, konstruierten ihr eigenes Urteil und stellten Gregor ein Ultimatum: Geh selbst, oder wir zwingen dich dazu!«
»Allmächtiger Gott!« stöhnte Mendelius still vor sich hin. »Was für eine Wahl blieb ihm denn?«
»Ein hübsches Beispiel für politische Machenschaften.« Bill Utley lachte leise. »Man kann einen Papst nicht vor Gericht stellen. Wie kann man sich seiner entledigen, wenn ein Attentat ausscheidet? Sie haben recht, Georg, es war reine Erpressung! Ich frage mich nur, wer sich dieses Spiel ausgedacht hat?«
»Natürlich Arnaldo. Ich weiß genau, daß er es war, der den Ärzten die Instruktionen erteilt hat.«
»Und jetzt ist er der Papst«, sagte Karl Mendelius.
»Er wird wahrscheinlich ein sehr guter Papst sein«, meinte Utley lächelnd. »Er kennt die Spielregeln genau.«
Karl Mendelius, der ehemalige Jesuit, konnte nicht umhin, ihm beizupflichten. Außerdem fand er, daß Georg Rainer ein sehr versierter Journalist sei und daß es sich lohne, diese Bekanntschaft zu pflegen.
In jener Nacht schlief er mit Lotte in einem riesigen Barockbett, das, wie Hermann felsenfest behauptete, einmal dem eleganten Kardinal Bernis gehört hatte. Ob Hermann recht hatte oder nicht, war ohne Belang. Ihre Liebesbegegnung war seit langer Zeit die schönste, die sie beide erlebt hatten. Anschließend machte es sich Lotte in seiner Armbeuge bequem und meinte schläfrig:
»Es war ein reizender Abend – alle waren so gut aufgelegt und herzlich zu uns! Ich bin froh, daß du mich überredet hast, mitzukommen. Tübingen ist eine nette Stadt; aber ich hatte schon fast vergessen, daß es auch noch etwas anderes in der Welt gibt.«
»Das wollen wir uns nun zusammen ansehen, Liebling.«
»Bestimmt. Mir ist wegen der Kinder jetzt auch wohler. Kathrin war sehr lieb. Sie hat mir erzählt, was du ihr gesagt hast und wie Franz die Neuigkeit aufgenommen hat.«
»Das weiß ich noch gar nicht.«
»Er hat offenbar gesagt: ›Dein Vater ist großartig. Ich möchte ihm gern ein gutes Bild aus Paris mitbringen.‹«
»Das höre ich gern.«
»Auch Johann scheint etwas glücklicher zu sein; obwohl er nicht sehr viel gesagt hat.«
»Er hat sich einige Dinge von der Seele geredet, einschließlich der Tatsache, daß er kein gläubiger Christ mehr ist…«
»Ach… Das ist aber traurig.«
»Es ist eine Entwicklungsphase, Liebling.« Mendelius bemühte sich, einen leichten Ton anzuschlagen. »Er will einen eigenen Weg zur Wahrheit finden.«
»Hoffentlich weiß er, daß du seinen Entschluß respektierst.«
»Natürlich! Du brauchst dir über Johann und mich keine Sorgen zu machen. Der alte Stier und der junge tragen eben ihre Scheingefechte miteinander aus.«
»Der alte Stier ist gut!« Lotte kicherte in der Dunkelheit. »Was ich noch sagen wollte: Wenn ich Hilde erwische, daß sie zu oft mir dir Händchen hält, kratze ich ihr die Augen aus!«
»Gut zu wissen, daß du noch eifersüchtig bist.«
»Ich liebe dich, Karl. Ich habe dich sehr lieb.«
»Und ich dich auch.«
»Mehr brauche ich nicht als Abschluß eines wunderschönen Tages. Gute Nacht, mein Liebster.«
Sie drehte sich um, rollte sich unter der Bettdecke ein und fiel rasch in tiefen Schlaf. Karl Mendelius verschränkte die Arme hinter dem Kopf und lag, den Blick zur Decke gerichtet, noch lange wach. Trotz aller Tröstungen der Liebe ging ihm noch immer im Kopf herum, was er beim Abendessen gehört hatte, und er mußte ständig an das Schreiben denken, das in dem Briefstapel an unterster Stelle gelegen hatte.
Es war in italienischer Sprache auf dickem Papier, in das der offizielle Briefkopf der Heiligen Glaubenskongregation eingeprägt war, mit der Hand geschrieben.
Sehr geehrter Herr Professor Mendelius,
wie ich von unserem gemeinsamen Freund, dem Rektor des Päpstlichen Bibelinstituts, erfahren habe, werden Sie in den nächsten Tagen Rom besuchen, um Ihrer wissenschaftlichen Forschungsarbeit nachzugehen und außerdem einige Vorträge an der Deutschen Akademie zu halten.
Ich habe ferner erfahren, daß Sie beabsichtigen, dem vor kurzem in den Ruhestand getretenen Papst im Kloster Monte Cassino einen Besuch abzustatten.
Da ich stets ein großer Bewunderer Ihrer wissenschaftlichen Arbeit war, würde es mich sehr freuen, Sie einmal vormittags in meinen Privatgemächern in der Vatikanstadt zu einer Tasse Kaffee begrüßen zu können.
Vielleicht haben Sie die Liebenswürdigkeit, mich zwischen sechzehn und neunzehn Uhr in der Kongregation anzurufen, damit wir einen uns beiden passenden Termin – vorzugsweise vor Ihrem Besuch in Monte Cassino – vereinbaren können.
Ich grüße Sie mit den besten Wünschen für einen angenehmen Aufenthalt in Rom.
Der Ihrige in Jesu Christo,
Anton Drexel
Kardinalpräfekt
Der Brief war glänzend gemacht: Er stellte eine Höflichkeitsgeste und gleichzeitig den unüberhörbaren Hinweis dar, daß nichts, absolut nichts, was in dem geheiligten Zirkel geschah, den Aufpassern des Herrn entging. In früheren Zeiten des Kirchenstaates hätte man ihm eine Vorladung und eine Abordnung von Gendarmen geschickt, um der Aufforderung Nachdruck zu verleihen. Jetzt hieß es Kaffee und Gebäck in den Gemächern des Kardinals und anschließend ein honigsüßes Gespräch.
Na ja! Tempora mutantur...! Er war gespannt, was dem Kardinalpräfekten mehr am Herzen lag: Informationen oder die Zusicherung äußerster Diskretion. Er fragte sich außerdem, welche Bedingungen man stellen würde, bevor er Jean Marie Barette aufsuchen durfte.