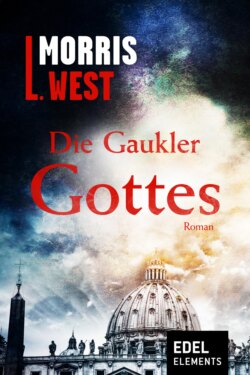Читать книгу Die Gaukler Gottes - Morris L. West - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
3
ОглавлениеHermann Frank war zu Recht stolz auf seine Ausstellung. Die Presse hatte mit Lob, Anerkennung und zahlreichen Bildwiedergaben nicht gespart. In den Wandelgängen der Akademie drängten sich die Besucher – Römer und Touristen –, und unter ihnen befand sich eine erstaunlich große Anzahl junger Leute.
Die Werke von Gaspar van Wittel, einem aus Amersfoort stammenden Niederländer des siebzehnten Jahrhunderts, waren der italienischen Öffentlichkeit nur wenig bekannt. Die meisten befanden sich in den Privatsammlungen der Colonna, Sacchetti, Pallavicini und anderer Adelsfamilien. Um sie zusammenzutragen, waren zwei Jahre geduldiger Suche und Monate schwieriger Verhandlungen nötig gewesen. Die Herkunft mancher Werke blieb immer noch ein streng gehütetes Geheimnis – im Katalog hieß es dann einfach »raccolta privata«. In ihrer Gesamtheit boten sie auf dem Gebiet von Malerei und Architektur ein außerordentlich lebendiges Bild der italienischen Verhältnisse des siebzehnten Jahrhunderts. Hermann Frank war auf eine geradezu rührende Art begeistert wie ein kleines Kind.
»Sieh dir das hier an. So zart und doch so exakt! In der Farbgebung fast japanisch. Ein großartiger Zeichner, ein Meister auch der kompliziertesten Perspektive… Schau dir diese Skizzen an… Mit welcher Geduld er die Komposition aufbaut… Merkwürdig, er lebte in einer dunklen, kleinen Villa draußen an der Via Appia antica. Das Haus steht noch. Man bekommt heute dort Platzangst. Aber damals waren da draußen nur Wiesen und Weiden, deshalb hatte er wahrscheinlich eine Menge Raum und Licht…« Er brach ab und meinte ein wenig verlegen: »Es tut mir leid, ich rede zuviel; aber ich liebe diese Dinge!«
Mendelius legte ihm sanft die Hand auf die Schulter:
»Mein Freund, es ist ein Vergnügen, dir zuzuhören. Sieh dir nur die vielen jungen Menschen an! Du hast sie aus ihren Ressentiments und ihren Wirrungen herausgehoben und sie in eine andere Welt versetzt – in eine schlichtere, schönere Welt, deren häßliche Seiten längst vergessen sind. Darauf kannst du stolz sein.«
»Das bin ich auch, Karl. Ich muß es zugeben. Aber ich fürchte den Tag, an dem man alle diese Bilder wieder abnimmt und die Packer kommen, um sie den Eigentümern wieder zuzustellen. Ich werde allmählich alt. Ich bin mir nicht sicher, ob ich die Zeit oder die Energie – oder das Glück, wenn du so willst – aufbringen werde, um noch einmal so etwas zu machen.«
»Aber versuchen wirst du es auf jeden Fall. Und nur darauf kommt es an.«
»Nicht mehr lange, fürchte ich. Ich gehe nächstes Jahr in den Ruhestand. Ich werde dann nicht wissen, was ich mit mir anfangen soll. Wir können es uns nicht leisten, hier weiterhin zu wohnen; und ich kann mich nicht mit dem Gedanken befreunden, nach Deutschland zurückzukehren.«
»Du könntest dich irgendwo als Schriftsteller niederlassen. Als Kunsthistoriker hast du dir längst einen Namen gemacht. Ich bin sicher, daß du einen besseren Verleger finden kannst, als du ihn bisher gehabt hast. Warum läßt du mich nicht einmal mit meinem Agenten sprechen, damit wir wissen, was er für dich tun kann?«
»Würdest du das wirklich?« Seine Dankbarkeit klang beinahe überschwenglich. »Geschäftliche Dinge sind mir fremd, und ich mache mir Sorgen wegen Hilde.«
»Ich rufe ihn an, sobald wir wieder zu Hause sind. Dabei fällt mir ein – kann ich einmal dein Telefon benutzen? Ich muß noch vor Mittag jemanden anrufen.«
»Komm mit in mein Büro! Ich lasse uns Kaffee bringen… Ach, bevor du gehst, mußt du dir unbedingt noch diese Tiberansicht ansehen. Es gibt von ihr drei Versionen: eine stammt aus der Sammlung Pallavicini, eine aus der Nationalgalerie und diese hier gehört einem alten Ingenieur, der sie für einen Pappenstiel auf dem Flohmarkt gekauft hat…«
Es dauerte noch etwa fünfzehn Minuten, bis Mendelius Gelegenheit hatte, das Kloster Monte Cassino anzurufen. Dann dauerte es noch eine schier unendlich lange Zeit, bis der Abt an den Apparat gerufen werden konnte. Mendelius war wütend, aber schließlich sagte er sich, daß Klöster dazu da seien, Menschen von der Welt abzusondern, statt sie mit ihr zu verbinden. Der Abt war liebenswürdig, aber zurückhaltend.
»Professor Mendelius? Hier spricht Abt Andreas. Wie nett von Ihnen, so prompt anzurufen. Wäre es Ihnen möglich, Ihren Besuch für den kommenden Mittwoch einzuplanen? Er ist bei uns ein Festtag, so daß wir Ihnen eine etwas großzügigere Gastfreundschaft werden bieten können. Ich schlage vor, Sie kommen gegen halb vier und bleiben zum Abendessen da. Es ist eine lange Fahrt von Rom hierher; wenn Sie über Nacht bleiben möchten, werden wir Sie gern bei uns unterbringen.«
»Das ist sehr freundlich von Ihnen. Ich übernachte dann bei Ihnen und fahre erst am Donnerstag früh wieder zurück. Wie geht es meinem Freund Jean?«
»Er fühlt sich nicht ganz wohl; aber ich hoffe, daß er sich bis zu Ihrem Besuch wieder erholt hat. Er freut sich auf das Wiedersehen mit Ihnen.«
»Grüßen Sie ihn herzlich von mir, und sagen Sie ihm, daß auch meine Frau ihm ihre besten Empfehlungen übermitteln läßt.«
»Das werde ich mit Vergnügen tun. Also dann bis Mittwoch, Professor.«
»Ich danke Ihnen, Herr Abt.«
Mendelius legte auf und saß einen Augenblick gedankenverloren da. Da war es wieder: Man gab ihm eine höfliche Antwort, blieb aber auf der Hut. Bis Mittwoch war es noch eine Woche – genügend Zeit, die Einladung abzusagen, falls sich die Lage ändern oder falls die Kurie intervenieren sollte. Jean Maries Erkrankung, mochte sie nun echt oder diplomatischen Ursprungs sein, würde einen passenden Grund liefern.
»Stimmt etwas nicht, Karl?« Hermann setzte das Kaffeetablett ab und begann mit dem Einschenken.
»Ich bin mir nicht ganz sicher. Der Vatikan scheint sich nicht unerheblich für mein Tun und Lassen zu interessieren.«
»Das halte ich für ganz natürlich. Du hast ihnen in der Vergangenheit allerlei Kopfschmerzen bereitet; und bei jedem neuen Buch geht es im Vatikan zu wie in einem Taubenschlag… Milch und Zucker?«
»Keinen Zucker. Ich versuche abzunehmen.«
»Das habe ich gemerkt. Mir ist außerdem aufgefallen, daß es dir gestern abend anscheinend hauptsächlich darauf ankam, mehr über Gregor XVII. zu erfahren.«
»Ist es so auffällig gewesen?«
»Nur für mich, glaube ich. Hast du einen besonderen Grund für dein Interesse?«
»Er war mein Freund. Das weißt du doch. Ich wollte gern in Erfahrung bringen, was tatsächlich zu seiner Abdankung geführt hat.«
»Hat er es dir denn nicht selbst gesagt?«
»Ich hatte seit Monaten nichts mehr von ihm gehört.« Mendelius drückte sich vorsichtig aus. »Ich könnte mir vorstellen, daß er für Privatbriefe nicht viel Zeit gehabt hat.«
»Aber du wirst ihn doch treffen, solange du hier bist?«
»Ein Wiedersehen ist verabredet. Ja.«
Die Antwort klang eine Idee zu kurz. Hermann Frank besaß zuviel Takt, um bei diesem Thema zu bleiben. Einen Augenblick herrschte verlegenes Schweigen; dann sagte er leise:
»Etwas beunruhigt mich, Karl. Ich würde gern wissen, was du davon hältst.«
»Worum geht es, Hermann?«
»Vor etwa einem Monat wurde ich in unsere Botschaft gerufen. Der Botschafter wolle mit mir sprechen. Er zeigte mir einen Brief aus Bonn: einen Runderlaß, der an alle Akademien und Institute im Ausland gerichtet war. Viele haben wertvolle Leihgaben der jeweiligen Gastländer: Skulpturen, Gemälde, Manuskripte von historischem Wert, solche Sachen… Alle Direktoren wurden angewiesen, geheime Aufbewahrungsorte in ihrem Gastland vorzubereiten, wo diese Dinge im Falle innerer Unruhen oder eines internationalen Konflikts ausgelagert werden könnten. Wir erhielten außerdem alle eine sofort verfügbare Mittelzuweisung, um geeigneten Lagerraum zu kaufen oder anzumieten.«
»Das klingt wie eine vernünftige Vorsichtsmaßnahme«, meinte Mendelius in ruhigem Ton. »Dies um so mehr, als man sich gegen Krieg oder innere Unruhen nicht versichern kann.«
»Du verstehst nicht, was ich meine.« Hermann Frank betonte jedes Wort. »Es war der Ton, der mich beunruhigte. Die Weisung wurde als besonders dringlich hingestellt und für den Fall der Nichtausführung wurden erhebliche Konsequenzen angedroht. Ich habe den Eindruck gewonnen, daß sich unsere Leute zu Hause ernsthafte Sorgen machen, daß irgend etwas Schreckliches in naher Zukunft passieren könnte.«
»Besitzt du eine Kopie dieses Erlasses?«
»Nein. Der Botschafter bestand darauf, daß der Text die Botschaft nicht verlassen dürfe. Ach ja, und noch etwas anderes. Der Inhalt darf nur dem engsten Mitarbeiterkreis bekanntgegeben werden. Mir kam das Ganze ziemlich unheimlich vor – auch jetzt noch. Ich weiß, ich mache mir oft unnötige Sorgen; aber ich denke dauernd an Hilde und was ihr zustoßen könnte, falls wir in einer Krisensituation voneinander getrennt würden. Ich möchte deine ehrliche Meinung hören, Karl.«
Mendelius war einen Augenblick versucht, ihn mit einigen beruhigenden Worten abzuspeisen; aber dann besann er sich eines Besseren. Hermann Frank war ein guter Mensch, vielleicht etwas zu weich für diese schlechte Welt. Er hatte eine nüchterne und ehrliche Antwort verdient.
»Die Dinge stehen nicht zum besten, Hermann. Wir befinden uns noch nicht auf Tauchstation, aber das kann schon sehr bald der Fall sein. Vieles weist darauf hin: die Zerrüttung von Ruhe und Ordnung, der Zusammenbruch des politischen Vertrauens, die schwere Rezession – und die Narren an höchsten Stellen, die glauben, sie könnten das Problem durch einen zeitlich und räumlich begrenzten Krieg lösen. Du machst dir deine Sorgen mit Recht. Was du tun kannst, ist eine andere Frage. Sobald erst einmal die ersten Raketen in der Luft sind, gibt es nirgends mehr ein sicheres Versteck. Hast du mit Hilde darüber gesprochen?«
»Ja. Sie will nicht nach Deutschland zurück, aber auch sie meint, wir sollten uns darauf einstellen, Rom zu verlassen. Wir haben ein kleines Bauernhaus in den Toskaner Bergen. Es liegt ganz für sich, und der Boden rund herum ist sehr fruchtbar. Wir könnten meines Erachtens mit dem überleben, was wir selbst anbauen… Aber es scheint mir ein Akt der Verzweiflung zu sein, so etwas überhaupt in Erwägung zu ziehen.«
»Oder ein Akt der Hoffnung«, sagte Mendelius sanft. »Ich finde, deine Hilde ist eine sehr kluge Frau, und du solltest dich nicht so um sie ängstigen. Frauen sind bessere Lebenskünstler als wir Männer.«
»Damit magst du recht haben. So habe ich die Sache noch nie betrachtet… Wünschst du dir nicht auch manchmal, daß wir einen bedeutenden Mann finden könnten, der die Lage in die Hand nimmt und uns aus dem Schlamassel herausführt?«
»Nie!« sagte Karl Mendelius mit tiefem Ernst. »Große Männer sind gefährlich. Wenn ihre Träume zerrinnen, begraben sie sie unter dem Schutt von Städten, in denen das einfache Volk vorher friedlich gelebt hat!«
»Ich will Ihnen gegenüber ganz offen sein, Mendelius. Und ich möchte, daß auch Sie ganz offen mit mir sprechen.«
»Wie offen, Eminenz? Und über welches Thema?«
Die Höflichkeitsfloskeln waren jetzt vorbei. Das süße Gebäck war aufgegessen. Der Kaffee war kalt. Seine Eminenz Anton Kardinal Drexel, ergraut und kerzengerade aufgerichtet, stand, den Rücken seinem Besucher zugekehrt, am Fenster und schaute auf die im Sonnenschein liegenden Gärten des Vatikans. Er drehte sich langsam um und blieb noch einen Augenblick als gesichtslose Silhouette stehen. Mendelius sagte:
»Bitte, Eminenz, warum setzen Sie sich nicht? Ich möchte Ihr Gesicht sehen, während wir uns unterhalten.«
»Verzeihen Sie mir.« Drexel ließ ein tiefes Brummen hören. »Es ist ein alter Trick – und kein sehr höflicher… Ist es Ihnen lieber, wenn wir deutsch sprechen?«
Trotz seines Namens war Drexel Italiener; er stammte aber aus Bozen, aus einem Gebiet, das lange ein Zankapfel zwischen Österreich und der italienischen Republik gewesen war. Mendelius hob die Schultern.
»Wie es Eurer Eminenz beliebt.«
»Dann also italienisch. Ich spreche das Deutsch mit Tiroler Akzent. Sie könnten es komisch finden.«
»In der Muttersprache drückt man sich meistens am ehrlichsten aus«, meinte Mendelius trocken. »Wenn mich mein Italienisch im Stich läßt, werde ich deutsch sprechen.«
Drexel trat vom Fenster zurück und setzte sich Mendelius gegenüber hin. Er brachte die Falten seiner Soutane über den Knien mit Bedacht in Ordnung. Sein immer noch gutaussehendes, zerfurchtes Gesicht hätte aus Holz geschnitzt sein können.
Nur in seinen Augen war Leben; sie waren von einem lebhaften Blau und wirkten trotz aller Bedachtsamkeit fast etwas belustigt. Er sagte:
»Sie waren immer ein hartnäckiger Mensch.« Er benutzte den Ausdruck aus der Umgangssprache ›un tipo robusto‹. Mendelius lächelte über das zweifelhafte Kompliment. »So, und jetzt sagen Sie mir: Was wissen Sie über die Ereignisse, die sich hier vor kurzem abgespielt haben?«
»Bevor ich hierauf eine Antwort gebe, Eminenz, möchte ich von Ihnen eine Antwort auf folgende Frage erhalten: Beabsichtigen Sie, meiner Kontaktaufnahme mit Jean Marie ein Hindernis in den Weg zu legen?«
»Ich? Keineswegs.«
»Jemand anders, soviel Ihnen bekannt ist?«
»Nach allem, was ich weiß – niemand; obwohl offenbar ein Interesse an der Begegnung besteht.«
»Ich danke Ihnen, Eminenz. Und jetzt die Antwort auf Ihre Frage: Ich weiß, daß Papst Gregor zur Abdankung gezwungen wurde. Ich weiß, welche Mittel angewandt wurden, um ihn zu diesem Entschluß zu bringen.«
»Und zwar?«
»Sieben ärztliche Gutachten, die von der Kurie zu einem Schlußurteil zusammengefaßt wurden, und zwar mit dem Ziel, schwere Bedenken hinsichtlich der geistigen Zurechnungsfähigkeit Seiner Heiligkeit aufkommen zu lassen… Ist dies korrekt?«
Drexel zögerte kurz und nickte dann zustimmend.
»Ja, das ist korrekt. Was wissen Sie von der Rolle, die ich persönlich bei dieser Angelegenheit gespielt habe?«
»Soviel ich weiß, Eminenz, haben Sie die Entscheidung des Heiligen Kollegiums zwar mißbilligt, sich aber bereit erklärt, diese dem Papst zu übermitteln.«
»Ist Ihnen bekannt, warum das Heilige Kollegium zu diesem Entschluß kam?«
»Ja.«
Aus Drexels Blick sprach ein Anflug von Zweifel, aber er fuhr, ohne zu zögern, fort:
»Sind Sie mit dem Entschluß einverstanden oder nicht?«
»Ich halte die angewandten Mittel für gemein: glatte Erpressung. Und hinsichtlich des Entschlusses selbst befinde ich mich in einem Dilemma.«
»Und wie würden Sie dieses Dilemma definieren, mein Freund?«
»Der Papst wird zum obersten Hirten und Hüter des Glaubens gewählt. Läßt sich dieses Amt mit der Rolle des Propheten vereinbaren, der eine persönliche Offenbarung verkündet, auch wenn diese Offenbarung wahr sein sollte?«
»Sie sind also im Bilde«, sagte der Kardinalpräfekt leise. »Und Sie zeigen glücklicherweise Verständnis.«
»Und wo stehen wir jetzt, Eminenz?« fragte Mendelius.
»Vor dem zweiten Dilemma: Wie können wir beweisen, ob die Offenbarung wahr oder falsch ist?«
»Eminenz, Ihre Kollegen haben dieses Problem bereits gelöst«, sagte Mendelius in sarkastischem Ton. »Sie haben ihn für verrückt erklärt.«
»Ich nicht«, erklärte Anton Kardinal Drexel ruhig. »Ich glaubte und glaube es auch jetzt noch, daß seine Stellung als Papst unhaltbar geworden war. Angesichts einer so starken Opposition hätte er seinen Amtspflichten nicht mehr gerecht werden können. Aber verrückt? Nie und nimmer!«
»Also ein verlogener Prophet?«
Zum erstenmal ließ Drexels maskenhaftes Gesicht seine innere Erregung ahnen.
»Das ist ein fürchterlicher Gedanke!«
»Er bat mich, ein Urteil über ihn abzugeben, Eminenz. Ich mußte jeden nur möglichen Spruch in Erwägung ziehen.«
»Er ist kein Lügner.«
»Halten Sie eine Sinnestäuschung für möglich?«
»Ich würde gern daran glauben. Alles wäre dann viel einfacher. Aber ich kann es nicht; ich kann es einfach nicht.«
Plötzlich sah er aus wie ein alter Löwe, dessen Kraft allmählich schwindet. Mendelius spürte beinahe einen Anflug von Mitgefühl. Aber er konnte mit seiner Inquisition jetzt nicht erlahmen. Er fragte mit fester Stimme:
»Wie haben Sie ihn geprüft, Eminenz? Nach welchen Kriterien?«
»Nach den einzigen, die ich kenne: nach seinen Reden, seinem Verhalten, seinen Schriften, dem Tenor seines geistlichen Lebens.«
Mendelius lächelte:
»Hier spricht der Großinquisitor.«
Drexel verzog das Gesicht zu einem grimmigen Lächeln.
»Die alten Wunden tun wohl noch immer weh, wie? Ich gebe zu, daß wir es Ihnen nicht leichtgemacht haben. Jedenfalls haben wir Sie gelehrt, unsere Methode zu begreifen. Was wollen Sie zuerst wissen?«
»Es waren seine Schriften, die schließlich zu seiner Verurteilung führten. Ich besitze ein Exemplar der Enzyklika. Was haben Sie bei ihrer Lektüre empfunden, Eminenz?«
»Böse Vorahnungen. Ich hatte keinen Zweifel, daß die Enzyklika unterdrückt werden müsse. Aber ich stimme Ihnen sofern zu, daß sie nichts, absolut nichts, enthält, das der gültigen Lehre zuwiderliefe. Es gibt einige Auslegungen, die man vielleicht für extrem halten könnte, aber sie sind gewiß nicht heterodox. Auch die Frage, ob Geistliche in ihr Amt gewählt werden können, wenn die Priesterweihe durch einen Bischof ausscheidet, ist ein ungelöstes Problem – für römische Ohren ein heikles Thema.«
»Was uns zum Tenor seiner geistlichen Existenz bringt.« In Mendelius’ Stimme lag ein leichter ironischer Unterton. »Wie denken Sie darüber, Eminenz?«
Zum erstenmal hellte sich Drexels verhärtetes Gesicht zu einem kleinen Lächeln auf.
»Er schnitt dabei besser ab als Sie, mein lieber Mendelius. Er blieb seiner Berufung als Priester treu. Er war ein völlig selbstloser Mann, dessen Gedanken nur auf das Wohl der Kirche und die Rettung der Menschenseele gerichtet waren. Er war Herr seiner Leidenschaften. In seinem hohen Amte blieb er demütig und gütig. Sein Zorn richtete sich immer gegen die Bosheit, nie gegen menschliche Schwächen. Auch zum Schluß begehrte er nicht gegen seine Ankläger auf, sondern ging mit Würde, und er nahm die Rolle des Untertans ohne Klage hin. Wie mir der Abt berichtet hat, führt er in Monte Cassino ein Leben in vorbildlicher religiöser Schlichtheit.«
»Außerdem ist er verstummt. Wie vereinbart sich dies mit der von ihm immer wieder betonten Verpflichtung, die Botschaft von der Wiederkunft Christi zu verkünden?«
»Bevor ich darauf antworte«, sagte Drexel, »sollten wir meines Erachtens noch eine andere Frage klären. Offenbar hat er Ihnen geschrieben und Ihnen eine Ausfertigung der unveröffentlichten Enzyklika zugeschickt. Stimmt das?«
»Es stimmt.«
»War dies vor oder nach seiner Abdankung?«
»Er schrieb den Text vorher. Ich erhielt ihn nach der Abdankung.«
»Gut! Jetzt möchte ich Ihnen etwas sagen, was Sie noch nicht wissen. Als meine Kardinalskollegen Gregors Bereitschaft abzudanken erreicht hatten, waren sie überzeugt, ihn gebrochen zu haben und daß er alles tun würde, was sie von ihm verlangten. Zunächst versuchten sie, in die Abdankungsurkunde einen Passus aufzunehmen, der Gregor zu ewigem Schweigen über alle das öffentliche Leben der Kirche berührenden Themen verpflichtet hätte. Ich sagte ihnen, dazu seien sie weder moralisch noch rechtlich befugt. Wenn sie darauf beharrten, würde ich sie bis zum Tode bekämpfen. Ich würde mein Amt niederlegen und über die ganze traurige Affäre eine öffentliche Erklärung abgeben. Dann versuchten sie es mit einem anderen Trick. Seine Heiligkeit hatte sich bereit erklärt, in den Benediktinerorden einzutreten. Deshalb würde er der Gehorsamspflicht gegenüber seinem Oberen unterliegen. Sie würden also, sagten meine schlauen Kollegen, dem Abt die Weisung erteilen, Gregor unter dem Gehorsamsgelübde zum Schweigen zu verpflichten.«
»Das kenne ich«, sagte Karl Mendelius in kaltem Zorn. »Gehorsam des Geistes! Einem aufrechten Mann kann man nichts Schlimmeres auferlegen. Jede Tyrannei auf der Welt hat dieses Prinzip von uns gelernt.«
»Ich war also entschlossen«, fuhr Drexel ruhig fort, »zu verhindern, daß unserem Freund eine solche Verpflichtung auferlegt wurde. Ich wies darauf hin, daß dies ein unerträglicher Eingriff in das Recht jedes Menschen sei, frei nach seinem Gewissen handeln zu können, daß auch das strengste Gelübde ihn nicht zwingen könne, ein Unrecht zu begehen oder sein Gewissen im Namen Gottes mundtot zu machen. Noch einmal drohte ich mit einer Bloßstellung. Ich warf meine Stimme im bevorstehenden Konklave in die Waagschale und wies Abt Andreas darauf hin, daß auch er unter allen Bedingungen gehalten sei, die Gewissensfreiheit seines neuen Mönches zu schützen.«
»Ich bin glücklich, das zu hören, Eminenz.« Mendelius sprach ernst und ehrerbietig. »Es ist der erste Lichtstrahl, den ich in dieser dunklen Affäre erblicke. Aber es ist noch keine Antwort auf meine Frage: Warum schweigt Jean Marie? Sowohl in seinem Brief an mich als auch in der Enzyklika spricht er von seiner Verpflichtung, die Botschaft zu verkünden, die ihm zuteil geworden sei.«
Drexel antwortete nicht sogleich. Langsam, beinahe mühsam erhob er sich aus seinem Sessel, ging zum Fenster, blieb dort stehen und blickte auf den Garten. Als er sich schließlich umwandte, lag sein Gesicht im Schatten, so wie zuvor; aber Mendelius erhob keinen Einwand. Die innere Not dieses Mannes kam in seiner Stimme allzu deutlich zum Ausdruck.
»Der Grund ist meines Erachtens der, daß er jetzt die Erfahrung aller großen Mystiker durchlebt: die sogenannte ›dunkle Nacht der Seele‹. Es ist eine Periode äußerster Finsternis, tiefster Verwirrung, die in Verzweiflung übergehen kann, da die Seele jeglicher Hilfe, menschlicher oder göttlicher, beraubt zu sein scheint. Es ist wie eine Wiederholung jenes schrecklichen Augenblicks, als Christus selbst ausrief: ›Mein Gott, warum hast du mich verlassen?‹… So sieht es aus, nach dem, was ich von Abt Andreas erfahren habe. Aus diesem Grunde wollte er und wollte auch ich mit Ihnen sprechen, bevor Sie Ihren Freund wiedersehen... Wissen Sie, Mendelius, ich habe meines Erachtens bei ihm versagt, denn ich versuchte, zwischen den Forderungen des Heiligen Geistes und den Ansprüchen des Systems, dem ich auf Lebenszeit verpflichtet bin, einen Kompromiß zu schließen… Ich hoffe bei Gott, daß Sie sich als besserer Freund erweisen werden, als ich es war.«
»Sie bezeichnen ihn als Mystiker, Eminenz. Damit geben Sie zu erkennen, daß Sie an sein mystisches Erlebnis glauben«, sagte Mendelius. »So weit bin ich noch nicht, so sehr ich ihn liebe.«
»Ich hoffe, Sie werden ihm das sagen, bevor Sie ihm die erste Frage stellen… Vielleicht sind Sie so liebenswürdig, mich anzurufen, nachdem Sie mit ihm gesprochen haben?«
»Das verspreche ich Ihnen, Eminenz.« Mendelius erhob sich. »Ich danke Ihnen, daß Sie mich hierher eingeladen haben. Ich hoffe, Sie werden mir verzeihen, falls ich anfangs einen unhöflichen Eindruck gemacht haben sollte.«
»Sie waren nicht unhöflich, nur schwierig.« Der Kardinal lächelte und hielt ihm die Hand hin. »In den alten Tagen waren Sie weniger vernünftig. Die Ehe muß Ihnen gutgetan haben.«
Lotte und Hilde waren zum Mittagessen nach Tivoli hinausgefahren, so daß er sich zu einem ungestörten Mahl auf der Piazza Navona entschloß. Als er den Vatikan verließ, war es ein Viertel vor zwölf; er beschloß, die kurze Strecke zu Fuß zu gehen. Auf der Via della Conciliazione blieb er auf halbem Wege stehen, um sich umzudrehen und die großartige Peterskirche mit ihren Kolonnaden zu betrachten, die als Symbol der allumfassenden Mission der Kirche galt.
Für eine halbe Milliarde Gläubige lag hier der Mittelpunkt der Welt, die Wohnstätte des Stellvertreters Christi, das Grab des heiligen Petrus. Was würde mit dieser halben Milliarde geschehen, falls dieses sichtbare Symbol der Einheit und Autorität der Kirche durch Kriegsereignisse zerstört würde?
Es war für diese Gläubigen seit langem selbstverständlich, diesen alten Bau für den Nabel der Welt zu halten – den Papst als einzigen, authentischen Abgesandten Gottes zu den Menschen. Es waren keine nichtssagenden Fragen. Solche Möglichkeiten bestanden durchaus – für Jean Marie Barette, für Anton Kardinal Drexel und für Karl Mendelius, der die apokalyptischen Schriften auswendig kannte und jede Zeile davon in der Tagespresse wiederholt sah. Drexel, der alte, noch immer mächtige, aber seiner Unerschütterlichkeit beraubte Mann, tat ihm leid. Sie taten ihm alle leid; die Kardinäle, Bischöfe und Kleriker der Kurie, die sich bemühten, den Codex Iuris Canonicus auf einen wahnsinnig gewordenen Planeten anzuwenden, der sich selbst ins Unglück stürzte.
Er wandte sich ab und schlenderte langsam durch die Schar der Pilger, über die Vittorio-Emanuele-Brücke und den Corso Vittorio Emanuele entlang. Bald fand er ein Straßencafé, setzte sich hin und bestellte einen Campari, während er interessiert der vorbeiziehenden Menschenmenge zusah.
Dies war die schönste Jahreszeit in Rom: Die Luft war mild, die Blumen an den Verkaufsständen strahlten vor Frische, die Mädchen führten ihre neuen Sommerkleider vor und die Läden waren voll von buntem Tand für die Touristen. Ihm fiel eine junge Frau auf, die ein paar Schritte weiter links an der Bordsteinkante stand. Sie trug dunkelblaue Hosen und eine weiße Seidenbluse, die ihren üppigen Busen voll zur Geltung brachte. Ihre schwarzen Haare waren hinten mit einem roten Tuch zusammengehalten. Sie sah wie eine Südländerin aus; mit ihrem dunklen Teint und dem ruhigen Madonnengesicht war sie eine auffallende Schönheit. In der einen Hand trug sie eine zusammengefaltete Zeitung und in der anderen eine kleine Handtasche aus blauem Leder. Sie schien auf jemanden zu warten.
Während er sie noch ansah, schob sich ein kleiner roter Alfa Romeo rückwärts in die Parklücke neben ihr. Der Fahrer ließ den Wagen so stehen, daß er jederzeit wieder abfahren konnte. Er öffnete die Tür und lehnte sich heraus, um mit der Frau zu sprechen. Einen Augenblick sah es so aus, als suche er ein leichtes Mädchen; aber die Angesprochene reagierte ohne Protest. Sie gab dem Fahrer ihre Handtasche und wandte sich, die Zeitung noch in der Hand, wieder zum Gehsteig um. Der Fahrer hielt die Tür geöffnet und wartete mit laufendem Motor.
Kurz darauf kam ein elegant gekleideter Mann, der eine Aktentasche trug, mit raschen Schritten den Corso entlang. Das Mädchen trat vor, lächelte und sprach ihn an. Er blieb stehen. Er schien überrascht zu sein, nickte dann aber und sagte etwas, was Mendelius nicht hören konnte. Das Mädchen schoß ihn dreimal in den Bauch, warf die Zeitung in den Rinnstein und sprang in den Wagen, der mit aufheulendem Motor davonfuhr.
Einen kurzen Augenblick blieb Mendelius wie gelähmt sitzen; dann stürzte er sich auf das vor ihm liegende Opfer und drückte ihm die Faust in die Leistengegend, um das aus der Arterie herausströmende Blut zu stoppen.
Er kniete noch dort, als die Polizei und die Sanitäter sich durch die Menschenmenge drängten, um den Mann zu versorgen.
Ein Polizist trieb die Schaulustigen und Fotografen auseinander. Ein Straßenfeger säuberte das Pflaster vom Blut. Ein Kriminalbeamter in Zivil schob Mendelius eiligst in das Café. Ein Kellner brachte heißes Wasser und saubere Servietten, um ihm den blutbefleckten Anzug zu säubern. Der Geschäftsinhaber bot ihm auf Kosten des Hauses einen großen Whisky an. Mendelius nahm dankbar ein paar Schlucke, während er seine erste Aussage machte. Der Untersuchungsbeamte, ein junger Mann aus Mailand, gab die Aussage sofort telefonisch an die Zentrale weiter. Dann kam er wieder zu Mendelius an den Tisch und bestellte auch für sich einen Whisky.
»… Sie haben uns sehr geholfen, Professor. Die detaillierte Personenbeschreibung der Täterin ist für uns in dieser frühen Phase sehr nützlich... Ich fürchte jedoch, daß ich Sie bitten muß, ins Präsidium zu kommen, damit Sie sich einige Fotos ansehen und vielleicht auch einem Zeichner bei der Anfertigung eines Phantombildes helfen können.«
»Natürlich. Aber ich möchte es gern heute nachmittag tun, wenn es geht. Wie ich schon sagte, habe ich verschiedene Termine einzuhalten.«
»Schön. Ich bringe Sie hin, wenn wir ausgetrunken haben.«
»Wer war das Opfer?« fragte Mendelius.
»Er heißt Malagordo. Er ist Senator, Sozialist und jüdischer Abstammung... Ein schmutziges Geschäft, und das wird von Woche zu Woche schlimmer.«
»Es ist so sinnlos – ein barbarischer Willkürakt.«
»Willkür: ja; aber sinnlos: nein! Diese Menschen sind eingefleischte Anarchisten und streben den völligen Zusammenbruch des gegenwärtigen Systems durch die Erschütterung des öffentlichen Vertrauens an… Und wir sind diesem Zustand schon sehr nahe gekommen. Sie werden es mir vielleicht nicht glauben, Professor. Mindestens zwanzig weitere Personen haben den Überfall heute gesehen; aber ich wette ein Monatsgehalt, daß Ihre Aussage die einzige bleiben wird, die uns etwas Konkretes sagt… und dabei sind Sie Ausländer! Die anderen müssen in diesem Saustall leben, rühren aber keinen Finger, um Ordnung zu schaffen.« Er zuckte resigniert mit den Achseln. »Die Leute kriegen also das Land, das sie verdienen… Dabei fällt mir ein – Sie müssen damit rechnen, daß Ihr Bild in allen Zeitungen erscheint.«
»Das ist das letzte, was ich brauche«, meinte Mendelius.
»Es könnte auch gefährlich für Sie sein«, sagte der Kriminalbeamte. »Sie sind dann als wichtiger Zeuge identifiziert.«
»Und ein eventuelles weiteres Ziel. Wollen Sie das damit sagen?«
»Ich fürchte, ja, Professor. Es geht hier um Propaganda – verstehen Sie? Die Leute erschießen denjenigen, der im Rampenlicht steht. Das Mädchen im Fahrkartenschalter ist für die Öffentlichkeit uninteressant… Wenn ich Ihnen raten darf, dann verlassen Sie Rom und möglichst auch Italien.«
»Das kann ich frühestens in einer Woche tun.«
»Aber so bald wie möglich. Ziehen Sie inzwischen um. Nehmen Sie sich ein Zimmer in einem der großen Touristenhotels. Verwenden Sie einen anderen Namen. Ich werde das Problem mit dem Reisepaß in der Zentrale regeln.«
»Das würde nicht viel helfen. Ich soll Vorträge an der Deutschen Akademie halten. Ich bleibe also exponiert.«
»Was kann ich Ihnen sonst noch sagen?« Der Kriminalbeamte hob die Schultern und grinste. »Seien Sie auf alle Fälle vorsichtig, ändern Sie Ihre Routine und sprechen Sie keine hübschen Mädchen auf dem Corso an!«
»Gibt es keine Möglichkeit, Polizeischutz zu bekommen, wenigstens für meine Frau?«
»Aussichtslos. Wir haben nicht genug Personal. Ich kann Ihnen die Adresse einer Agentur geben, die Leibwächter vermietet; aber sie verlangt astronomische Honorare.«
»Kommt nicht in Frage!« sagte Mendelius. »Kommen Sie, wir wollen uns Ihre Fotos ansehen.«
Bei der Fahrt durch das mittägliche Verkehrschaos nahm er noch den Blutgeruch auf seinem Anzug wahr. Er hoffte, daß Lotte in Tivoli ein schönes Mittagessen hatte. Er wollte, daß sie diese Ferientage wirklich genoß; vielleicht würde es in der Zukunft nicht mehr allzu viele geben.
Im Laufe des Nachmittags saß er, während er auf die Rückkehr von Lotte und Hilde wartete, auf der Terrasse und sprach ein an Anneliese Meißner gerichtetes Memorandum auf Band. Er hielt die neuen Tatsachen fest, die er von Georg Rainer und Kardinal Drexel erfahren hatte, und setzte dann seine eigene Stellungnahme hinzu.
… Rainer ist ein vernünftiger und objektiver Berichterstatter. Sein ärztliches Gutachten, wenn es auch aus zweiter Hand stammt, hat sich als zuverlässig erwiesen. Jean Marie Barette stand offenbar unter einem schweren geistigen und körperlichen Streß. Außerdem bestand hinsichtlich seiner Unzurechnungsfähigkeit keine einhellige Meinung… Wie Rainer es ausdrückte: »Hätten sie ihn behalten wollen, wäre das mindeste, was er gebraucht hätte, eine Ruhepause und eine Verringerung seiner täglichen Arbeitslast gewesen.«
Kardinal Drexels Standpunkt überraschte mich. Sie wissen, daß ich selbst lange Zeit der Inquisition ausgesetzt war und ihn als glänzenden und unnachgiebigen Dialektiker kennengelernt habe. Aber auch bei unseren schärfsten Auseinandersetzungen hatte ich nie den geringsten Zweifel an seiner Aufrichtigkeit. Es wäre mir ein himmlisches Vergnügen, Sie und ihn in einer öffentlichen Diskussion aufeinanderprallen zu sehen. Das gäbe ein großartiges Spektakel. Er weist jeden Gedanken an Geistesgestörtheit oder eine bewußte Täuschung bei Jean Marie weit von sich. Er geht noch weiter und ordnet ihn den Mystikern zu wie Theresia von Avila, Johannes vom Kreuz und Katharina von Siena. Aus Andeutungen konnte ich entnehmen, daß Drexel sich – wenn auch nicht expressis verbis – zur Glaubwürdigkeit von Jean Maries visionärem Erlebnis bekennt. So bin ich jetzt derjenige, der als Skeptiker oder doch zum mindesten als Agnostiker gelten muß…
Ich werde Jean Marie am Mittwoch und Donnerstag nächster Woche sehen und meiner Beisitzerin anschließend berichten. Morgen halte ich meinen ersten Vortrag in der Akademie. Ich freue mich darauf. Die evangelischen Christen sind sehr interessant. Ich bewundere ihre Lebensanschauung. Und Tübingen ist sowieso immer ein Mittelpunkt pietistischer Tradition gewesen, die einen so gewaltigen Einfluß in England und den Vereinigten Staaten ausgeübt hat... Aber ich habe vergessen – auf diesem Ohr sind Sie ja stocktaub... Nichtsdestoweniger habe ich Vertrauen zu Ihnen und bin froh, daß Sie meine Beisitzerin sind. Meine herzlichsten Grüße aus dieser wunderschönen, aber jetzt ziemlich unheimlichen Stadt.
Auf Wiedersehen.
Die Zuhörer hatten bereits ihre Plätze eingenommen, als er das Auditorium betrat – einige Dutzend protestantische Pfarrer, die meisten Anfang Dreißig, ein Dutzend Ehefrauen, drei Diakonissinnen und ein halbes Dutzend Gäste, die Hermann Frank aus der in Rom ansässigen Waldensergemeinde eingeladen hatte. Karl Mendelius fühlte sich bei ihnen zu Hause. Die theologische Fakultät in Tübingen war zu einer Vorkämpferin der pietistischen Bewegung in der evangelischen Kirche geworden; und Mendelius fühlte sich persönlich von dem Umstand angezogen, daß man in diesen Kreisen besonderen Wert auf persönliche Frömmigkeit und Werke der Nächstenliebe legte. Er hatte einmal eine längere Abhandlung über den Einfluß von Philipp Jakob Spener und dessen Erbauungszirkel geschrieben, die dieser im siebzehnten Jahrhundert in Frankfurt und Dresden gegründet hatte.
Als Hermann Frank seine Einführung beendet hatte und der Beifall abgeklungen war, legte Mendelius seine Papiere auf das Pult und begann seinen Vortrag. Er sprach gelöst und zwanglos:
»Ich will Ihnen keine Vorlesung halten. Mir wäre es lieber, wenn Sie einverstanden sind, unser Thema in Form eines sokratischen Dialogs abzuhandeln, damit wir erkennen, was wir einander zu sagen haben und was die historischen Unterlagen uns allen bieten können… Allgemein ausgedrückt behandeln wir ein Thema der Eschatologie, der Lehre von den Letzten Dingen: der Bestimmung des Menschen, der Gesellschaftsformen und der gesamten kosmischen Ordnung. Wir wollen diese Dinge im Licht des Alten und des Neuen Testaments sowie der frühesten christlichen Überlieferungen betrachten…
Es gibt zwei Wege, die Lehre von den Letzten Dingen zu betrachten. Beide unterscheiden sich radikal voneinander. Der erste ist, wie ich ihn formulieren möchte, der ›Blickpunkt der Vollendung‹. Die Geschichte der Menschheit wird enden. Christus wird ein zweites Mal kommen, um die Lebenden und die Toten zu richten. Der zweite Weg beruht auf einem modifizierten Standpunkt. Die Schöpfung bleibt, aber sie wird modifiziert vom Menschen, der in Übereinstimmung mit seinem Schöpfer in Richtung auf Erfüllung oder Vervollkommnung tätig wird, was nur durch Symbole oder Analogien ausgedrückt werden kann. Nach dieser Auffassung ist Christus allgegenwärtig, und in der Parusie äußert sich die letzte Offenbarung Seiner schöpferischen Gegenwart… Und jetzt möchte ich gerne wissen, wo Sie stehen. Was sagen Sie Ihren Gemeindemitgliedern über die Lehre von den Letzten Dingen? Heben Sie die Hand, wenn Sie eine Antwort geben möchten, und geben Sie uns Ihren Namen und Ihren Heimatort bekannt… Sie dort, mein Herr, in der zweiten Reihe…«
»Alfred Keßler aus Köln…« Der Sprecher war ein kräftiger, junger Mann mit eckig geschnittenem Kinnbart. »Ich glaube an die Kontinuität und nicht an die Vollendung des Kosmos. Die Erfüllung für den einzelnen wird der Tod und die Vereinigung mit dem Schöpfer.«
»Wie legen Sie dann, Herr Pastor, die Schrift für die Gläubigen aus? Sie lehren das Wort Gottes – jedenfalls nehme ich das an. Aber wie erläutern Sie das Wort der Schrift zu diesem Thema?«
»Als ein Mysterium, Herr Professor: ein Mysterium, das unter dem Einfluß göttlicher Gnade der einzelnen Seele Stück für Stück seinen Sinn enthüllt.«
»Können Sie dies klarer ausdrücken – vielleicht so, wie Sie diesen Punkt Ihrer Gemeinde erklären würden?«
»Ich stelle dieses Thema gewöhnlich folgendermaßen dar: Die Sprache ist ein von Menschen geschaffenes Instrument und deshalb unvollkommen. Wo die Sprache versagt, tritt zum Beispiel die Musik in die Bresche. Oft sagt eine körperliche Berührung mehr aus als tausend Worte. Ich gehe auf die Empfindungen jedes einzelnen ein. Instinktiv fürchten wir den Tod. Wie wir aber alle aufgrund unserer seelsorgerischen Arbeit wissen, gewöhnt sich der Mensch an den Gedanken, er bereitet sich, wenn auch unbewußt, auf den Tod vor; er begreift ihn durch das ihn umgebende Universum – durch das Welken einer Blume, das Ausstreuen der Samenkörner im Wind, die Wiedergeburt im Frühling… In diesem Zusammenhang ist die Lehre von den Letzten Dingen, wenn schon nicht erklärbar, so doch wenigstens in Übereinstimmung mit den physischen und psychischen Erfahrungen.«
»Vielen Dank, Herr Pastor. Als nächster…«
»Petrus Allmann, Darmstadt.« Dieser Mann war älter. »Ich bin ganz anderer Meinung als mein Kollege. Die menschliche Sprache ist unvollkommen, gewiß; aber Christus der Herr hat sie benutzt. Ich glaube, wir irren uns, wenn wir versuchen, Seine Worte mit dem Zweifel der Mehrdeutigkeit zu belasten. Die Heilige Schrift ist zu diesem Thema völlig klar.« Er zitierte feierlich: »›Bald aber nach der Trübsal derselben Zeit werden Sonne und Mond den Schein verlieren und die Sterne werden vom Himmel fallen und die Kräfte der Himmel werden sich bewegen. Und alsdann wird erscheinen das Zeichen des Menschensohns am Himmel…‹ Was anderes kann dies bedeuten als die letzte Vollendung, das Ende aller zeitlichen Dinge?«
Von einem Teil der Zuhörerschaft kam überraschenderweise Beifall. Mendelius ließ ihm einen Augenblick freien Lauf und hob dann die Hand, so daß wieder Ruhe eintrat. Er sagte lächelnd: »Also, meine Damen und Herren, wer möchte sich zwischen diesen beiden Männern guten Willens entscheiden?«
Diesmal war es eine grauhaarige Frau, die ihre Hand hob.
»Ich bin Alicia Herschel, Diakonin aus Heidelberg. Ich bin der Meinung, daß es gar nicht darauf ankommt, welcher Kollege recht hat. Ich habe als Missionarin in mohammedanischen Ländern gearbeitet und gelernt, Inschallah zu sagen. Was auch immer der Wille des Herrn sein mag, er wird geschehen, ganz gleich, wie wir Menschen Seine Absichten auslegen. Pastor Allmann zitierte aus Matthäus vierundzwanzig; aber es gibt noch eine andere Stelle in demselben Kapitel: ›Von dem Tage aber und von der Stunde weiß niemand, auch die Engel nicht im Himmel, sondern allein mein Vater.‹«
Die Diakonin war eine eindrucksvolle Person und erhielt noch mehr Applaus. Ihr folgte ein junger Mann aus Frankfurt. Dieser richtete eine Frage an Mendelius:
»Was ist Ihre Ansicht zu dieser Frage, Herr Professor?«
Er hatte erwartet, sich festlegen zu müssen; er war also zu irgendeiner Art von Definition gezwungen. Er wartete einen Augenblick, um seine Gedanken zu ordnen, und erklärte dann seine Position:
»Wie Sie wissen, wurde ich in der römisch-katholischen Kirche zum Priester geweiht. Ich verließ jedoch mein geistliches Amt und wandte mich der akademischen Tätigkeit zu. Ich bin deshalb seit langem der seelsorgerischen Verpflichtung entbunden, die Schrift auslegen zu müssen. Ich bin jetzt Historiker, zwar noch praktizierender Christ, aber dem rein historischen Studium biblischer und kirchengeschichtlicher Dokumente zugewandt. Mit anderen Worten, ich studiere, was in der Vergangenheit niedergeschrieben worden ist, und zwar im Lichte unseres Wissens über diese Vergangenheit… Ich sollte also von Berufs wegen nicht Stellung nehmen zum Wahrheitsgehalt prophetischer Schriften, sondern nur zu ihrem Ursprung und ihrer Echtheit.«
Im Zuhörerraum herrschte Stille. Sie akzeptierten seinen Verzicht, aber wenn er einer persönlichen Stellungnahme rundweg aus dem Wege ging, würden sie ihn sofort ablehnen. Das Wissen genügte ihnen nicht. Sie verlangten, daß es in Worten und Taten Früchte trug. Mendelius fuhr fort:
»Aufgrund meiner Veranlagung und Ausbildung bin ich stets geneigt gewesen, die Zukunft im Hinblick auf Kontinuität, Veränderung und Wandlung zu interpretieren. Mit dem Begriff Erfüllung könnte ich nicht ins reine kommen… Jetzt jedoch neige ich der Auffassung zu, daß die Erfüllung möglich ist. Es ist eine Erfahrungstatsache, daß die Menschheit über alle Mittel verfügt, um eine globale Katastrophe solchen Ausmaßes herbeizuführen, daß das menschliche Leben, wie wir es kennen, auf unserem Planeten ausgelöscht wird. Wenn man noch die Erfahrungstatsache hinzunimmt, daß der Mensch destruktive Züge besitzt, stehen wir vor der beängstigenden Aussicht, daß die letzte Erfüllung vielleicht unmittelbar bevorsteht…«
Unter den Zuhörern entstand Bewegung. Mendelius fuhr fort:
»Ob es jedoch klug wäre, eine solche Botschaft zu predigen, ist eine ganz andere Frage, und ich muß gestehen, daß ich in diesem Augenblick nicht befugt bin, hierauf eine Antwort zu geben.«
Nach kurzem Schweigen erhoben sich zahlreiche Hände. Bevor er um weitere Fragen bat, griff Mendelius nach dem Wasserglas und nahm einen großen Schluck. Er hatte plötzlich das Gefühl, als sehe ihn Anneliese Meißner durch dicke Brillengläser grinsend an. Er konnte ihren spöttischen Urteilsspruch beinahe hören:
»Habe ich es Ihnen nicht gesagt, Karl? Gottes-Wahnsinn! Sie werden nie davon geheilt werden!«
Die Veranstaltung sollte eigentlich nur bis zum Mittag dauern, aber die Diskussion verlief so lebhaft, daß es schon ein Viertel vor eins war, als Mendelius sich verabschieden konnte, um in Hermann Franks Arbeitszimmer noch vor dem Mittagessen einen Drink zu sich zu nehmen. Hermann überschüttete ihn mit Komplimenten; aber Mendelius war alles andere als glücklich, als er die Schlagzeilen der auf dem Schreibtisch liegenden Zeitungen sah.
»Der Held des Corso«, »Berühmter Gelehrter in Schießerei verwickelt«, »Ehemaliger Jesuit Hauptzeuge gegen terroristische Brigaden«. Die Fotos wirkten gespenstisch: Der mit Blut befleckte Mendelius kniet neben dem Opfer, Malagordo wird in den Krankenwagen gehoben, Mendelius und der Kriminalbeamte reden bei einem Glas Whisky miteinander. Außerdem wurde ein Phantombild der Täterin mit der Überschrift gebracht: »So sieht Professor Karl Mendelius von der Universität Tübingen die Täterin«. Untermalt war der Text in typisch italienischem Operettenstil – aufgebauschter Horror, Heldentum und beißende Ironie: »Es ist vielleicht nicht ohne ein gewisses Maß an poetischer Gerechtigkeit, daß ein jüdischer Senator sein Leben einem deutschen Historiker verdankt…«
»Allmächtiger Gott!« Mendelius war bleich vor Zorn. »Die Leute machen mich ja geradezu zum Köder!«
Hermann Frank nickte. Er war nicht glücklich.
»Es ist schlimm, Karl. Die Botschaft hat angerufen, um dich zu warnen, daß es eine enge Verbindung zwischen den hiesigen Terroristen und ähnlichen Gruppen in Deutschland gibt.«
»Ich weiß. Wir können jetzt nicht mehr bei dir wohnen. Ruf bitte die Botschaft an und bitte sie, ihren Einfluß geltend zu machen, damit wir in einem der besseren Hotels ein Doppelzimmer bekommen, vielleicht im Hassler oder im Grand… Ich möchte auf keinen Fall, daß du und Hilde meinetwegen in Gefahr geratet.«
»Nein, Karl! Ich werde vor derartigen Drohungen keinen Rückzieher machen. Auch Hilde würde so etwas nie zulassen.«
»Hermann, bitte! Jetzt ist nicht der Zeitpunkt, den Helden zu spielen.«
»Das hat mit Heldentum nichts zu tun, Karl.« Seine Stimme klang erstaunlich fest. »Es ist einfach gesunder Menschenverstand. Du kannst nicht wie ein Maulwurf im Untergrund leben. Genau das wollen diese Kerle! Außerdem ist es nur für eine Woche. Die Frauen können, wie vorgesehen, nach Florenz fahren. Zwei alte Männer wie du und ich sollten in der Lage sein, sich selbst zu versorgen.«
»Aber hör doch…«
»Kein Aber, Karl. Wir wollen es beim Mittagessen mit unseren Frauen besprechen und sehen, wie sie sich dazu stellen.«
»Sehr gut. Vielen Dank, Hermann.«
»Ich danke dir, mein Freund. Der heutige Vormittag war für mich ein besonderer Triumph. In all den Jahren, die ich an der Akademie tätig bin, habe ich noch nie eine so angeregte Diskussion erlebt. Die Leute können deinen nächsten Vortrag kaum erwarten… Oh, fast hätte ich es vergessen. Da waren zwei Telefonanrufe für dich. Der eine kam von Kardinal Drexel. Er wird bis ein Uhr dreißig in seinem Büro sein. Der andere war von der Frau des Senators Malagordo. Sie erwartet deinen Rückruf im Krankenhaus Salvator Mundi… Hier sind die Nummern. Erledige die Anrufe gleich, dann brauchst du nicht mehr daran zu denken. Ich möchte dir die Freude am Mittagessen nicht verderben.«
Als Mendelius Drexels Nummer wählte, war ihm nicht ganz wohl zumute. Im Vatikan legte man großen Wert auf Diskretion. In Drexels Augen konnte die Bedrohung von Mendelius gleichzeitig auch die Abgeschiedenheit Jean Marie Barettes gefährden. Er war überrascht, als sich der alte Kämpe herzlich und entgegenkommend gab.
»Mendelius?… Ich nehme an, daß Sie die heutigen Morgenblätter gelesen haben?«
»Allerdings, Eminenz. Ich habe gerade mit meinem Gastgeber darüber gesprochen. Eine unangenehme Sache, gelinde ausgedrückt.«
»Ich habe einen Vorschlag, und ich hoffe fest, Sie werden ihn annehmen.«
»Es wird mir ein Vergnügen sein, ihn in Erwägung zu ziehen, Eminenz.«
»Ich möchte, daß Sie für den Rest Ihres hiesigen Aufenthalts meinen Wagen benutzen, mit meinem Fahrer. Sein Name ist Francone. Er war früher bei den Carabinieri. Er versteht etwas von Sicherheit und ist aufgeweckt und tüchtig.«
»Sie sind sehr gütig, Eminenz, aber ich kann den Vorschlag wirklich nicht annehmen.«
»Sie können. Sie müssen. Ich habe ein berechtigtes Interesse an Ihrer Sicherheit, mein Freund. Ich will Sie schützen. Wo sind Sie jetzt?«
»In der Villa Massimo. Ich bin bei den Franks zum Mittagessen verabredet. Die Adresse ist…«
»Ich habe die Adresse. Francone wird sich um vier bei Ihnen melden und wird Ihnen bis zu Ihrer Abreise zur Verfügung stehen… Bitte jetzt keine Einwände! Wir können es uns nicht leisten, den Helden des Corso zu verlieren, oder?«
Leichteren Herzens rief Mendelius das Krankenhaus Salvator Mundi an und fragte nach der Frau des Senators Malagordo. Er wurde zuerst mit einer ziemlich brüsken deutschen Nonne und dann mit einem Sicherheitsbeamten verbunden. Nach langer Pause kam die Frau des Senators an den Apparat. Sie wollte ihm dafür danken, daß er dem Senator das Leben gerettet hatte. Er sei zwar schwer verletzt, aber sein Zustand sei zufriedenstellend. Sobald es sein Befinden erlaube und er Besucher empfangen könne, möchte er dem Professor persönlich seinen Dank aussprechen.
Mendelius versprach, im Laufe der Woche wieder anzurufen, dankte ihr für ihre Liebenswürdigkeit und legte auf.
Als er von der Neuigkeit erfuhr, fühlte sich Hermann Frank wieder glücklicher.
»Siehst du, Karl! Das ist die Kehrseite der Medaille. Die Menschen sind freundlich und dankbar. Und der Kardinal ist ein schlauer alter Fuchs. Du weißt es wahrscheinlich nicht, aber der Vatikan verfügt über einen Stab sehr erfahrener Sicherheitsbeamter. Sie scheuen sich nicht, anderen im Namen Gottes den Schädel einzuschlagen. Dieser Francone gehört offenbar auch dazu. Ich habe jetzt ein besseres Gefühl – ein viel besseres. Komm, laß uns jetzt zum Mittagessen nach Hause gehen!«
Bei Tisch war Lotte sehr still; aber anschließend, als sich die Franks zur Siesta zurückgezogen hatten, machte sie ihren Standpunkt klar.
»Ich fahre nicht nach Florenz, Karl, auch nicht nach Ischia oder sonst wohin außerhalb von Rom, wenn du nicht mitkommst. Wenn du in Gefahr bist, muß ich die Gefahr mit dir teilen; sonst bin ich nichts als ein Stück Möbel in deinem Leben.«
»Bitte, Liebling, sei doch vernünftig! Du brauchst dich mir gegenüber doch nicht zu bewähren.«
»Hast du nie daran gedacht, daß ich mich vielleicht vor mir selbst bewähren muß?«
»Warum, um Gottes willen?«
»Weil ich seit unserer Heirat auf der Sonnenseite des Lebens gestanden habe: erst als Gattin eines bekannten Gelehrten und dann als die Frau Professor in Tübingen. Ich habe mir nie allzu viele Gedanken machen müssen, außer, wie man die Kinder aufzieht und den Haushalt führt… Du warst immer da, ein starker Schutzwall gegen den Wind. Ich habe mich nie ohne dich zu bewähren brauchen. Es war wunderbar, das ganze Leben; aber wenn ich mir jetzt andere Frauen meines Alters ansehe, komme ich mir sehr untüchtig vor.«
»Warum denn? Glaubst du, ich hätte diese Laufbahn ohne dich, ohne das Heim, das du mir geboten hast, und all deine Liebe bewältigen können?«
»Ich glaube, ja. Vielleicht nicht auf dieselbe Art und Weise – aber doch, du hättest es auch ohne mich geschafft. Du bist nicht bloß ein verstaubter Gelehrter, du hast auch Abenteurerblut in dir. O ja! Ich habe den Abenteurer manchmal hervorlugen sehen – und ich habe ihm die Tür vor der Nase zugemacht, weil er mir Angst eingejagt hat. Jetzt will ich mehr von ihm sehen, ihn besser kennenlernen und mich mit ihm anfreunden, bevor es zu spät ist.«
Sie weinte jetzt still vor sich hin. Mendelius zog sie an sich und sprach ihr Mut zu.
»Du brauchst nicht traurig zu sein, Liebling. Wir sind hier, zusammen. Ich will dich nicht wegschicken. Es ist nur so: Gestern habe ich plötzlich das Angesicht des Bösen gesehen – wirklich des Bösen! Jenes Mädchen – es konnte kaum älter als Kathrin gewesen sein – sah wie eine Madonna von Dolci aus. Aber sie schoß kaltblütig auf einen Mann, nicht um ihn zu töten, sondern um ihn in seiner Männlichkeit zu verstümmeln… Ich will nicht, daß du einer solchen Grausamkeit ausgesetzt wirst.«
»Aber ich bin ihr ausgesetzt, Karl! Genauso wie du. Als Kathrin mit ihrem Franz nach Paris fuhr, wünschte ich, ich wäre wieder jung und könnte an ihrer Stelle reisen. Ich war eifersüchtig, weil sie etwas bekam, was ich nie gehabt habe. Wenn du dich mit Johann strittst, war ich fast froh, denn er kam anschließend immer zu mir. Er war wie ein junger Geliebter, mit dem ich dich eifersüchtig machen konnte... So, jetzt ist es heraus! Und wenn du mich jetzt haßt, kann ich es nicht ändern.«
»Ich kann dich nicht hassen, Liebling. Ich habe dir noch nie böse sein können, jedenfalls nicht für lange.«
»Das ist wohl ein Teil des Problems. Ich wußte es, und ich brauchte dich als Gegner.«
»Ich will nicht gegen dich kämpfen, Lotte.« Plötzlich wurde er ernst, und er schien in Gedanken woanders zu sein. »Weißt du, warum? Weil ich in jungen Jahren gebunden war – aus freien Stücken, gewiß, aber trotzdem gebunden. Als ich frei wurde, lernte ich die Freiheit so sehr schätzen, daß ich glaubte, es nicht ertragen zu können, einen anderen zu unterdrücken… Ich wollte einen Partner, keine Marionette. Ich sah, wie es dann lief, aber als du es selbst merktest und es ändern wolltest, konnte ich es nicht mehr; ich wollte dich nicht zwingen. Ob richtig oder falsch, das war jedenfalls meine Einstellung.«
»Und jetzt, Karl? Was empfindest du jetzt?«
»Ich fürchte mich!« sagte Karl Mendelius. »Ich fürchte mich vor dem, was uns da draußen auf den Straßen vielleicht erwartet. Noch mehr fürchte ich mich vor dem, was geschehen wird, wenn ich Jean Marie begegne.«
»Ich habe nach uns gefragt – nach dir und mir.«
»Davon rede ich ja, Liebling. Wohin wir auch gehen, wir schweben in Gefahr. Ich will dich bei mir haben; aber nicht, um mir oder dir etwas beweisen zu können. Das wäre, als ob man miteinander schläft, nur um einander zu zeigen, daß man es kann… Es mag herrlich sein, aber Liebe ist es noch lange nicht. Kurz gesagt, die Entscheidung liegt bei dir, Liebling.«
»Wie soll ich es dir denn sagen, Karl? Ich liebe dich. Von jetzt an gehe ich überall dahin, wohin du gehst.«
»Ich bezweifle, ob dir die Mönche in Monte Cassino ein Bett anbieten werden. Aber davon abgesehen – gut! Wir fahren zusammen.«
»Schön!« sagte Lotte lächelnd. »Kommen Sie jetzt ins Bett, Herr Professor. Es ist der sicherste Ort in ganz Rom!«
Im Prinzip war es eine ausgezeichnete Idee; aber ehe sie sie in die Tat umsetzen konnten, klopfte das Mädchen an die Tür, um auszurichten, daß Georg Rainer von der »Welt« am Apparat sei. Rainer sprach freundlich, aber kurz und bündig und geschäftsmäßig.
»Sie sind jetzt eine Berühmtheit, Karl. Ich brauche ein Interview für meine Zeitung.«
»Wann?«
»Jetzt sofort, am Telefon. Ich muß einen Termin einhalten.«
»Fangen Sie an.«
»Nicht so schnell, Karl. Wir sind gute Freunde, deshalb will ich Ihnen noch einmal die Spielregeln bekanntgeben – aber nur einmal. Sie können eine Antwort ablehnen; doch erzählen Sie mir nichts, was unter uns bleiben soll. Was Sie mir sagen, lasse ich drucken. Klar?«
»Klar.«
»Dieses Gespräch wird mit Ihrer Zustimmung auf Band aufgenommen. Einverstanden?«
»Einverstanden.«
»Der Apparat läuft. Professor Mendelius, durch Ihr sofortiges Eingreifen retteten Sie Senator Malagordo gestern das Leben. Wie fühlt man sich so als internationale Berühmtheit?«
»Ungemütlich.«
»Über Ihren Samariterdienst sind ein paar recht provozierende Schlagzeilen erschienen. Ein Blatt nennt Sie den ›Helden des Corso‹. Was halten Sie davon?«
»Ich fühle mich verlegen. Ich habe nichts Heroisches getan. Ich habe nur ganz einfach Erste Hilfe geleistet.«
»Und diese Schlagzeile: ›Ehemaliger Jesuit Hauptzeuge gegen Terrorbrigaden‹?«
»Eine Übertreibung. Ich war Zeuge des Verbrechens. Ich schilderte der Polizei den Hergang. Ich nehme an, daß sie ähnliche Aussagen auch von vielen anderen protokolliert hat.«
»Sie haben der Polizei auch eine Personenbeschreibung des Mädchens gegeben, das die Schüsse abgefeuert hat.«
»Ja.«
»War die Beschreibung genau und detailliert?«
»Ja.«
»Glauben Sie nicht, daß Sie sich durch diese Zeugenaussage großen Gefahren aussetzen?«
»Ich wäre ein viel größeres Risiko eingegangen, wenn ich geschwiegen hätte.«
»Wieso?«
»Weil Gewalt nur dann gedeiht, wenn die Menschen davor Angst haben, zu sprechen und etwas dagegen zu unternehmen.«
»Fürchten Sie Vergeltungsmaßnahmen, Professor?«
»Fürchten, nein. Aber ich bin auf welche vorbereitet.«
»Wie haben Sie sich vorbereitet?«
»Kein Kommentar.«
»Wollen Sie etwas zu der Tatsache sagen, daß Sie Deutscher sind, und der Mann, dem Sie das Leben gerettet haben, Jude ist?«
»Unser Herr Jesus Christus war Jude. Ich freue mich, einem Angehörigen Seines Volkes einen Dienst erwiesen zu haben.«
»Ein anderer Punkt, Herr Professor: Wie ich höre, haben Sie heute morgen an der Deutschen Akademie einen höchst bewegenden Vortrag gehalten.«
»Er fand eine positive Aufnahme. Ich würde ihn nicht bewegend nennen.«
»Unsere Quelle lautet folgendermaßen – ich zitiere: ›Auf die Frage eines Zuhörers, ob er glaube, daß das Ende der Welt, wie es in der Bibel vorausgesagt ist, eine reale Möglichkeit sei, antwortete Professor Mendelius, daß er es nicht nur für eine Möglichkeit, sondern für ein unmittelbar bevorstehendes Ereignis halte.‹«
»Wie, zum Teufel, haben Sie das bekommen?«
»Wir haben gute Beziehungen, Herr Professor. Ist die Darstellung richtig oder falsch?«
»Sie ist richtig«, sagte Mendelius. »Aber ich wünschte um alles in der Welt, Sie würden das nicht bringen.«
»Ich habe Ihnen die Spielregeln gesagt; wenn Sie aber diese Erklärung noch etwas erweitern wollen, zitiere ich Sie gerne im Wortlaut.«
»Ich kann nicht, Georg. Wenigstens nicht zu diesem Zeitpunkt.«
»Und was wollen Sie damit sagen, Herr Professor? Nehmen Sie sich wirklich so ernst?«
»In diesem Falle, ja.«
»Um so mehr besteht Grund, den Bericht zu veröffentlichen.«
»Ein wie guter Journalist sind Sie eigentlich, Georg?«
»Bis jetzt war ich nicht schlecht, finden Sie nicht auch?« Rainers Lachen dröhnte über den Draht.
»Ich biete Ihnen ein Geschäft an, Georg.«
»Ich mache nie welche – na, so gut wie nie. Woran denken Sie?«
»Unterdrücken Sie die Story über das Ende der Welt, und ich werde Ihnen eine viel größere geben.«
»Zum gleichen Thema?«
»Kein Kommentar.«
»Wann?«
»In einer Woche.«
»Das ist ein Freitag. Was wollen Sie mir denn geben? Das Datum der Wiederkunft Christi?«
»Ich lade Sie zum Lunch ins Ernesto ein.«
»Und die Story ist exklusiv?«
»Das verspreche ich Ihnen.«
»Abgemacht.«
»Vielen Dank, Georg.«
»Und ich habe das Band, um uns beide daran zu erinnern. Auf Wiedersehen, Herr Professor.«
»Auf Wiedersehen, Georg.«
Er legte den Hörer auf und blieb erstaunt und nachdenklich unter dem gleichgültigen Blick der an die Decke gemalten Faune und Schäferinnen stehen. Ohne es zu wissen, war er in ein Minenfeld geraten. Nur noch ein unvorsichtiger Schritt, und alles würde unter seinen Füßen explodieren.