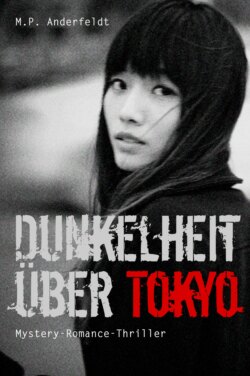Читать книгу Dunkelheit über Tokyo - M.P. Anderfeldt - Страница 4
zero
ОглавлениеNoch einmal, ein letztes Mal, strich Takeo beinahe zärtlich über das verwitterte Holz des Torii, des uralten Tors, das zum Schrein führte. Seine Fingerkuppen ertasteten eine kleine Mulde, ein Astloch. Wie lange mochte es her sein, dass aus diesem Stamm ein frischer Trieb gesprossen war?
Er trat hindurch und wandte sich um. Am oberen Ende der steinernen Treppe mit den unregelmäßigen Stufen lag der Platz mit dem Haiden, dem Hauptgebäude. Unzählige Male, in der Kälte des Winters ebenso wie bei brütender Hitze, war er auf das Dach geklettert um es auszubessern, doch konnte er sich nicht erinnern, dass es jemals richtig dicht gewesen wäre.
Der Fensterladen des kleinen Stands daneben, in dem sie Amulette und Glücksbringer wie Ema, Omikuji und Omamori verkauft hatten, würde sich nun nie wieder öffnen. Naja, außer zu Neujahr war sowieso nie viel los gewesen – und auch das hatte nachgelassen. Viele machte es nichts aus, in den größeren Schrein in Stadt zu fahren.
Alles wirkte leer und verlassen. Einzig das Wasser im Chozuya, dem kleinen Springbrunnen, plätscherte fröhlich wie eh und je. Nur würde kein Gläubiger mehr eine der hölzernen Kellen zur Hand nehmen, um sich zu reinigen. Nie wieder.
Oder doch? Vielleicht würde die alte Teru ja noch mal vorbeischauen. Früher war sie regelmäßig gekommen, sie hatte immer erzählt, wie wichtig das sei. Die meisten anderen regelmäßigen Besucher waren inzwischen gestorben, und auch Teru war schon über 80 Jahre alt und hatte Mühe, den Weg zum Heiligtum zu erklimmen.
Durch die Baumkronen konnte er die strahlend weiße Fassade des Luxushotels erkennen, das seit ein paar Jahren unten an der Küste stand. Es schien so nah.
Sein Vater war ganz aufgeregt gewesen, als das Hotel geöffnet hatte und tatsächlich war eines Tages ein Angestellter gekommen, hatte sich geduldig den Schrein zeigen lassen und dann noch lange mit seinem Vater gesprochen. Der hatte daraufhin gehofft, dass nun viele Touristen kämen. Er hatte sogar davon gesprochen, wieder ein Mädchen als Miko einzustellen.
Doch das war lange her. Die Touristen waren ausgeblieben. Während Takeo die verwitterten Stufen mit traumwandlerischer Sicherheit herabsprang, erinnerte er sich, dass er einmal das Hotel besucht hatte. Er war in einer großen Halle gestanden, die mit einem dicken, dunkelgrünen Teppichboden ausgelegt war. Ein Grüppchen junger Frauen in weißen Bademänteln mit dem Hotel-Logo war schnatternd und lachend an ihm vorübergegangen. Sie hatten gegackert wie Hühner, und schnell gesprochen wie die Moderatoren im Fernsehen. Eine hatte ihm einen Blick zugeworfen und ein wenig gelächelt. Zumindest hatte er sich das eingebildet, vielleicht hatte sie auch nur über einen Witz gelacht, den er nicht verstand.
Takeo hatte die schönen Fotos des Onsen betrachtet, die an der Wand hingen. Man konnte im dampfend heißen Wasser liegen und dabei das Panorama der Küste und der Berge genießen. Texte priesen die Qualitäten des Wassers, das wohltuend und heilsam sein sollte. Auf den Fotos sah man, wie Männer behaglich im dampfenden Wasser lagen und, ein Glas Sake in der Hand, die schneebedeckten Gipfel betrachteten.
Daneben hingen Poster, die für organisierte Ausflüge warben: »New Fashion Outlet Center – 35 Designergeschäfte in einer einzigen Mall«, »Unvergessliche Apfelblüte«, »Island-hopping mit einem traditionellen Fischerboot« und »Tour der 12 Tempel und Schreine«. Die 12 waren auch einzeln aufgeführt, Fotos zeigten eindrucksvolle Gebäude, Priester und Maikos in prächtigen Gewändern. Der Schrein seines Vaters war natürlich aber nicht dabei. Er kannte die anderen Heiligtümer, alle waren viel größer und bestens auf Touristen eingerichtet. Wahrscheinlich auch kulturhistorisch bedeutender.
So hatte sich die Hoffnung zerschlagen, dass Touristen kämen. Auch die Leute aus dem Dorf schauten immer seltener vorbei, die meisten Jüngeren waren sowieso weggezogen, nach Tokyo, Sendai oder Sapporo, und auch die wenigen, die geblieben waren, besuchten den Schrein nur selten. Manchmal kam tagelang gar niemand.
Wahrscheinlich war sein Vater deswegen gestorben. Es gab für ihn einfach keinen Grund mehr zu leben. In den Wochen nach seinem Tod wurde Takeo klar, dass ihn nichts mehr in den nebligen, kalten Bergen hielt. Schon in der Schule hatten sich seine Kameraden über ihn lustig gemacht und als Bergmenschen verspottet. Das Schlimme war: Sie hatten recht. Sie lebten in einer anderen Welt als er. Er kannte ihre laute, bunte Welt aus dem Fernsehen. Der tragbare, orangefarbene Sharp-Fernseher war sein Fenster in diese andere Welt, wo alles bunt war, fröhlich und laut.
Wie anders war da sein Zuhause; wenn er abends seinen letzten Rundgang machte und das Tor verschloss, drang kein Laut zu ihm als das Rauschen des Waldes und der vereinzelte Ruf eines Vogels.
Takeo fühlte sich frei, als er nun endlich den Weg entlang ging. Sayonara, dunkler Wald, dachte er vergnügt. Sayonara, kalte Berge, und: Hallo, Leben!
Er zog die Sporttasche, die von seiner Schulter zu rutschen drohte, wieder hoch. Wie lange hatte er sich danach gesehnt, ein neues Leben zu beginnen. Gleichzeitig hatte er Angst. Er dachte an die Mädchen, die er im Hotel gesehen hatte. Sie waren so quirlig gewesen, so lebendig. Waren in der Stadt alle so? Wenn ich hier schon ein Bergmensch bin, was bin ich dann in Tokyo?
Er würde dort seinen Onkel besuchen, den Bruder seines verstorbenen Vaters. Der war viel jünger als sein Vater und hatte sich immer über diesen lustig gemacht. Bei der Beerdigung hatte er Takeo eingeladen, zu ihm zu kommen. Seine Wohnung sei zwar klein, aber er könne so lange bei ihm bleiben, wie er wolle, hatte er ihm versprochen. Dann hatte er noch irgendetwas von den Verlockungen der Großstadt gefaselt und Takeo immer wieder lachend auf den Rücken geklopft, aber da war er schon ein wenig angetrunken gewesen.
Zum hundertsten Mal tastete Takeo vorsichtig nach seiner Geldbörse. Natürlich war sie noch da. Allzu viel war zwar nicht drin, doch es würde genügen, um eine Fahrkarte nach Tokyo zu kaufen und die ersten paar Tage zu überbrücken.
Er wollte sich ohnehin so bald wie möglich einen Job suchen, erst einmal irgendetwas Kleines. Sein Onkel meinte, der Convenience Store bei ihm am Eck suche immer Verkäufer. Damit werde man zwar nicht reich, aber darum ginge es ja auch nicht. Nein, darum ging es ihm nicht.
Takeo stellte sich vor, wie er zwischen all den bunten Waren im hell erleuchteten Laden stand. Wenn ein kleines Mädchen käme, würde er es anlächeln und ihm ein Bonbon schenken oder so etwas.
Er würde ein Teil dieser bunten, lauten Welt werden. Er würde die alte Welt und ihre verstaubten Traditionen endgültig hinter sich lassen – die Welt seiner Väter … Für einen Moment war ihm, als spürte er ein Frösteln im Rücken, dann schüttelte er sich und ging weiter.
Jetzt gab es ohnehin kein Zurück mehr. Vergnügt ging Takeo die letzten Stufen hinab. Und doch musste er sich zwingen, noch einen letzten Blick auf den Ort zu werfen, der die letzten 20 Jahre seine Heimat gewesen war. Er hatte erwartet, dass er verlassen und tot wirkte, doch dem war nicht so. Die Vögel zwitscherten, die Blätter der gewaltigen Bäume raschelten im Wind, alles war wie immer. Und doch schien es ihm für einen Moment, als hielte der ganze Berg die Luft an.
Deutlich war zu sehen, dass die alte Frau Mühe mit den Treppen hatte. Sie stützte sich auf ihren Stock und blieb immer wieder stehen. Doch lächelte sie jedes Mal, wenn Sie eine Pause machte. Sie genoss die wärmenden Sonnenstrahlen auf ihrem Gesicht und sog die feuchte Morgenluft tief ein. In den Zweigen glänzten Tautropfen und der Nebel hatte sich noch nicht ganz aufgelöst. Teru freute sich über den Spaziergang.
Sie war glücklich, dass sie bald den Schrein besuchen würde, und fragte sich, wie es dem kleinen Takeo ging. Der war ja schon immer ein ruhiger Junge gewesen, aber seit dem Tod seines Vaters schien er ihr noch schweigsamer. Der braucht eben eine Freundin, dachte sie und lächelte, schade, dass ich keine Mädchen in seinem Alter kenne. Oder vielleicht … Megumi? Aber hatte die nicht schon einen Freund? Bei den jungen Leuten verlor sie immer den Überblick. Und wenn sie dann fragte ›Hast du denn einen Bräutigam?‹, verdrehte sie immer nur die Augen und sagte vorwurfsvoll ›Obaachan!‹ Naja, wahrscheinlich war sie genau so gewesen, vor langer, langer Zeit.
Als sie durch den Torii schritt, bemerkte sie, dass etwas nicht stimmte.
Alles wirkte vernachlässigt. Auf den Stufen lagen Blätter, die niemand weggekehrt hatte. Takeo war doch nicht etwa krank?
Oben angekommen, verstärkte sich der Eindruck: Der Platz war leer und verlassen, alle Gebäude verschlossen. Nein, Takeo war nicht krank. Teru lächelte nun nicht mehr. Sie wusch sich die Hände am Chozuya und ging zur Tür des Haiden. Dort hing ein handgeschriebenes Schild, das ihre Befürchtungen bestätigte. Takeo bedankte sich darauf für die Treue der Besucher und entschuldigte sich, dass er den Schrein bis auf Weiteres nicht weiterführen könne. Er lud alle ein, hier dennoch zu beten.
Erschöpft stützte sich die alte Frau an der Tür ab. War schon alles zu spät?
Oder war es doch nur ein Märchen, das ihr ihre Obaachan erzählt hatte? Als Teru noch ein Kind war und mit ihren Geschwistern auf dem Schoß der Großmutter herumgeturnt hatte, ermahnte die sie stets, recht fleißig zum kleinen Schrein auf dem Berg zu gehen. Schon damals hatte Terus Mutter darüber gelächelt, aber natürlich nur heimlich, wenn die Großmutter es nicht sehen konnte. Der kleine, alte Schrein schien ihr ein Überbleibsel aus längst vergangenen Zeiten, ganz anders als die prächtigen Kaiser-Schreine.
Doch Obaachan bestand darauf, dass es wichtig sei, dass alle regelmäßig den Schrein besuchten und so hatte sich Terus Mutter gefügt.
Später dann, als es der Großmutter nicht mehr so gut ging und sie fast nur noch im Bett lag, hatte sie mit Teru über den Schrein gesprochen.
»Meine liebe Teru, ich will dir von dem Schrein erzählen. Es war vor langer Zeit, als ich selbst noch ein kleines Mädchen war. Noch einiges jünger als du jetzt bist, vielleicht vier oder fünf Jahre alt. Damals gab es den großen Schrein in der Stadt noch nicht … eigentlich gab es die ganze Stadt noch nicht.
Aber den kleinen Schrein auf dem Berg, den gab es schon. Und er sah damals fast genau so aus wie heute. Uns kam er damals allerdings noch nicht so ärmlich vor; es waren ja alle Häuser aus Holz und so etwas wie das neue Rathaus in der Stadt – ganz aus Beton! – gab es noch nicht.
Was wollte ich dir eigentlich erzählen? Ach ja. Eines Tages war ich wieder mit meiner Mutter und meinen drei Brüdern beim Schrein. Ich langweilte mich natürlich und lief ein bisschen herum. So lange ich nicht zu weit weg lief oder meinen Kimono schmutzig machte, war das meiner Mutter egal.
Also erkundete ich den dichten Wald, der das Gelände umgab. Ich weiß nicht mehr, was ich tat, wahrscheinlich sammelte ich Stöckchen oder Steine oder so etwas. Plötzlich sah ich eine kleine Höhle vor mir. Vielleicht ein Kaninchenbau, dachte ich und wollte hineinsehen. Ich steckte meinen Kopf hinein, das ging gerade so. Natürlich habe ich nichts gesehen, es war ja stockdunkel. Aber … nach einer Weile habe ich etwas gespürt.
Ich bemerkte: Irgendetwas ist da drin. Und es sah mich an, nein, es analysierte mich geradezu, es blickte auf den Grund meiner Seele. Es wusste alles, was ich wusste, kannte meine geheimsten Gedanken und Gefühle. Frag mich nicht, wie ich das gemerkt habe, vielleicht spüren Kinder das einfach. Ich zog den Kopf heraus und lief schreiend zu meiner Mutter. Meine Mutter und meine Brüder lachten natürlich nur und meinten, ein Kaninchen oder ein Fuchs hätte mich erschreckt, aber der Priester war ganz ernst und wollte genau wissen, was ich gesehen habe. Dann sagte er: Kami.«
Teru unterbrach die Erzählung der Großmutter: »Der Priester meinte, du hättest einen Kami gesehen?«
»Ja«, fuhr diese fort, »und ich kann dir sagen, es ist kein freundliches Wesen. Überrascht dich das? Glaubst du etwa auch, nur weil eine Wesenheit sehr mächtig ist, muss sie automatisch gut sein? So wie die Menschen im Westen, die an einen Lieben Gott glauben?«
»Nein, natürlich nicht, Großmutter.«
»Ein kluger Mann hat mir viel später erklärt, dass die Götter verschiedene Gesichter haben, freundliche, wohlwollende, aber auch böse und chaotische. Du glaubst mir nicht? Wenn ein kleiner Junge einen Ameisenhaufen zertritt, erscheint er den Ameisen dann nicht wie ein Gott? Na, wie auch immer, so war das damals. Und seitdem spürte ich den Kami jedes Mal, wenn ich in die Nähe des Schreins ging. Ich fühlte seine Anwesenheit in einer Höhle, hinter einem Baum oder in einem dunklen Gebäude. Immer gerade außerhalb meines Blicks.«
»Hast du ihn denn niemals gesehen?«
»Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube aber, einmal …,« sie zögerte, »einmal war es anders. Es war ein paar Jahre später und ich hatte mich irgendwie schon daran gewöhnt, ihn immer zu spüren, wenn ich an jenem Ort war.
Dieses Mal war ich allein gekommen und war auch nicht so ganz bei der Sache. Ich dachte an die Schule und dachte an einen jungen Mann …« Sie lächelte ihre Enkelin an, »… ja, Teru, ich war auch einmal jung. Wie dem auch sei, ich saß auf den Stufen zum Haiden, dachte nach und habe wohl vor mich hingestarrt.
Irgendwann bin ich zu mir gekommen und habe bemerkt, dass direkt hinter dem Chozuya etwas stand, keine fünf Meter von mir entfernt. Ich sage nicht: ›jemand‹, denn ich bemerkte sofort, dass das kein Mensch war. Es war zwar so groß wie ein Mensch, aber irgendwie … dunkel. Es hatte die Gestalt eines Menschen, aber ich konnte kein Gesicht sehen, vielleicht hatte es auch keins. Es muss wohl bemerkt haben, dass ich es ansah, denn es verschwand ganz langsam wieder im Schatten, wie ein böser Traum, der dem Tageslicht weichen muss.
Ich hatte danach wochenlang Albträume und wollte nachts das Licht nicht ausmachen, aber ich habe bis heute niemandem etwas davon erzählt. Mein ganzes Leben lang rätsele ich schon, was für ein Wesen das war und ob es böse ist oder gut.«
»Und was denkst du?«
»Früher dachte ich, es müsse böse sein – einfach, weil es so schwarz war und kein Gesicht hatte. Was für ein dummes Argument. Jetzt bin ich mir nicht mehr so sicher. Vielleicht ist es weder gut noch böse. Vielleicht ist es einfach nur ganz anders als wir. Vielleicht werden wir ihn nie verstehen, so wie die Ameisen den Jungen nie verstehen werden.« Die Großmutter schwieg nach dieser langen Erzählung.
»Und der Schrein?«
»Den Schrein haben unsere Ahnen vor langer Zeit errichtet. Ich vermute, so lange der Schrein da ist, bleibt auch der Kami dort. Ob der Schrein ihn irgendwie gefangen hält oder ob er einfach dort bleiben möchte – wer weiß das schon. Doch sicher ist: Dieses Wesen gehört nicht in die Welt der Menschen. Es ist wichtig, dass es dort bleibt, wo es ist.«
Sie sah Teru in die Augen. »Wirst du zum Schrein gehen, wenn ich nicht mehr bin?«
»Aber Obaachan, sag doch nicht so etwas. Du lebst doch noch ganz lange.«
»Ich meine es ernst, Teru. Versprich es mir. Bitte.«
»Na gut. Ich verspreche es.«
An dieses Versprechen hatte sich Teru ihr ganzes Leben lang gehalten. Bis ins hohe Alter war sie regelmäßig zum Schrein gegangen und auch jetzt war sie nur ein paar Wochen zu Hause geblieben, weil sie eine schwere Erkältung gehabt hatte.
Doch nun war der ganze Schrein verlassen. Es gab keinen Priester mehr und gewiss war seit Tagen niemand mehr hier gewesen, um zu beten. Teru stand vor dem Haiden und fühlte sich mit einem Mal ganz klein und hilflos. Sie war plötzlich vier Jahre alt, wie ihre Großmutter, als sie den Kami das erste Mal traf. Sie spürte, wie sich etwas hinter ihr aufbaute, etwas Gewaltiges, etwas von ungeheurer Kraft.
Teru drehte sich um.