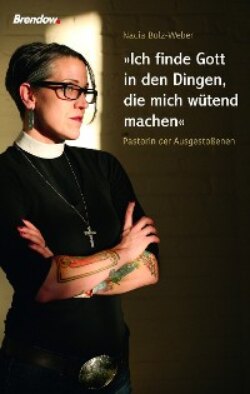Читать книгу Ich finde Gott in den Dingen, die mich wütend machen - Nadia Bolz-Weber - Страница 11
Das Ruderteam
ОглавлениеSelig sind, die da geistlich arm sind; denn ihrer ist das Himmelreich.
– Matthäus 5,3 (Luther)
In meinen ersten trockenen Jahren verbrachte ich die meisten Montagabende in einem rauchgeschwängerten Gemeindesaal, wo ich mit ein paar Freunden, die ebenfalls trockene Alkoholiker waren, schlechten Kaffee trank. Bildnisse der Jungfrau Maria blickten auf uns herab, während Gebete, Verzweiflung, Zigarettenrauch und Hoffnung zur Saaldecke emporschwebten. Wir waren ein streitlustiger Haufen von Leuten, deren Leben sich in unterschiedlichen Stadien der Besserung befand. Da war Candace, eine Hausfrau aus der Vorstadt, die bei ihrem Debütantinnenball von Heroin high gewesen war; Stan, der depressive Dichter, der kein gutes Haar an sich selbst ließ und vor Gefühlen überströmte; und Bob, der Anwalt im Ruhestand, der schon trocken gewesen war, bevor Jesus auf die Welt kam, aber aus irgendeinem Grund immer noch ein bisschen obdachlos aussah.
Wir redeten über Gott und den Zorn, den Groll und die Vergebung – immer schön von Kraftausdrücken untermalt. Wir waren nicht so sehr ein Narrenschiff als vielmehr ein Ruderboot voller Idioten. Ein kleines Ruderteam, das sich wild paddelnd in die Riemen legte, mal füreinander, mal jeder für sich, und wenn einer von uns über Bord sprang, mussten wir anderen umso kräftiger paddeln.
Als ich 1992 zu dem „Ruderteam“ stieß, wie ich es tatsächlich bald nannte, arbeitete ich in einem Klub in der Innenstadt als Standup-Komikerin. Ich war kaputt, erst seit ein paar Monaten trocken, und gab mir alle Mühe, wieder heil zu werden. Da ich mir eine Therapie nicht leisten konnte, schien mir die zweitbeste Lösung zu sein, mich auf die Bühne zu stellen und sarkastische, zynische Sprüche von mir zu geben. Außerdem bin ich wirklich witzig, wenn es mir dreckig geht.
Das ist nicht gerade etwas Ungewöhnliches. Wenn man alle Komiker der Welt an einem Ort versammeln und dann alle Alkoholiker, Kokainsüchtigen und Manisch-depressiven wieder wegschicken würde, dann bliebe … nun ja … außer Carrot Top fällt mir keiner ein. So eine Affäre mit der Finsternis bringt manche Leute dazu, die Wahrheit auf ungeschminkte, schräge Weise zu sehen, so als richteten sie eine Schwarzlichtlampe aufs Leben, um seine ganze Absurdität zum Leuchten zu bringen. Komiker sprechen eine Wahrheit aus, die man nur von der Schattenseite der Psyche her sehen kann. Komik ist bestenfalls Prophetie und gesellschaftliche Traumdeutung. Schlechtestenfalls besteht sie nur aus Witzen über Schwänze.
Als ich noch als Komikerin arbeitete, sagten normale, nichtkomische Leute oft zu mir: „Wow, wie schaffst du das nur, dich einfach nur mit einem Mikrofon vor so viele Leute zu stellen?“ Worauf ich dann antwortete: „Wow, wie schaffst du das nur, dein Haushaltsbuch zu führen und jeden Morgen zur Arbeit aufzustehen?“ Jedem von uns fallen im Leben andere Dinge schwer. Vor Hunderten von Leuten zu sprechen, war für mich längst nicht so ein Riesenakt wie einen Termin beim Zahnarzt zu vereinbaren.
Als Komikerin auf der Bühne zu stehen, kostete mich so gut wie überhaupt keine Mühe, denn auf der Schattenseite fühlte ich mich zu Hause – da, wo alles in Ironie und Sarkasmus mariniert, bis es so weit ist, gegrillt und einem nackten Kaiser serviert zu werden. Ich fand regelmäßig Engagements, kam aber in der Comedyszene nicht sehr weit. Dafür gab es mehrere Gründe. Erstens brachte ich die anderen Komiker viel häufiger zum Lachen als das eigentliche Publikum, für das ich nur Verachtung übrig hatte (was die Sache vielleicht erklärt). Dazu kam, dass ich keinen besonderen Erfolgsdrang verspürte: Sobald es anstrengend wurde, verdrückte ich mich. Aber der Hauptgrund, warum es mit der Comedy bei mir nicht so recht klappte, war, dass ich allmählich gesünder wurde und einfach nicht mehr so witzig war. Weniger unglücklich = weniger witzig. Während ich trocken wurde und versuchte, mich auf Gott zu stützen und mich ehrlich meinen Unzulänglichkeiten zu stellen, wuchs in mir die Bereitschaft, mich verletzlich zu zeigen. Das machte mich zur leichten Beute im Künstler-Aufenthaltsraum eines Comedyklubs, der im Grunde eine Brutstätte des emotionalendarwinistischen Überlebenskampfes ist. Deshalb hatte ich keine Lust, dort sehr viel von meiner Freizeit zu verbringen. In anderer Hinsicht konnte es irgendwie auch toll sein, mit Komikern abzuhängen. Im Vergleich zu den meisten von ihnen war ich ein Urbild psychischer Gesundheit. Ich freundete mich mit einem drahthaarigen, kontaktfreudigen Komiker namens PJ an – und mit anfreunden meine ich, dass ich gelegentlich mit ihm schlief –, der einen scharfen, wenn auch unglaublich verdrehten Verstand besaß. PJ war nicht gerade der Typ fürs Gentleman’s Quarterly. Statt gut geschnittener Jeans zog er eine bedauerliche Kombination aus ausgeleierten Shorts, Button-down-Hemden und Sportsandalen vor. Er hatte etwas ausgesprochen Wildes an sich, das ihn ein bisschen hundeähnlich erscheinen ließ. Obwohl er praktisch keinerlei Stil besaß, war in PJs sozialem Leben der Bär los. Er liebte die Frauen, das Leben, den Schnaps, die Nacktmagazine, das Pokern und die Comedy, wenn auch nicht unbedingt in dieser Reihenfolge.
Außerdem arbeitete er parallel zu seiner Standup-Karriere an seiner Doktorarbeit in Kommunikationswissenschaften, was ihm allerdings durch die erwähnte Fülle seiner Laster nicht gerade erleichtert wurde. Eines Tages lud ich ihn zum Ruderteam ein, und für die nächsten acht Jahre blieb er ein treues Mitglied und lud nach dem Treffen oft zum Pokerspielen bei sich zu Hause ein.
Wenn man PJ nicht gut kannte, wirkte er gar nicht so clever, aber hinter seinen unflätigen Tiraden verbarg sich ein genialer Intellekt. Seine Auftritte waren mit die versautesten in Denver. Viel Hochgestochenes kam darin nicht vor. Auf der Bühne stellte er sich dumm, und das konnte er hervorragend. Einmal rief ich PJ an, um mich zu erkundigen, was seine Doktorarbeit mache. „Läuft super“, sagte er, „aber keiner merkt, dass ich in meinem Büro an der Uni wohne.“
PJ war wie eine von diesen Stoffpuppen mit langen Röcken, die man von unten nach oben kehren kann, indem man den Rock umstülpt – und plötzlich ist sie keine Oma mehr, sondern der große böse Wolf. Richtig herum gehalten ist seine Puppe ein Einfaltspinsel mit losem Mundwerk, aber wenn man sie umdreht, wird ein Doktor der Kommunikationswissenschaften daraus. Die richtig herum gehaltene Puppe ist der immer zu Späßen aufgelegte und ausstrahlungsstarke Gastgeber einer wöchentlichen Pokerpartie, doch umgekehrt wird ein lebensuntüchtiger, depressiver Mensch daraus.
PJ passte goldrichtig ins Ruderteam, und er brachte Leben in die Treffen mit seinen brüllend komischen, finsteren Tiraden. „Heute Morgen wollte ich mich umbringen“, sagte er zum Beispiel, „aber dann fiel mir ein, wie bescheuert ich es fände, euch Armleuchtern einen Grund zu liefern, euch noch mehr um euch selbst zu drehen, als ihr es sowieso schon tut, also … “ Mit „also … “ beendete er die meisten seiner Sätze, so als wüssten wir alle, was in die nächste Lücke gehörte. Ich hielt mich gern in seiner Nähe auf, als könnte seine Aura auf mich abfärben und mich genauso schlagfertig und clever und sympathisch machen wie ihn.
Comedyklubs haben montags Ruhetag. Dafür stand uns nach unseren Ruderteamtreffen PJs Bude zum Texas-Hold’em-Pokerspiel offen. Ich bin ziemlich sicher, dass er, als er trocken wurde und den Fusel aus der Gleichung herausnahm, die Lücke einfach mit mehr Frauen, Poker und Comedy füllte. Die Montagabende bei PJ wurden zu einem düsteren Karneval mit lauter Komikern, trockenen Alkoholikern und Komikern, die trockene Alkoholiker waren. Das Pokerspiel dauerte bis spät in die Nacht, aber eigentlich drehte sich der Wettbewerb darum, wer die schlagfertigsten Sprüche machte. Wann immer ich konnte, schob ich den unvermeidlichen Stapel Schmuddelmagazine von PJs Klavierhocker und setzte mich hin, um ein paar Stunden lang aus vollem Halse zu lachen. Die fünfundzwanzig Dollar, die ich dabei jedes Mal an die anderen verlor, waren mir das allemal wert.
Doch hinter seinen akademischen Erfolgen, seinem hingerissenen Publikum im Comedyklub, den vielen Frauen und der Schar von Freunden nagte etwas an ihm. Über ein Jahrzehnt hinweg fraß eine Macht, ein Dämon oder eine Krankheit an unserem Freund PJ, die sich in einem Winkel seines Geistes eingenistet hatten und wie die Rote Armee entschlossen vorwärtsmarschierten, um immer mehr Gelände einzunehmen.
PJ wurde von einer Menge Leuten geliebt, die aber keine Ahnung hatten, wie sie ihm helfen konnten. Das Ruderteam wachte über seine letzten Jahre, während die moderne Pharmakologie an seiner psychischen Krankheit herumzerrte und -zupfte, ohne ihn je wirklich heilen zu können. Immer seltener erschien er an den Montagabenden, und jedes Mal sah er dünner aus. Es war, als hätte sein Körper begonnen, seiner Seele und seinem Geist zu folgen, die sich nach und nach verabschiedeten. Irgendwann rief er nicht mehr zurück.
Einige Tage, bevor er sich aufhängte, rief PJ mich an. Er wollte, dass ich für ihn betete. Es war zehn Jahre her, dass ich ihn kennengelernt hatte, und in der Zwischenzeit war ich zum christlichen Glauben zurückgekehrt. Ich glaube, ich war der einzige gläubige Mensch, den er kannte. Er stellte sich Fragen über Gott: War er für Gottes Liebe unerreichbar? Ich ließ all meine Coolness und meinen Sarkasmus fahren und betete am Telefon für ihn. Ich bat, er möge die ganz reale und immer verfügbare Liebe Gottes spüren. Ich betete, er möge die rückhaltlose Gewissheit bekommen, dass er ein geliebtes Kind Gottes war. Bestimmt habe ich noch eine Menge anderes Zeug gesagt. Ich wollte gern in der Lage sein, diesen Dämon auszutreiben, der unseren PJ im Griff hatte, von ihm Besitz genommen hatte, der ihn mit Lügen fütterte und das Licht der Liebe Gottes von ihm fernhielt.
Anderthalb Wochen später saß ich in einem riesigen Hörsaal der Universität von Colorado in Boulder (wo ich mit meinen fünfunddreißig Jahren und als verheiratete Mutter von zwei Kindern endlich mein Studium abschließen wollte), als mein Handy klingelte. Ich rannte nach draußen, und die kalte Luft trieb mir die Tränen in die Augen.
Sean, ein Comedy- und Ruderkumpan, sagte: „Nadia, es geht um … um PJ, Liebes.“ „Scheiße“, sagte ich.
„Es tut mir leid“, sagte Sean. Es tat uns allen leid. „Kannst du die Trauerfeier für ihn machen?“
Und das war meine Berufung in den vollzeitlichen Dienst. Meine wesentliche Qualifikation? Ich war die einzige Fromme in unserem Haufen.
Die Trauerfeier fand an einem frischen Herbsttag vor vollem Haus im Klub „Comedy Works“ in der Innenstadt von Denver statt. Das Alkoholiker-Ruderteam und die Komiker von Denver, die Mitarbeiter der Comedyklubs und die Akademiker. Das waren meine Leute. Während ich die Traueransprache für PJ hielt, wurde mir klar, dass ich vielleicht dazu bestimmt war, ihre Pastorin zu sein.
Nicht, dass ich mir besonders heilig oder seelsorgerlich vorgekommen wäre. Aber dort in diesem Kellerraum, in dem es nach abgestandenem Bier und schlechten Witzen roch, schaute ich mich um und sah so viel Schmerz und Fragen und Verlust, dass niemand, auch ich nicht, wusste, wie damit fertig zu werden war. Und ich sah Gott. Gott mitten unter all den Komikern, die da mit verschränkten Armen an der Wand standen, als könnten sie sich mit ihren höhnischen Bemerkungen jegliche peinlichen Emotionen vom Leib halten. Gott dicht an der Seite der Frau, die dort die Bühnentreppe hinabstieg, nachdem sie sich ein bisschen zu offenherzig darüber geäußert hatte, was für ein heißer Liebhaber PJ gewesen sei. Gott mitten unter den Zynikern und Alkoholikern und Tunten.
Ich bin nicht die Einzige, die gleichzeitig die Schattenseite und Gott sieht. Es gibt eine Menge von uns, und wir sind zu Hause in den biblischen Geschichten von Antihelden und Leuten, die nichts kapieren, von Prostituierten und ungehobelten Fischern. Ist denn ein manisch-depressiver Alkoholiker so verschieden von diesem Figurenensemble? Hier, mitten in meiner eigenen Gemeinschaft von Schattenseitenbewohnern, konnte ich nicht mehr anders, als das Evangelium wahrzunehmen, die umwälzende Realität, dass Gott nicht weit weg ist, sondern hier in der Zerbrochenheit unseres Lebens. Und nachdem ich das gesehen hatte, konnte ich nicht mehr anders, als darauf hinzuweisen. Mir wurde klar, dass ich aus Gründen, die ich nie ganz verstehen werde, dazu berufen war, von dorther, wo ich bin, das Evangelium zu verkünden, und vom Evangelium her zu verkünden, wo ich bin.
Angefangen hatte es in der ersten Zeit meiner Trockenheit damit, dass ich mich widerstrebend darauf einließ, wieder mit dem Beten anzufangen. Das hatte zu meiner Rückkehr zum christlichen Glauben geführt, und nun sogar zu etwas noch Ungeheuerlicherem: Ich war zur Pastorin für meine Leute berufen.