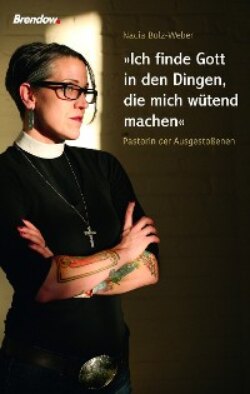Читать книгу Ich finde Gott in den Dingen, die mich wütend machen - Nadia Bolz-Weber - Страница 15
Albion Babylon
ОглавлениеCirca 1988
„Jemand sollte mal diese Lampe in Ordnung bringen“, sagte meine ältere Schwester Barbara. Die langen Leuchtstoffröhren in dem düsteren Kellerflur, der zu dem ebenerdigen Drei-Zimmer-Apartment führte, in dem ich jetzt mit sieben Mitbewohnern lebte, flackerte an und aus wie ein Strobespot und ließ unseren Weg zur dritten Wohnungstür rechts trügerisch kurz erscheinen.
Meine Schwester und ich hatten uns die meiste Zeit meines Lebens sehr nahe gestanden. Sie gab sich auch noch mit mir ab, nachdem ich in diese schmuddelige Wohnung gezogen war. Vor Kurzem hatte ich, schon nach dem ersten Semester, das College geschmissen und besaß nur wenige Habseligkeiten, während Barb gerade ihren Doktor in Englisch an der Universität von Indiana machte und Dinge wie eine Waschmaschine und einen Trockner ihr eigen nannte. Mit meinen neunzehn Jahren besaß ich im Winter 1988 eine einzige Apfelkiste mit lebenswichtigen Dingen: ein zerfleddertes Exemplar der Vegetarischen Landküche, meine Springerstiefel, einen alten Schaufensterpuppenkopf und mehrere unverzichtbare Tonkassetten: Ziggy Stardust, Violent Femmes, Road to Ruin.
Die Ramones. Ich war zwölf, als ich im Big Apple Tapes & Records, gegenüber vom Zuckermaisstand in der Mall of the Bluffs in Colorado Springs, das Album Road to Ruin erstand. Bis zu jenem Tag hatte es in unserem christlichen Mittelschichthaushalt nur Jim Croce, John Denver und das Kingston Trio gegeben. Doch nun mussten diese Burschen mit ihren manikürten Schnurrbärten und milden Manieren Platz machen für vier Jungs aus Queens, weil ich mein ganzes Taschengeld für Road to Ruin von den Ramones ausgegeben hatte. Wochenlang saß ich jeden Nachmittag in meinem Kinderzimmer und nudelte diese Kassette auf meinem orange-weißen Fisher-Price-Plastikkassettenrekorder ab, während ich das Cover anstierte. Im Stillen hoffte ich, vielleicht würden ja Joey und Dee Dee Ramone wie durch Zauberei in ihren zerrissenen Levis und Lederjacken bei mir zu Hause auftauchen und mich mitnehmen. Die zornige Punkmusik kam mir vor, als wäre sie eigens für mich gemacht.
Als meine Liebesaffäre mit den Ramones begann, ahnten meine Eltern nichts davon, dass ich mir Punkrockalben kaufte. Ebenso wenig wussten sie, dass ich in der Schule Essen klaute. Die Lehrer in meiner Junior High School ließen Snacks auf ihren Pulten liegen, und ich hatte solchen Hunger, dass ich mir ihre Müsliriegel oder Chipstüten schnappte, nicht etwa, weil es zu Hause nicht genug zu essen gegeben hätte, das schon, aber ich konnte einfach nicht genug kriegen, egal, was ich mir alles in meine Brotdose oder in den Mund stopfte.
Ich war elf, als ich allmählich anfing, immer weniger zu wiegen und immer mehr zu essen. Und meine Eltern, Dick und Peggy, mit ihrer liebevollen Art und ihrem unerschütterlichen Optimismus, dachten sich, das sei bestimmt nur ein Wachstumsschub, und munterten mich auf, stolz auf meine Größe zu sein und mich gerade aufzurichten. Als im Jahr darauf meine Handschrift so schlecht wurde, dass meine Noten ins Trudeln gerieten, kaufte mir meine Mutter ein wunderschönes Kalligrafieset in der Hoffnung, mich dadurch zu etwas mehr Ehrgeiz bei meinem Federschwung anzuspornen. Und als ich blass und antriebslos wurde, war meine Mutter der Meinung, ich müsse eben mehr hinaus an die frische Luft von Colorado und ging mit mir zum Skilanglauf. Das war der Tag, als sie merkte, dass irgendetwas mit mir nicht stimmte, und zwar nichts, was sich mit Disziplin und Optimismus wieder in Ordnung bringen ließ. Auf dem Weg in die Berge schlief ich auf dem Rücksitz unseres Chevy Citation, und die Bewegungen des knüppelgeschalteten Wagens drehten mir den Magen um. Später, als wir uns endlich ausstaffiert hatten und auf die Loipe gingen, kam mir mein Wollpullover so schwer vor wie eine von diesen bleiernen Röntgenschürzen, und meine Beine wollten sich einfach nicht bewegen. Schließlich quengelte ich so lange, bis wir uns auf den Heimweg machten. Außerdem hatte ich den ganzen Proviant bereits vertilgt. Als wir nach Hause kamen, vereinbarte meine Mutter einen Termin beim Arzt.
Wie sich herausstellte, hatte ich Morbus Basedow. Das ist eine Autoimmunerkrankung der Schilddrüse, die im Körper allerlei lustigen Unfug anstellt: beschleunigter Herzschlag, Handzittern, Blässe der Haut, gesteigerter Stoffwechsel, Antriebslosigkeit, Manie, Depression und Hitzeempfindlichkeit. Sie wirkt wie Methamphetamin, nur ohne das gute Gefühl dabei. Ach ja, und sie ist kostenlos.
Durch die Krankheit hatte sich hinter meinen Augen Fettgewebe angesammelt, sodass sie aus ihren Höhlen nach vorn gedrückt wurden. Meine Augäpfel wölbten sich so weit aus meinem Schädel heraus, dass ich meine Lider nicht mehr schließen konnte. Das Weiße war überall rund um die Iris zu sehen, so als hätte ich gerade einen Stromschlag abbekommen oder etwas Grauenhaftes gesehen … nur dass ich immer so aussah.
Immer.
Von zwölf bis sechzehn Jahren. Jeden Tag meines Lebens.
Meine Mutter fuhr jeden Monat mit mir nach Denver zu irgendwelchen Augenärzten, die darüber wachten, dass meine Hornhäute keinen Schaden nahmen (ich schlief jetzt immer mit einer Augensalbe, damit mir die Augen nicht austrockneten), aber zugleich auch meine Gesichtsknochen vermaßen. Die Sache mit den Glupschaugen ließ sich operativ korrigieren. Aber erst, wenn meine Gesichtsknochen aufgehört hatten zu wachsen. Und wie ich herausfand, kann man seine Gesichtsknochen nicht durch Disziplin oder Optimismus vom Wachsen abhalten.
Die meisten Jugendlichen in der Junior High School fanden, sie sähen aus wie Insekten. Bei mir stimmte das wirklich. Im Schulbus verbrachte ich an den meisten Tagen die zwanzig Minuten Fahrzeit damit, meine Handflächen auf die Augen zu pressen, weil ich dachte, wenn ich mich nur entschlossen und beharrlich genug anstrengte, könnte ich meine Augen wieder zurück in den Schädel zwängen. Aber das funktioniert einfach nicht. Jugendliche können ihre geschiedenen Eltern nicht wieder zusammenwünschen. Sie können auch nicht durch Superleistungen in der Schule ihre manisch-depressive Mutter davon abhalten, verrückt zu sein. Und sie können ihre Froschaugen nicht zurück in den Schädel zwingen, indem sie auf der Busfahrt in die Schule zwanzig Minuten lang draufdrücken. Aber das alles hat noch keine Jugendlichen davon abgehalten, es zu versuchen.
Ich weiß nicht genau, ob der Tyrann auf der letzten Sitzreihe zur Serienausstattung aller Schulbusse in Amerika gehört, zusammen mit dem Feuerlöscher und dem großen Türhebel beim Fahrersitz, aber es kam mir jedenfalls so vor. Meine serienmäßige Tyrannin war gar nichts Besonderes: ein Mädchen namens Becky, größer als die meisten anderen, mit zerzausten Haaren, das immer Def-Leppard-T-Shirts anhatte.
Sie bemerkte meine Handflächen über den Augen, und als sie die anderen darauf hinwies, log ich. „Was machst du denn da?“, fragte Becky höhnisch. „Willst du dir etwa die Froschaugen wieder reindrücken?“
„Ich meditiere“, sagte ich. „Buddhistisch.“ Und dann setzte ich mich mit meinen dünnen Beinen im Schneidersitz auf die Bank im Bus.
Am nächsten Tag setzte ich einfach eine Sonnenbrille auf.
Irgendwann fing ich dann an, die Augen zuzukneifen und niemanden direkt anzuschauen, wenn ich durch die niedrigen Flure der Horace Mann Junior High School ging, so wie die Frühentwicklerinnen unter den Mädchen sich ihre Mappen vor die Brust hielten. Doch wenn ich auch die Augen abwandte – das Kinn ließ ich niemals sinken. Nicht ein einziges Mal.
Jeder hat seine eigene Horrorgeschichte aus der Schulzeit. Es ist eine Feuerprobe, und was für ein Mensch schließlich aus uns wird, lässt sich meist in die siebte Klasse zurückverfolgen. Dabei reagiert jeder anders auf seine Schulerlebnisse. Was sich in mir zusammenbraute in jenen niedrigen Fluren, war mehr als nur ein „Zornproblem“, wie es später genannt wurde. Das tägliche Sperrfeuer bösartiger Bemerkungen, das mir Becky und andere entgegenspien, machte mich zwar zornig, aber irgendwie war der Zorn auch ein Schutz. Dieser Schutz bestand aus Zynismus und einem geschärften Gespür dafür, wenn Leute Bullshit erzählen. Nach einer Weile konnte ich das riechen wie ein Drogenspürhund auf einem kolumbianischen Flughafen.
Meiner Kirchengemeinde muss ich bei all ihren Fehlern eines lassen: Sie war der einzige Ort außerhalb meines Elternhauses, wo die Leute mich nicht angafften oder sich über mich lustig machten. In der Gemeinde wurde ich mit meinem Namen begrüßt anstatt mit irgendwelchen Spottbezeichnungen. In der Gemeinde konnte ich zur Jugendgruppe gehören. In der Gemeinde starrte mich niemand an. Deshalb war es auch so schlimm für mich, dass es letzten Endes andere Gründe gab, warum ich dort nicht hinpasste.
Dass ich zur Church of Christ gehörte – und somit Christ war –, bedeutete vor allem, dass ich sehr gut darin war, gewisse Dinge nicht zu tun. Nicht zu trinken natürlich, nicht bissig oder sarkastisch zu sein, keinen Sex außerhalb der Ehe zu haben, nicht zu rauchen, nicht zu tanzen, nicht zu fluchen, mich nicht in Leute außerhalb der Gemeinde zu verlieben und natürlich, was vielleicht das Wichtigste überhaupt war, nicht mit einer gemischten Gruppe baden zu gehen. Je besser man es hinkriegte, diese Dinge nicht zu tun, desto besser war man als Christ. Schon damals kam es mir nicht so vor, dass es die Gnade Gottes oder die radikale Liebe Jesu war, die die Leute in der Church of Christ vereinte; es war ihre Fähigkeit, gut zu sein. Oder zumindest ihre Fähigkeit, gut zu scheinen. Und das kriegt nicht jeder hin.
Während ich also trotz meiner Froschaugen in der Gemeinde akzeptiert wurde, waren die Wut und der Zynismus, die sich in mir infolge dieser Froschaugen angestaut hatten, ganz und gar „nicht christlich“. Meine neu entdeckte Vorliebe für das Wort „Bullshit“ zum Beispiel war nicht christlich. Der Punkrock bewies mir, dass es da draußen noch andere Leute gab, die auch schreien und einen draufmachen wollten, und das veränderte mein Leben. Aber auch Punkrock, Schreien und einen draufmachen waren – nicht christlich. Und damit war ich nicht christlich.
Ich setzte meinen unchristlichen Weg fort, indem ich sechs Monate vor meiner Augenoperation anfing zu trinken. Wenn wir dann vier Jahre vorspulen, war ich eine nun nicht mehr froschäugige Neunzehnjährige mit lila Haaren, einem Alkoholproblem, einem Einstellungsproblem und einem Kein-Tagohne-Joint-Problem.
Die meisten Gleichaltrigen waren inzwischen auf dem College. Ich hatte das auch versucht, war aber schon nach vier Monaten gescheitert. Mit meiner Fähigkeit, zu trinken „wie ein Mann“, hatte ich zwar bei den Verbindungsstudenten mächtig Eindruck gemacht, aber ich hatte es nicht geschafft, mich auch mal im Hörsaal blicken zu lassen. Erst später dämmerte mir, dass es zwischen diesen beiden Dingen vielleicht einen Zusammenhang gab.
Nach meinem eher mittelmäßigen Schulabschluss hatte ich mich, sozusagen, in die Pepperdine-Universität hineingeschmeichelt. Genau genommen war das eine Hochschule der Church of Christ, aber da sie sich in Kalifornien befand und nicht in einem richtigen christlichen Staat wie Texas oder Tennessee, war sie den Traditionalisten suspekt. Bedenkt man, wie die Gemeinde über „gemischtes Baden“ dachte – Jungen und Mädchen gleichzeitig im selben Schwimmbad –, muss ihnen eine Hochschule der Church of Christ im Strandparadies Malibu ähnlich widersinnig vorgekommen sein wie ein amisches Internat auf dem Strip in Las Vegas.
Nach meinem kurzen Ausflug aufs College ging ich zurück nach Denver. Nachdem ich dort ein paar Monate lang in einem schicken mexikanischen Restaurant mit vernachlässigbarem Essen Teller gewaschen hatte, traf ich Scotty, einen neunzehnjährigen Kiffer mit langem Kreuz und großem Herzen, der eine Wohnung in der Albion Street hatte und sagte, da könne jeder unterkommen. Keine Woche später half Barb mir beim Einzug.
An dem Abend, als ich einzog, deutete meine Schwester von der offenen Wohnungstür aus auf den versifften Küchentresen, eine riesige grüne Bong, ein Zimmer voller Matratzen auf dem Fußboden und einen Kerl, der auf einem zerfledderten Sofa schlief. „Schätzchen“, flüsterte sie, „ist das dein Ernst?“
Wir haben nun mal nicht alle das Zeug zur Akademikerin, Barb, dachte ich im Stillen.
Die Wohnung wurde rasch zu meinem Heim und die Leute dort meine Ersatzgemeinschaft. Wir teilten unsere Drogen redlich und versuchten, dafür zu sorgen, dass jeder etwas zu essen bekam. Schon vor meiner Ankunft hatte jemand einen blaugelben „Sag-nein-zu-Drogen“-Aufkleber auf die über einen Meter lange Fiberglas-Bong im Wohnzimmer geklebt. Sie stand an einer nikotinvergilbten Wand, an der ein „Reaganstein“-Poster hing (Ronald Reagan mit grünem Gesicht und Bolzen im Kopf, die Arme drohend erhoben). Gekocht wurde nicht viel in der Wohnung, höchstens mal eine Packung Ramennudeln. (Und einmal briet jemand eine Klapperschlange; eine dieser Suffaktionen, um die Mitbewohner bei Laune zu halten und allen Konventionen zu trotzen. Sie vergammelte, bevor jemand – ich war es nicht – auf den schlauen Gedanken kam, sie auf den Müll zu schmeißen.) Wir nannten unsere Schmuddelbude „Albion Babylon“.
An meinem ersten Abend in Albion Babylon packte ich meine Habe aus und merkte bald, dass die Apfelkiste das einzige Möbelstück war, in dem ich meine Sachen verstauen konnte. Also stellte ich sie auf die Seite wie einen kleinen Geschirrschrank und stapelte darin alles so ordentlich auf, wie es eben ging. Dann nahm ich einen schwarzen Markierstift, zeichnete einen Kreis um den Apfel und überlegte, ob ich ein Friedens- oder ein Anarchiesymbol daraus machen sollte. Frieden. Nein … Anarchie. Ich versuchte, beides zu kombinieren, sodass es schließlich aussah wie irgendein Emblem aus Star Trek. Die alte Matratze auf dem Fußboden bedeckte ich mit einem fröhlich gelb geblümten Laken und meiner Bettdecke. Ich war so dankbar dafür, einen Platz zum Schlafen zu haben, der nicht mit lauter Erwartungen an mich befrachtet war wie mein Elternhaus, mein Wohnheim an der Pepperdine oder, Gott behüte, die Church of Christ.
Doch trotz all dem Blödsinn dort und der Versessenheit darauf, gut zu sein, und der Ausgrenzung von Leuten, die nicht auf deren spezielle Weise „gut“ waren, war die Church of Christ, in der ich aufwuchs, doch eine Gemeinschaft. Als Gemeindeglieder teilten wir unser Leben miteinander. Dreimal in der Woche versammelten wir uns in einer großen Schar zum Gottesdienst, um zu singen, zu beten und miteinander Abendmahl zu feiern. Und während der übrigen Woche verbrachten wir unsere Zeit mit Leuten aus der Gemeinde. Insbesondere das Haus meiner Eltern war ein beliebter Treffpunkt. Immer aßen irgendwelche Leute mit an unserem Tisch, schliefen auf unseren Sofas und studierten in unserem Wohnzimmer die Bibel.
Einmal stand ein junges Pärchen bei uns auf der Matte. „Wir sind Freunde von den Slaters aus Detroit und gerade auf Durchreise in Denver. Sie haben gesagt, wir könnten vielleicht hier übernachten.“
„Zieht euch ein Sofa aus“, sagten meine Eltern dann. „Hier habt ihr ein paar Handtücher. Helft ihr mir beim Karottenschälen?“
So ging es bei uns zu Hause zu, und es war irgendwie schön. Doch so wie jedes andere Kind auf unserem Planeten merkte ich erst viel später, wie komisch meine Familie eigentlich war. Im Gegensatz dazu, wie ich über den christlichen Fundamentalismus dachte, von dem ich mich bald trennen würde, habe ich nie aufgehört, diese geistliche Merkwürdigkeit der Gastfreundschaft und Gemeinschaft zu schätzen. Und ohne es zu merken, verbrachte ich die nächsten zehn Jahre mit dem Versuch, mir selbst so eine geistliche Gemeinschaft zu erschaffen. Nur war ich auf der Suche nach einer Gemeinschaft, in die wirklich alles an mir hineinpasste.
Kurz, ich war begeistert davon, dass ich Albion Babylon gefunden hatte. Wir fühlten uns wie eine Gemeinschaft. Wir lachten jede Menge in unserem ebenerdigen Apartment, tranken um die Wette und gingen nicht oft vor die Tür. Scotty, der Typ aus dem mexikanischen Restaurant, hatte schon einen Entzug hinter sich. Einmal zeigte er mir ein Buch, dass er angefertigt hatte: eine Art Sammelalbum in einem braunen Umschlag mit Fotos, Zeichnungen und Texten. Das war so ein Selbsterkenntnisprojekt, das er in der Therapie hatte machen müssen. Jetzt versteckte er sein Gras darin. Ich liebte ihn wegen seiner Gedichte und Bilder, und weil er Gras in seinem Patientenalbum aufbewahrte. Es kam mir vor wie ein schallendes „Leckt mich“ an seine Eltern, die sich „solche Sorgen“ um ihn machten.
Daraufhin machte ich mir auch so ein Buch: eine Zeichnung, ein schlechtes Gedicht, eine Liste meiner Helden, meiner Fehler und meiner Stärken. Helden: 1. Jesus Christus, 2. Che Guevara. Stärke: Humor. Fehler: Weglaufen. Ich notierte, Jesus sei ein echter Revolutionär gewesen, und das Christentum hätte leider seinen Ruf ruiniert. Meine Ziele mit neunzehn waren: mehr zu reisen, in einer Kommune oder irgendwie gearteten verbindlichen Gemeinschaft zu leben und durch revolutionäres Handeln zum Weltfrieden beizutragen.
Als mit der Zeit zwei weitere Mitbewohner zu uns stießen, beschlossen wir, uns ein Haus zu mieten, ein Ranchhaus aus hellen Ziegeln an der Humboldt Street, ganz in der Nähe der Iliff School of Theology. Dort würde ich später einmal studieren, aber damals bemerkte ich sie überhaupt nicht. Im Humboldthaus, unserem neuen Zuhause, fühlten wir uns alle frei von Einschränkungen und Konventionen und Bemutterungsversuchen unserer Eltern, und einen Garten hatten wir auch.
Meine Freunde und ich hatten nun also ein richtiges Zuhause, und während der Typ mit den gelichteten Zahnreihen aus Alabama in einigen Zimmern Hydrokulturen für unser Gras anlegte, beschloss ich, mich um die traditionelleren Haushaltstätigkeiten zu kümmern. Ohne die leiseste Ahnung vom Brotbacken oder von der Gemüsegärtnerei zu haben, versuchte ich mich an beidem. In beiden Fällen fielen die Resultate trocken und krümelig aus. Ich schmiss einfach Samenkörner auf den trockenen Boden und dachte, wir könnten von dem leben, was dabei herauskam. Aber es wuchs nichts. Und ich hatte immer noch Hunger. Daneben dekorierte ich den Rand des Linoleumfußbodens in meinem Kellerzimmer mit meinen leeren Wodkaflaschen, die ständig von meinen Mitbewohnern und ihren Freunden und Freundinnen (mit denen ich hin und wieder „versehentlich“ schlief) umgestoßen wurden.
Sonntagmorgens, wenn ich meinen Kater abschütteln konnte, schlich ich mich manchmal, ohne recht zu wissen, warum, zu einer Quäkerversammlung in der Nähe. Das war eine liberale Gemeinde, wo niemand etwas sagte. Ihr Gottesdienst bestand aus einem gemeinsamen Erleben der Stille. Es gab keine Predigt und keine Männer, die sich in endlosen wichtigtuerischen Gebeten ergingen. Es war ein beruhigendes, vertrautes Gefühl, mit einer Gemeinschaft von Leuten auf diesen Eichenbänken zu sitzen. Außerdem gefiel es mir, dass niemand mir dort sagte, was ich tun müsse, um ein guter Mensch zu sein. Die Leute, die an diesen stillen Vormittagen dort um mich herumsaßen, bestellten richtige Gärten und protestierten gegen Kriege und lasen die New York Times. Sie waren freundlich und verloren nie ein Wort über den Geruch des noch nicht vollständig verstoffwechselten Alkohols vom Vorabend, den ich verströmte.
Doch obwohl die Quäker eine Gemeinschaft waren, gehörte ich nicht wirklich dazu. Ich war eher so etwas wie eine Zuschauerin. Meine Gemeinschaft lag ein paar Häuser weiter noch in den Betten und schlief ihren Rausch aus. Doch bei uns zu Hause liefen die Dinge allmählich aus dem Ruder. Die Leute wurden immer schlampiger. Ein Typ hatte sich eine Knarre zugelegt, und unser Redneck aus Alabama hatte angefangen, mit Speed zu handeln. Immer mehr Fremde tauchten bei uns auf. Um den Garten kümmerte sich niemand. Mir war der Garten eigentlich auch egal. Wir alle taten einfach nur das, wozu wir Lust hatten. Ich war von allen enttäuscht, und Brot zu backen versuchte ich auch nur das eine Mal.
Wie sich herausstellte, hätte eine Gemeinschaft, wie sie mir vorschwebte, aus Leuten bestanden, die nicht auf die Idee kamen, den Motor eines 1981er Honda Civic auseinanderzunehmen und vier Monate lang im Wohnzimmer herumstehen zu lassen. Aus Leuten, die, wenn ihr Kater auf meine Bettdecke pinkelte, in Erwägung ziehen würden, den Kater kastrieren zu lassen oder wenigstens die Reinigung zu bezahlen. Sie würden diesen Vorfall nicht einfach als Gelegenheit nutzen, mich mit glasigem Blick darüber aufzuklären, wie verkrampft ich doch sei und dass eigentlich niemand das Recht habe, sich an den Fortpflanzungsorganen eines anderen Tiers zu schaffen zu machen … Mann! Und vielleicht vor allem anderen wollte ich in einer Gemeinschaft mit Leuten leben, die nicht nur imstande waren, ein einstmals froschäugiges Mädchen zu lieben, sondern auch zuverlässig die Toilettenspülung zu bedienen. Und verdammt, vielleicht legten sie auch Wert auf eine Mitbewohnerin, die nicht mit ihren Freunden und Freundinnen schlief.
Am Anfang hatten wir uns gegenseitig gemocht, aber letzten Endes wusste keiner von uns, wie man sich umeinander kümmert. Doch diese Erfahrung lehrte mich, dass eine Gemeinschaft, die darauf fußt, dass Regeln und Vorschriften bei allen verhasst sind, letztlich genauso enttäuschend und bedrückend ist wie eine Gemeinschaft, die auf der Fähigkeit fußt, Regeln und Vorschriften zu befolgen.
Ich zog aus. Zwei Wochen später nahmen die Bullen das Haus auseinander.