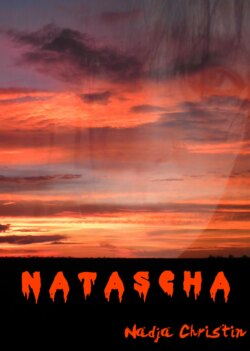Читать книгу Natascha - Nadja Christin - Страница 3
Ein Traum
ОглавлениеIch renne was meine Beine hergeben.
Ich laufe um mein Leben, um mein Herz, um alles was ich bin, oder vielleicht je sein werde, und ich laufe um meine verfluchte, verdorbene Seele.
Sie sind hinter mir her.
Ich ahne, nein, ich weiß es, sollten sie schneller sein, und mich erwischen, dann ist es aus mit mir. Ich muss sterben, denn sie werden mich unbarmherzig töten.
Ich kenne meine Verfolger genau, und ich kann ihre Wut und ihre Lust mich zu töten spüren, sie förmlich riechen.
Ich bilde mir ein, ihren widerlichen Atem schon in meinem Nacken zu fühlen und ich höre etwas, das ihr Knurren sein könnte.
Es erklingt in einem wilden, mörderischen Rhythmus.
Wenn ich so viel Mut hätte mich umzudrehen, würde ich bestimmt den Geifer von ihren langen Zähnen spritzen und die Mordlust in ihren Augen leuchten sehen.
Aber so viel Mumm habe ich nicht, ich bin eher von der feigen Sorte, so laufe ich lieber vor ihnen davon.
Plötzlich wird mir klar, dass sie mich jagen, sie treiben mich vor sich her. Es ist nicht mein eigener Wille, der mich in diese bestimmte Richtung laufen lässt, sie lassen mich nur in dem Glauben.
Eigentlich bestimmen sie den Weg, ich renne nur vor ihnen her.
Ich werfe hektische Blicke um mich, suche fieberhaft nach einem Ausweg. Einem anderen, als dem Unausweichlichen.
Ich will noch nicht sterben und vor allem nicht so:
Zerrissen, zerfleischt und vielleicht noch aufgefressen von … ihnen.
Ich will friedlicher in die ewige Verdammnis einziehen, am liebsten würde ich den Zeitpunkt meines endgültigen Todes selbst bestimmen.
Der sähe bestimmt nicht so aus, und er wäre auch nicht jetzt, und hier schon gar nicht.
Ich bin nicht gläubig, na ja, ich glaube an Vertrauen, Freundschaft und an die Liebe, aber ich bin nicht sehr fromm. Aus meiner Erfahrung weiß ich allerdings, dass es den Teufel gibt. Also, warum soll nicht auch ein Gegenteil zu ihm existieren? Warum soll es nicht auch einen Gott geben.
Ich habe nie gelernt zu beten, aber jetzt, in diesem Moment, wünsche ich mir tatsächlich, ich könnte zu jemandem beten.
In meinen Erinnerungen krame ich nach irgendwelchen Sprüchen, nach einem Psalm oder Gebet und sei es auch nur eine Kinderfürbitte. Aber mir fällt nichts ein, wie immer in solchen Situationen erinnere ich mich nur an Legenden, an Mythen und sehr alte Geschichten.
Mordgierig und blutrünstig, wie das eben alte Geschichten so an sich haben.
Ich riskiere einen schnellen Blick über meine Schulter, genau in diesem Augenblick bleibe ich mit dem Fuß an irgendetwas hängen. Ich strauchele, rudere wild mit den Armen, es hilft nichts, in einem hohen Bogen falle ich nach vorne.
Dumpf pralle ich auf dem Boden auf, spüre einen weichen Untergrund, höre alte Blätter unter mir knirschen und vertrocknete Äste brechen.
Ich bin in einem Wald, denke ich erstaunt. Bis hier hin war mir nicht bewusst, wo genau ich bin. Alles um mich herum war eine einzige Schwärze, eine undurchdringliche schwarze Dunkelheit.
Vorsichtig hebe ich den Kopf und blicke mich um. Es ist niemand da, ich sehe und höre auch nichts. Nachdenklich stemme ich mich hoch.
Das ist aber merkwürdig, eben waren sie noch hinter mir her, das weiß ich genau. Ich habe sie gespürt und gehört, nur gesehen … das habe ich sie nicht.
Ich beiße mir auf die Unterlippe. Ich bin kurz davor, ein lautes Hallo, in den dunklen Wald zu rufen.
Wie man das aus billigen Horrorfilmen kennt, setzt das baldige Opfer noch ein: Ist da jemand hinten dran und ist dann völlig verwundert, wenn es eine Antwort erhält.
Aber ich kann das verstehen, selbst mir fällt es schwer, diesen Fehler nicht zu begehen.
Plötzlich, wie aus dem Nichts, zieht Nebel auf, dicker, milchiger Dunst.
Ich schnaufe entrüstet, und stemme meine Hände in die Hüften, das hier kann nur ein Traum sein. Das unerwartete Auftreten von Nebelbänken existiert in der wirklichen Welt nicht, sie sind nur der Erguss aus den verworrenen Gehirnen der Autoren von Gruselromanen.
Ich stoße ein Lachen aus, es hört sich zittrig an und nicht echt. Die Furcht sitzt mir, trotz allem, noch tief im Nacken.
Gerade überlege ich, ob ich mich einfach abwenden und meiner Wege gehen soll, da taucht unerwartet etwas aus dem dichten Nebel auf.
Eine Gestalt ist auszumachen, erst nur die Umrisse, aber je näher sie kommt, umso deutlicher wird sie.
Der milchige Dunst scheint aber nicht nur vor mir zu sein, er hat wohl auch schon mein Gehirn erreicht. Das Denken fällt mir zunehmend schwerer, die Gedanken driften immer wieder ab. Ein Schleier aus Blut und Tod drängt sich zwischen die Vernunft, die Angst und meine Instinkte.
Ich hebe meine Hand, um mir damit über die Augen zu wischen, aber es ist ein Gefühl, als gehöre das Körperteil zu jemand anderem, einer der meilenweit entfernt ist.
Mit einem Mal hat er mich erreicht, er steht vor mir, lächelt mich an. Seine kalten Hände ruhen einen Augenblick auf meinen Hüften, umarmen langsam meinen dürren Körper.
Bevor auch nur ein Gedanke an Gegenwehr es durch die dicke Nebelsuppe in meinem Kopf schafft, lehne ich meine Stirn gegen seine eiskalte Schulter.
Seine Wange streicht über meine. Wie eisig seine Haut ist, kühl und angenehm. Sein Atem kitzelt mich am Ohr. Ich will ihm unbedingt in die Augen sehen, so hebe ich meine verkrampften Hände und halte sein Gesicht fest, sehe in seine Augen, in diese wunderschönen braunen Augen.
Eine unendliche Tiefe erwartet mich. Die Pupillen wirken, als brenne ein Feuer in ihnen, ein alles verschlingender Vulkan.
Sie scheinen mich an zuschreien: »Versinke in uns, ertrinke in uns, du brauchst nie wieder an die Oberfläche zu gelangen, nur hier bei uns findest du den Frieden, den du dir so sehr wünschst.«
Fast möchte ich dem Feuer zustimmen, ich will meine Augen schließen und unter die Oberfläche tauchen, mitten in das heiße Brennen. Mich einfach fallen lassen, hinab in diese unendlich tiefen Brunnen.
Ich bin bereit, um für immer zu versinken, endlich meinen Frieden zu finden.
Da wird das Feuer der Pupillen größer, es flackert kurz und wächst an. Verschlingt langsam das ganze Braun der Iris, wird immer gelber, das Schwarz der Pupille wird länglich, scheint sich auszudehnen, sie werden zu Schlitzen, senkrechte Schlitze.
Raubtieraugen.
Hungrig blicken sie mich an, ein Knurren, wie ein Donnergrollen, ist zu hören. Es scheint nicht aus seinem Inneren zu kommen, sondern von überall her. Um mich herum ist nur noch dieses Knurren zu hören, es hüllt mich ein.
Ich bin total erstarrt, blicke wie hypnotisiert auf die Veränderung seiner einst so schönen Augen.
Ein Zischen, ein Fauchen, er öffnet seinen Mund, wirft den Kopf in den Nacken.
Ich sehe Zähne blitzen, lang und spitz.
Keinerlei Furcht ist in mir, nur ein unheimliches, aber zugleich tröstliches Gefühl, und das Wissen darüber, dass ich gleich erlöst bin.
Ich werde meinen Frieden finden.
Ich schließe die Augen und erwarte den Schmerz.
Erwarte, dass Justin mich beißt.
Sein Kopf schnellt nach vorne, und er schlägt mir seine Zähne in den Hals.
Gegenwart:
Erschrocken reiße ich die Augen auf und schnappe ein paar Mal gierig nach Luft.
Trotz meiner ausgebreiteten Arme, muss ich mich anstrengen, damit ich das Gleichgewicht nicht verliere.
Ich stehe hoch über dem Boden, fünfzehn Meter mindestens, auf den Überresten unserer Stadtmauer. Am höchsten Punkt, der es mir ermöglicht, meine Füße dicht nebeneinander zu stellen, auf den äußersten Zinnen.
Hier oben ist mein Lieblingsplatz, hier kann ich ungestört nachdenken und meine Gedanken und Erinnerungen kreisen lassen.
Was mich eben so erschrocken auffahren ließ, war aber weder eine Erinnerung, noch ein Traum. Letzteres ganz bestimmt nicht, da ich nicht schlafen kann, also kann ich auch nicht träumen.
Aber es war ein Gemisch aus Erinnerungen, Geschehnisse aus vergangenen Zeiten, gepaart mit … Ja, mit was genau.
Mit Wunschdenken?
Aber ich will eigentlich nicht sterben.
Selbst die Wahrheiten, die diese … nennen wir es mal Vision, beinhaltete, schmerzen sehr.
Mehr, als ich je zugeben würde, viel mehr, als ich es mir selbst eingestehen würde.
Warum nur sollte Justin mich beißen oder töten, wollen?
Gut, er hasst mich. Aber ist das schon Grund genug?
Wenn jeder jeden umbringen würde, nur weil er ihn hasst, dann ist die Welt bald sehr arm an Menschen und anderen Geschöpfen.
Er ist völlig verrückt, auch ein Grund, aber kein sehr guter.
Wie wäre es damit:
Ich habe ihn in einen Vampir verwandelt. (Schon besser!)
Ohne seine Erlaubnis. (Oh la, la!)
Im Schnellverfahren. (Jetzt kommen wir der Sache schon näher!)
Ich habe versucht ihn zu töten. (Es wird wärmer!)
Mehrmals. (Und da wunderst du dich?)
Ich habe dazu beigetragen, dass er vom hohen Rat der Vampire festgenommen wurde. (Noch wärmer)
Seine Verurteilung steht kurz bevor, ich denke das Urteil wird seinen sofortigen Tod nach sich ziehen. (Finger verbrannt!)
Aber, er ist verrückt, völlig wahnsinnig. (Hm.)
Das ist teilweise meine Schuld. (So, so.)
Und ich … (ja?)
Ich habe ihn geliebt …
Früher.
Damals, als der Wahnsinn noch nicht von ihm Besitz ergriffen hat.
Vor langer Zeit.
Vor unendlich langer Zeit.
So kommt es mir jedenfalls vor, in Wahrheit liegen gerade mal zwei lausige Jahre dazwischen, die es allerdings in sich hatten.
Frank, mein Mentor und … nun ja, so etwas wie mein Vater, hat mich damals in einen Vampir verwandelt und in den Clan eingeführt.
Die Vampire des Clans, Thomas, Elisabeth und die arrogante Jeanie. Es waren noch einige mehr, aber an sie habe ich nur eine verschwommene Erinnerung.
Dann war, und ist, natürlich noch Josh. Mein bester Freund Josh. Egal, was ich noch tun werde, oder in der Vergangenheit bereits getan habe, immer wird Josh zu mir halten.
Ansgar, mein geliebter Vampir, vom alten Schlag. Uns verbindet mehr, als nur die Augen der engen Verbundenheit.
Es ist Liebe.
Wahre Liebe, bist über den Tod hinaus. Eine Zuneigung, die niemals enden wird, egal, was geschieht.
Ich sehe sie alle ganz deutlich vor mir, als stünden Freund und Feind gemeinsam mit mir, hoch über dem Boden, auf der Ruine der alten Stadtmauer.
Ich lächle ihnen zu, sie lächeln zurück.
Dann zerfällt das Bild, zerfließt, wie ein Aquarell, über das ein Unhold Wasser schüttete.
Ein Gesicht umkreist die verlaufenden Farben, sein Gesicht.
Auch er grinst mich an, aber es ist nicht ehrlich, ich erkenne so etwas, es erreicht seine Augen nicht.
Diese Augen, die tiefen Brunnen, die einen hinab ziehen wollen, in ihre grausamen, dunklen Tiefen. Dort unten, wo der Wahnsinn herrscht, wo nur Kälte ist.
Keine Liebe, keine Freundschaft, keine Hoffnung, nur Grausamkeiten, Feuer und Tod erwarten einen dort unten.
Die Hölle, die auf uns alle sehnsüchtig wartet, könnte nicht schlimmer sein.
Dabei war er nicht immer so. Auch er war einst ein Mensch. Ein Junge, von fünfundzwanzig Jahren, mit braunen, verwuschelten Haaren und einem schlaksigen Körper. Seine braunen Augen blickten, als ich ihn das erste Mal traf, hektisch und ängstlich um sich. Kein Wunder, wer ist schon gerne alleine mit sieben Blutsaugern in einem Raum.
Ich befand mich nur dort, um meinen nächsten Auftrag von Frank entgegen zu nehmen. Natürlich verdonnerte er mich sogleich dazu, Justin unter meine Fittiche zu nehmen, um ihn in unsere Welt einzuführen.
Mich… ausgerechnet!
Wie wäre nur alles gekommen, wenn Frank, statt meiner, Jeanie oder Thomas damit beauftragt hätte?
Aber es war nicht nur Franks ausdrücklicher Wunsch, sondern es gehörte auch noch zu seinem hinterhältigen, blutigen Plan.
Womit beginnt nun meine Geschichte?
Mit meinem ersten Atemzug von Justins Geruch?
Mit meiner Jagd auf die hübsche Blondine, die erst ein paar Stunden zurück lag?
Mit meinem Treffen mit Frank? In dessen Verlauf er mich, wie üblich, maßregelte?
Nein, ich habe noch so viel Zeit, dass ich abschweifen kann. In ein Jahrhundert, in dem es weder mich als Mensch, noch als Geschöpf der Nacht gab.
In eine überaus dunkle Zeit.
Hexenverbrennungen völlig normal, Ketzerei, Zauberei, Drachen, Helden, Tod und Teufel, alles war möglich, alles war denkbar.
Die Menschen glaubten an diese Dinge. Sie waren noch nicht so aufgeklärt und abgebrüht wie heute.
Schließlich war es das 18. Jahrhundert.
Sie glaubten … Vielleicht auch, weil einige von ihnen
… wussten.
Damals berief der hohe Rat der Vampire eine Versammlung ein, um mit Ihresgleichen das weitere Zusammenleben zwischen Vampiren und Menschen zu erörtern.
Es war einfach klar, dass es so nicht weitergehen konnte. Die Vampire schlachteten wahllos Menschen ab, es würde früher oder später auffallen.
Während verschiedener Kriege, Revolutionen oder sonstigen, von den Menschen angezettelten Massenvernichtungen, hatten die Blutsauger leichtes Spiel. Die Toten fielen nicht sonderlich auf. Aber in Friedenszeiten, wurde es immer schwieriger für die Vampire an frisches Blut zu kommen, ohne die Aufmerksamkeit der Menschen auf sich zu ziehen.
Es wurde beschlossen, dass mehrere sogenannte Clans der Vampire in verschiedene Gegenden entsendet wurden, um für Ordnung zu sorgen. Sie sollten die Städte und umliegende Dörfer besetzen. Nur der Ausschuss sollte dran glauben, nur die Verbrecher und Taugenichtse. Im 18. Jahrhundert gab es davon noch mehr als genug, vielmehr, als heutzutage.
Keine Unschuldigen sollten mehr von den Vampiren angefallen werden. So wurde der Vertrag beschlossen. Der Packt besiegelt, wahrscheinlich mit Blut.
Aber man kann sich vorstellen, dass ein Haufen blutgieriger Vampire nicht so schnell ihr einfaches und überaus leichtes Leben änderten. Wenn auch alle dem Vertrag zustimmten.
Der hohe Rat sah ein, dass es einer Kontrolle bedarf.
Selbst wollten sie nicht in Erscheinung treten, um für die Durchsetzung ihres Vertrages zu sorgen.
Aber wer kann einem Haufen blutrünstiger, mordlüsterner und vor allem sturer Vampire als Aufpasser gegenübergestellt werden?
Man beschloss den Clans noch schlimmere Vampire vor die Nase, oder besser, vor die Reißzähne zu setzen.
So entstand die Superioritas, die Obrigkeit.
Bestehend aus einigen alten Vampiren, die schon so ziemlich alles gesehen, gerochen und geschmeckt haben. Vampire, wie sie schlimmer und eindrucksvoller nicht sein könnten.
Die Obrigkeit griff hart durch, sie verschonte keinen Vampir der gegen den neuen Kodex verstieß. Es war eine schlimme Zeit, in der viele Vampire, auch schon sehr alte, in Flammen aufgingen.
Aber irgendwann werden selbst Vampire vernünftig und sie hielten sich einigermaßen an die Regeln. Heute gibt es nicht mehr so viele Blutsauger auf der Welt, wie noch im 18. Jahrhundert.
Einige ziehen wie Nomaden durch das Land, um trotz der Bedrohung durch den hohen Rat und die Obrigkeit, eine Spur des Todes und des Blutes hinter sich her zu ziehen.
Andere sind in entlegene Städte und Dörfer abgewandert, um ausschließlich von Tieren zu leben.
Dann gibt es diejenigen, die sich zwar niedergelassen haben, aber mit dem Clan nichts gemein haben. Sie leben allein und sind meistens selbst große Verbrecher. Auf sie hat die Obrigkeit ein waches Auge.
Und es gibt immer noch den Clan der Vampire, mit unterschiedlicher Anzahl von Mitgliedern, die sich aber voll und ganz dem Kodex verschrieben haben. Sie jagen Menschen, böse Menschen. Mörder, Vergewaltiger, Kinderschänder, den Abschaum der Blutsäcke.
Die Oberen des Clan setzen sich aus ganz unterschiedlichen Vampiren zusammen. Jeder hat andere Möglichkeiten, an Informationen über Verbrecher zu kommen.
Da wir uns ungehindert unter Menschen bewegen können, gehen einige von uns normalen Berufen nach. So arbeiten sie unentdeckt bei der Polizei, als Staatsanwälte, Anwälte, Richter, in Gefängnissen oder bei anderen staatlichen Behörden. Sie sitzen an der Quelle und kommen so aus erster Hand an wichtige Informationen heran.
Der Delinquent wird jetzt nur noch zu einer bestimmten Zeit, an einen bestimmten Ort gelockt, wo auch schon ein hungriger Vampir auf ihn wartet, um ihn von der Bildfläche verschwinden zu lassen.
Es ist eigentlich wie in einer großen Firma, alle arbeiten Hand in Hand. Ein reibungsloser Ablauf ist nur gewährleistet, wenn jeder Mitarbeiter korrekt seine Arbeit verrichtet.
Jeder Vampir, egal welchem Clan er auch angehören mag, der gegen die Regeln verstößt, der Unschuldige tötet, bringt sich selbst und natürlich auch die anderen in Gefahr. Ganz zu schweigen von der Verwandlung in celeritas, im Schnellverfahren. Sofern es im einundzwanzigsten Jahrhundert überhaupt noch eine Umwandlung eines Menschen in einen Vampir gibt, so erfolgt sie in kleinen Schritten. Der Vampir-Anwärter wird immer mal wieder gebissen, so geht seine Verwandlung langsam und für seine Umwelt fast unbemerkt, vor sich. In dieser Zeit wird der Mensch-Vampir Halbblut genannt.
Die Verwandlung in celeritas ist verboten und zieht eine empfindliche Strafe nach sich. Das Ganze hat einen guten Grund. Im Schnellverfahren, wobei der Vampir das gesamte Blut des Opfers aussaugt, um ihm hinterher einen Teil seines eigenen Blutes wieder zurück zu geben, ist nicht sicher. Dem Menschen wird, mit seinem Lebenssaft, auch die Persönlichkeit, sein Charakter genommen, mit dem des Vampirs gemischt, um es ihm wieder zuzuführen. Nur selten kommt etwas Gutes dabei heraus.
In den letzten Jahren hat es aber kaum ein Vampir des Clans gewagt, gegen den Kodex zu verstoßen und die Obrigkeit, oder gar den hohen Rat, der über alle ein waches Auge hat ohne selbst groß in Erscheinung zu treten, herauszufordern.
Aber, wie so oft, irgendeinen völlig Verrückten gibt es immer.
So auch in meinem Fall.
Das wäre dann wohl … Ich.
Mir ist es nicht möglich, mich nur darauf zu konzentrieren, Verbrecher zu schnappen. Ich muss ständig aus der Rolle fallen, ich muss einfach jagen.
Es liegt mir sozusagen … im Blut.
Plötzlich sehe ich alles ganz deutlich vor mir, es fing genau an dieser Stelle an, auf den Zinnen der Stadtmauer. Ich schließe die Augen und erinnere mich.
Aber eigentlich ist es viel mehr.
Es ist, als durchlebe ich die letzten Jahre ein weiteres Mal.
Ich bin schon mittendrin … wieder einmal.