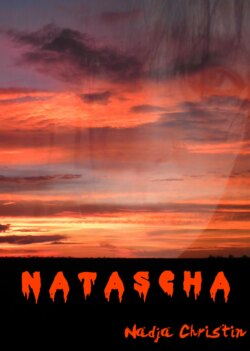Читать книгу Natascha - Nadja Christin - Страница 5
Dennis
ОглавлениеEs traf mich wie ein Blitzschlag. Dieser Geruch, der von dem kleinen Stückchen Stoff zu mir hoch zog, dieses Gesicht auf dem Foto, beides kannte ich, beides war mir sehr vertraut. Es gehörte zu mir, es war von mir. Das Glas, das ich noch in der Hand hielt, zersprang in meiner Faust. Das restliche Konservenblut lief über meine Hand und tropfte auf den Boden. Ich merkte es kaum. Mein Blick war fixiert auf dieses Foto, und auf dieses Gesicht auf dem Foto. Um mich herum nahm ich nichts mehr wahr, die Zeit schien still zustehen. Wäre ich ein Mensch, ich wäre augenblicklich in eine dankbare Ohnmacht gefallen. Nur um meinen Blick von diesen Augen auf dem Bild abzuwenden. Damit ich endlich nicht mehr dieses Gesicht anschauen musste. Nur um nicht daran zu denken, dass es mein Auftrag war, diesen Jungen zu töten.
Ich konnte nichts fühlen, ich konnte nicht mehr denken, in mir war nur noch Leere, eine furchtbare Leere, die meinen ganzen Körper einzunehmen schien.
Ich starrte immer noch auf das Bild vor mir, nahm den Geruch war, diesen vertrauten, menschlichen Duft. Wie aus weiter Ferne hörte ich Justin:
»Tascha?«, seine Stimme klang ein wenig ängstlich und verwirrt.
»Tascha, was ist denn?«, er kam zu mir und legte den Arm um mich, ich bemerkte es kaum. Ich lauschte nur in diese Leere in mir, hörte tief unten aus meinem Innersten leise ein Wort. Es wiederholt sich immer wieder: NEIN. NEIN. NEIN.
Justin neben mir schüttelte mich an der Schulter.
»Tascha, was ist denn mit dir?«, er sah auch auf die verstreut liegenden Unterlagen.
»Kennst du den Jungen?«
Ob ich den kenne, dachte ich in diese Leere hinein, die mich komplett auszufüllen schien.
Es war so, als wenn Justins Worte ein Echo in mir erzeugten. Immer wieder hörte ich die Worte: »Kennst du den Jungen« und meine Antwort darauf: »Ob ich den Jungen kenne?« Die Worte wurden immer lauter. Immer schneller hörte ich die Sätze, bis sie ein gemischtes Wortchaos waren, bis die Worte nur noch Unsinn ergaben.
Erst dann konnte ich mich wieder bewegen. Langsam drehte ich meinen Kopf in Justins Richtung. Meine Muskeln und Sehnen am Hals schienen zu knarren und zu ächzen. Ich fühlte mich wie ferngesteuert.
»Ob ich ihn kenne?«, wiederholte ich nun laut und meine Stimme klang krächzend.
Ich blickte erneut auf das Bild.
»Das ist mein Sohn, mein richtiger Sohn«, ich holte tief Luft. »Das ist Dennis.«
Dennis, Dennis, Dennis, in meinem Kopf hallte sein Name wie ein Echo nach, und löste damit die unsinnigen Wortfetzen ab.
Ich fühlte noch diese hohle Leere in mir, aber ich spürte schon, wie sie langsam von einem anderen Gefühl verdrängt wurde: Hass! Blinder, wütender, alles vernichtender Hass.
Das wird sich besser anfühlen, dachte ich, damit konnte ich umgehen. Besser als diese tote Leere, deren Grenzen ich nicht einschätzen konnte. Ich wartete auf das Hassgefühl, erwartete es sehnsüchtig, um mich damit einzuhüllen, um darin zu versinken und vielleicht auch zu ertrinken.
Ich war noch nicht sehr lange ein Vampir erst zehn Jahre. Seltsam, wenn man sonst mit Vampiren sprach, oder von welchen hörte, waren alle immer mindestens über fünfzig Jahre schon verwandelt, die meisten noch viel, viel länger. Aber irgendwann haben alle mal angefangen, angefangen ein Vampir zu sein.
Mein Entschluss stand damals sehr schnell fest, in das Reich der Verdammten zu wechseln.
Ich hatte bei Frank als Sekretärin gearbeitet und war gut mit ihm ausgekommen. Irgendwann erzählte er mir von seinem wahren Wesen und ich war fasziniert.
Wochenlang erklärte er mir die Vorteile ein Vampir zu sein. Die wenigen Nachteile wollte ich erst gar nicht hören. Ich freute mich schon auf mein neues Leben.
Die Verwandlung selbst, zog sich über etliche Monate hin. Immer weiter veränderte ich mich, aber so langsam, dass es kaum einem auffiel.
Kurz vor der Vollendung meiner Umwandlung entschloss sich Frank aber, mich sterben zu lassen.
Ich musste sterben für meine Mitmenschen. Ich konnte nicht als fertiger Vampir weiter mit meiner Familie leben, als sei nichts geschehen. Er meinte, irgendwann würde ich mich nicht mehr beherrschen können und meine Kinder oder sonst jemanden in meinem nahen Umfeld beißen.
Wie gut er mich damals schon kannte. Es wäre bestimmt so geschehen. Mit meiner Beherrschung war es heute auch noch nicht weit her.
Ich hatte damals einen tödlichen Autounfall. Alles wurde perfekt arrangiert und der Unfallort hergerichtet. Meine Leiche wurde gespielt von einer Frau aus der Stadt, die keiner vermissen würde. Sie wurde von Frank ausgesucht, da sie eine gewisse Ähnlichkeit mit mir aufwies.
Alles lief einfach perfekt, die Identifizierung, die Beerdigung, die Trauerfeier, alles hatte ich aus sicherer Entfernung beobachtet. Wer möchte nicht gerne sehen, wer alles zur eigenen Beerdigung erschien und wie sich die Hinterbliebenen ums Erbe stritten, es war das reinste Vergnügen für mich.
Der einzige Wermutstropfen war, das ich zwei kleine Kinder von fünf und sechs Jahren hinterließ, die mein Mann zu versorgen hatte.
Auch als ich schon für den Rest der Welt als tot galt, bin ich bei Frank geblieben, um in weitere Einzelheiten eingeweiht zu werden. Er erzählte mir von dem Kodex und dem Clan der Vampire. Er lud mich ein, einer von ihnen zu werden. Ich hätte auch ablehnen können, ich fragte mich nur, was Frank dann mit mir gemacht hätte. Er duldete keine Vampire um sich, die nicht dem Clan angehörten.
Es war eine interessante, berauschende Zeit. In der wir fast jedes Wochenende wilde Feste feierten, mit appetitlichen Jungs und Mädchen als Partyhäppchen. Ich wusste bis heute nicht, wo dieser ständige Nachschub an Jugendlichen herkam.
Einmal fragte ich Frank nach unserem Kodex und er antwortete mir mit einem Schulterzucken, das es alles Ausreißer, Dummköpfe und Kleinkriminelle sind. Die würde keiner vermissen.
Wehret den Anfängen. Sozusagen.
Meine Kinder sind jetzt Jugendliche, ich hatte meinen Mann und meine Tochter seit meinem Tod und der anschließenden Beerdigung, nicht mehr gesehen.
Nur meinen Sohn musste ich vor zwei Jahren kurz wieder auf den rechten Weg geleiten. Zufällig hatte ich erfahren, dass er mit ein paar seiner Freunde einen Einbruch plante. Kurz vor ihrem Treffen habe ich ihm den Kopf ein wenig gerade gerückt. Er hatte mich nicht erkannt, da ich mich mittlerweile stark veränderte und er noch ein kleines Kind war, als ich … starb. Ich wollte um jeden Preis vermeiden, dass er auf die schiefe Bahn geriet.
Wer weiß, vielleicht hätte ich ihn sonst als Partyhäppchen bei Franks Wochenend-Ausschweifungen wieder getroffen. Bis heute habe ich keinerlei Schandtaten von ihm gehört. Frank hatte ich nie von meinem kurzen Ausflug in die Menschenwelt erzählt.
Er hätte es nicht gutgeheißen, er vertrat die Meinung, dass man in die Welt der Blutsäcke nicht einzugreifen hatte. Sie müssten ihr Leben ohne Beeinflussung durch uns meistern. Auch ihre Entscheidungen dürften nicht durch einen von uns durchkreuzt oder verändert werden. Nur wenn wir den Abschaum jagten, sollen wir mit der Menschenwelt in Berührung kommen.
Ich zwinkerte kurz und schlug meine Augen auf. Dunkelheit hüllte mich ein. Ich lag auf meinem Sofa. Ich überlegte, wie ich dort hinkam.
Wurde ich vielleicht doch ohnmächtig? Nein, das kann nicht sein, Vampire können nicht ohnmächtig werden. Ich horchte in mich hinein und hörte immer noch das leise Echo: »Dennis, Dennis, Dennis«
Wie bin ich bloß auf dieses verflixte Sofa gekommen.
»Na, wieder unter den Lebenden?«
Ich zuckte zusammen, ich hatte Justin überhaupt nicht bemerkt Er stand direkt neben mir und grinste mich von oben herab an. Aber seine Augen machten diese Bewegung nicht mit. Seine unergründlichen, tiefen Brunnen sahen mich forschend an.
Schnell setzte ich mich auf, mit einem Mal überkam es mich, schwappte die Erinnerung wie eine Welle über mich hinweg und riss mich mit. Ich krallte mich mit beiden Händen an dem Polster des Sofas fest, um nicht fort gespült zu werden.
Ich schüttelte den Kopf um ihn frei zu bekommen und horchte erneut in mich hinein. Die Leere war weg, zum Glück. Der Hass war noch da. Aber im Moment war er ein weit entferntes, dumpfes Pochen. Damit konnte ich leben.
Ich erhob mich und ging zur Küche.
Der Inhalt des Umschlages lag verstreut auf der Arbeitsplatte.
Ich überflog den Anfang der Information, die persönlichen Daten kannte ich schon und ging direkt zu den aufgeführten Taten:
Angefangen mit kleineren Ladendiebstählen und Vandalismus. Dann wurde die versuchte Tat vor zwei Jahren erwähnt, also wusste man doch die ganze Zeit davon, dass ich Dennis damals von dem Einbruch abhielt, wie konnte ich nur so naiv, so dumm sein.
Fast ein Jahr herrschte Ruhe um ihn, dann ging es wohl Schlag auf Schlag mit Raubüberfall, Erpressung, schwerer Körperverletzung, wieder Raubüberfall, Totschlag und sogar einem Mord weiter. Mein Söhnchen war in einem Jahr wirklich sehr fleißig, das musste man ihm lassen.
Er war genau der Kandidat, den Frank früher auf unsere wilden Wochenendpartys eingeladen hätte. Eine kleine Tankstelle für Vampire, ein Taugenichts und Dummkopf, den keiner vermissen würde.
Ich warf einen raschen Blick auf die handgeschriebene Notiz. Wie immer stand da Datum, Uhrzeit und der Ort, an dem er sich befinden wird. Der Ort war wieder unten am Fluss, diesmal das Gebäude Nummer 2. Das Datum war das von Übermorgen und die Uhrzeit war zwölf Uhr mittags.
Niemals hatte ich einen Auftrag für tagsüber erhalten, immer spielte sich meine Jagd nachts ab. Immer.
Nur, dass hier sowieso alles anders war.
Ich blickte Justin an. »Wo sind das Foto und der Stofffetzen?« fragte ich gelassen. Seine Augen blickten gehetzt hin und her, er sah gestresst aus.
»Die hab ich ins Klo geworfen. Du wirst sie nicht brauchen.«
Ich blickte ihn grimmig an, aber gleichzeitig verstand ich, was er meinte. Ich brauche kein Foto um mich an das Aussehen meines Sohnes, zu erinnern. Ich brauche auch keine Geruchsprobe, um seinem Geruch zu folgen. Er hatte natürlich Recht.
Ich suchte Justins Blick, suchte die unergründlichen, tiefen Brunnen um mich darin ein bisschen zu verlieren, um diesen Alptraum, in dem ich mich befand, kurz zu vergessen. Ich fühlte mich so allein, mir war nach ein wenig Gesellschaft.
Er erwiderte meinen Blick, schaute mich von unten her an. Zuerst misstrauisch, dann glättete sich sein Gesicht und er kam näher. Nur wenige Zentimeter trennten unsere Körper voneinander. Mir genügte das schon, sein Geruch, seine Wärme, die sein Körper abstrahlte, das Rauschen seines Blutes. All das genügte mir, all das half mir schon. Ich hätte ihn gerne umarmt, hätte mich gerne von ihm umarmen lassen. Befürchtete aber, dass sich die Situation dann wieder verselbstständigt. So genoss ich, mit geschlossenen Augen, nur seine Nähe.
Ich beruhigte mich tatsächlich etwas. Jetzt konnte ich langsam wieder klar denken.
»Justin, hast du davon gewusst?«, fragte ich ihn leise.
Er atmete scharf ein und packte mich an den Schultern. Seine Augen nagelten meine fest.
»Tascha, natürlich nicht, wie kannst du nur so etwas denken.« Er ließ seine Arme sinken und fügte leise hinzu: »Ich dachte, du vertraust mir ein bisschen.« Traurigkeit lag in seiner Stimme.
Ich ihm vertrauen, überlegte ich und atmete Justins Geruch tief ein. Wie kam er darauf, dass er mein Vertrauen gewonnen hatte? Ganz in Gedanken legte ich meine Stirn in Falten.
Leise sagte ich: »Der letzte, der mein Vertrauen hatte, war Frank. Wohin das geführt hat sieht man ja.« Erneut packte Justin mich an den Schultern und drehte mich zu sich.
»Tascha.« Ich öffnete meine Augen und sah tiefe Brunnen vor mir, ganz nah vor mir. Ob ich ihm vertraue, überlegte ich. Ich war so nah bei ihm, dass ich in seinen Augen mein Spiegelbild erkannte. Plötzlich wurde mir klar, dass ich ihm wirklich vertraute, mehr noch: Ich würde ihm mein Leben anvertrauen. Diese Erkenntnis traf mich wie ein Hammerschlag.
»Tascha«, sagte Justin abermals. Er hatte wohl bemerkt, dass mein Blick abwesend und durch ihn durch ging. Ich blinzelte einmal und war wieder in der Wirklichkeit angekommen.
»Ja?«, hauchte ich
»Ich würde dir niemals wehtun, Tascha.« Er nahm mein Gesicht in seine warmen Hände und küsste mich flüchtig auf die Lippen. Für einen längeren Kuss reichte sein Vertrauen in meine Beherrschung wahrscheinlich nicht aus. Dann umarmte er mich. Auch ich schlang meine Arme um seinen warmen Körper. Es tat mir gut. Er tat mir gut.
Wenn mir vor zwei Tagen jemand gesagt hätte, das ich einen Menschen umarme, ohne meine Zähne in seinen Hals zu schlagen, Ich hätte denjenigen nicht nur für völlig verrückt erklärt. Nein, ich hätte ihn getötet.
Die Stille wurde unterbrochen von meinem Handy, das klingelte. Mechanisch ging ich ran. »Ja?«
»Tascha?«, fragte die Stimme am anderen Ende der Leitung
Ich versteifte mich in Justins Armen, und brüllte in das Telefon: »Frank. Du Schweinehund. Wie kannst du es wagen mich anzurufen.« Justin drückte mich fester an sich. Ich hörte wie sein Puls anstieg, sein Blut schneller rauschte.
»Tascha, stell dich nicht so an. Wir sind die Putzkolonne, schon vergessen? Wir säubern die Stadt von all den Subjekten, die sie verunreinigt. Dass dein Sohn dazugehört, dafür kannst du mich nicht verantwortlich machen!«
Ich fühlte, wie Wut und Hass in mir aufstiegen.
»Du wirst dir sicher denken können, dass ich das nicht machen werde.« Im gleichen Augenblick wo der Satz meine Lippen verließ, wollte ich ihn gerne zurücknehmen. Ich wusste, es war ein Fehler.
»Das macht nichts. Es gibt genug andere, die nicht so zimperlich sind. Dann schicke ich eben Thomas auf die Jagd.« Es knackte, er hatte aufgelegt. Ich hatte das dringende Bedürfnis, dieses verflixte Handy mit Wucht auf den Boden zu werfen. Aber ich widerstand diesem Drang und steckte es einfach wieder weg.
Justin sah mich fragend an. Ich erzählte ihm von Thomas und was ich über ihn wusste. Es war sehr wenig.
»Thomas wird Dennis jagen und er wird ihn erwischen«, fügte ich am Ende hinzu.
»Wir müssen schneller sein, das ist alles.« Justin sah mich prüfend an.
»Frank wird Thomas bestimmt eine andere Uhrzeit geben und einen anderen Ort, oder was meinst du?«
»Ja, bestimmt. Thomas zu verfolgen hat gar keinen Sinn, wir müssen Dennis ausfindig machen und ihn verstecken. Nur so sind wir auf der sicheren Seite.«
»Ja, du hast Recht, also los, wo ist dein Sohn jetzt?« Justin blickte auf seine Armbanduhr, »um sechs Uhr morgens?«
Ich überlegte kurz. »Na ja, ich schätze im Bett, wenn er nicht wieder auf einem Raubzug ist.«
»Okay, also auf zu seinem Bett, wo immer das auch sein mag.«
»Es sind fast zwei Stunden Fahrt bis dahin«, wendete ich ein.
»Na dann aber nichts wie los.« Justin zog mich am Arm aus meiner Wohnung. Ich sah ihn unverständlich an und fragte mich wieder einmal, was er verbarg, was ihn so plagte.
Wir rannten die Treppen hinunter, zu meinem Mustang, sprangen hinein und ich fuhr mit quietschenden Reifen aus dem Parkhaus, aus der Stadt, in die Richtung, in der ich früher einmal lebte. Zurück in mein altes Haus.
Dunkelheit umgab uns, das Gewitter war vorbei, aber die schwarzen Wolken bedeckten immer noch den Himmel und färbten ihn schwarz. Plötzlich fiel mir etwas ein.
»Justin, was wird denn jetzt aus dir? Wie stehst du denn zu Frank? Immerhin bist du noch sein Halbblut«, fragte ich erstaunt. Überrascht, dass er noch nicht von selbst darauf zu sprechen gekommen war.
Justin drehte nicht nur seinen Kopf zu mir, sondern fast seinen gesamten Körper. Er sah mich an.
»Tascha, Frank hat mich auch gelinkt. Willst du immer noch wissen, warum er mir im Badezimmer die Wunden nicht verschlossen hat?«
Ich konnte ihn nur verständnislos ansehen.
Justin schmiss sich wieder in seinen Sitz und starrte nach vorne.
»Er wollte, dass du mich erledigst. Frank wollte mich auf eine einfache und für ihn bequeme Art loswerden. Das ist der Grund. Außerdem hättest du ihm und der Obrigkeit, endlich einen triftigen Grund geliefert, dich aus dem Weg zu räumen.«
Ich sah nach vorne auf die Straße und konnte es nicht glauben, was ich soeben hörte.
»Frank will mich … töten?« Es klang in meinen Ohren nicht echt und ich sagte es direkt noch einmal.
»Aber warum?«, dann durchzuckte es mich.
»Und wie kommt es, dass du davon weißt?«
»Fahr bitte rechts ran.« Justin starrte immer noch nach vorne.
»Warum sollte ich. Ich will schnell zu Dennis.«
»Bitte Tascha, fahr rechts ran. Ich hab dir was zu sagen und ich möchte verhindern, dass du das Auto um einen Baum wickelst, nur aus Wut über mich. Denn so möchte ich nicht sterben«, er grinste schief.
Das Glück war mit ihm. Es kam gerade eine Pannenzone, ich steuerte den Wagen hinein, hielt an und stellte den Motor ab. Nur das leise Ticken war zu hören. Und Justins Blut, das viel zu schnell durch seinen Körper rauschte.
Ich drehte mich halb zu ihm um. »Nun?«
Justin nahm meine kalte Hand und legte sie in seine warme, dann bedeckte er sie mit seiner anderen Hand. Er sah mich wieder mit seinem unergründlichen, tiefen Augen an.
»Tascha, letzten Monat wollte ich noch Selbstmord begehen, ich hatte nur einen Wunsch, aus dieser verdammten Welt zu verschwinden. Ich stand auf der Brücke, sie ist hoch genug und wollte springen. Da kam Frank, wie aus dem Nichts. Ich habe mich lange mit ihm unterhalten und er machte es mir echt schmackhaft, vor meinem Tod noch etwas für ihn zu erledigen. Ich weiß nicht mehr, wie er mich dazu gebracht hat. Aber er hat es letztendlich geschafft. Er weihte mich ein und machte mich zu seinem Halbblut, oder … besser gesagt zu seinem Diener.« Justin legte eine kurze Pause ein.
»Weiter«, drängte ich. Er löste seinen Blick von meinem und sah erneut durch die Frontscheibe in die Dunkelheit. Ohne meine Hand loszulassen fuhr er fort:
»Es war alles inszeniert. Die Blondine, die er dir geschickt hat, die Versammlung, unser kleines Geplänkel draußen vor der Tür, meine Angst. Alles nur gespielt, für dich gespielt.« Ich entziehe ihm meine Hand, seine klatschen leise und leer aufeinander.
»Alles nur … . gespielt?«, fragte ich ungläubig.
»Ja, oder vielmehr … Nein«, er blickte zu mir, ich konnte ihm jedoch nicht in die Augen sehen, ich starrte ins Nichts.
»Nein, das war nicht richtig, meine Angst war nicht gespielt. Ich hatte keine Angst vor dir, aber ich hatte plötzlich Angst, dass Frank alles wahr machen würde, dass er dich wirklich umbringen wollte. Bis dahin hatte ich das noch alles für einen … Na ja, für einen Scherz gehalten, dass er dich nur ein bisschen einschüchtern wollte, um dich wieder auf den rechten Weg zu bringen. Verstehst du wie ich das meine?« Justin sah mich fragend an.
»Ein Scherz?«, meine Stimme war nur ein Murmeln.
»Alles nur gespielt? Und wie war das dann bei dir im Bad als er über dich hergefallen ist?«, ich runzelte die Stirn.
»Wie du schon richtig bemerkt hast, hatte ich Krach mit ihm. Er wollte dich loswerden, indem er mich nach dem Biss bluten ließ. Er hatte deine Gier nach … meinem Blut bemerkt und sah seine Chance gekommen. Er rechnete fest damit, dass du nicht wiederstehen könntest. Das du mich töten würdest. Ich wollte ja sterben, aber ich wollte nicht für deinen Tod verantwortlich sein. Ich sagte ihm, dass ich nicht mehr mitmachen würde, dass er nicht mit meiner Hilfe dein Ende vorbereiten könnte.« Justin schnaubte verächtlich, »als wenn das so einfach wäre. Außerdem meinte ich noch, er könnte mich, von mir aus, jetzt und hier umbringen, aber ich werde definitiv nicht mehr mitmachen. Und dann hat er es ja auch fast getan, es hat sich noch nie so schmerzhaft angefühlt. Wenn du wirklich nicht hättest widerstehen können, wäre das nur wie eine Erlösung gewesen. Aber ich habe dir vertraut, und du hast mich nicht enttäuscht.«
Ich versuchte meine Gedanken zu ordnen, versuchte alles in die richtige Bahn zu lenken. Wortfetzen, kurze Situationen Bilder tauchten in rascher Abfolge vor meinem inneren Auge auf und plötzlich fügte sich alles in ein ganzes Bild zusammen.
Justin hatte Recht. Was auch immer er mir bis hierhin vorgelogen und vorgespielt hatte, die letzte Erklärung entsprach der Wahrheit.
Aber etwas wollte ich gerne noch wissen.
»Warum willst du dich eigentlich umbringen?«
Er seufzte, »Liebe, Hass, Vertrauen … so in etwa.«
»Vertrauen«, überlegte ich, und schloss genervt meine Augen. Das Thema hatten wir doch gerade erst.
Hatte schon wieder jemand, mein in ihn gesetztes Vertrauen missbraucht? Zwei Mal, so schnell hintereinander? Was bin ich nur für ein einfältiger Vampir?
Ich horchte in mich hinein. Hörte auf mein kaltes, nicht mehr durchblutetes Herz, was es mir zu sagen hatte.
Lauschte und suchte nach Entscheidungen.
Ich öffnete meine Augen und sah in die von Justin. Es waren jetzt keine unergründlichen Brunnen mehr, in denen ich mich verlieren konnte. Es waren warme, freundliche Augen. Augen in die man sich verlieben könnte. Ich lächelte ein bisschen und startete den Motor.
»Können wir jetzt weiterfahren?«, fragte ich munter, »schließlich haben wir noch etwas vor.«
Justin lächelte auch und schnallte sich an.
»Willst du jetzt nicht mehr sterben?«, fragend zog ich eine Augenbraue nach oben.
Statt einer Antwort nahm er meine Hand, legt sie in seine warme und bedeckt sie mit seiner anderen.
Die Sonne war eben erst aufgegangen und schenkte uns einen perfekten Sonnenaufgang.
Wir fuhren weiter unserem Ziel entgegen.
Ich wusste nicht, was mich heute noch alles erwartet, wie dieser Tag enden würde, aber eines wusste ich:
Bis hierhin hatte es sich schon mal gelohnt.
Es war nun nicht mehr weit. Langsam wurde ich unruhig, ich war seit meiner Verwandlung und meinem tragischen Tod nicht mehr hier. Den Weg kannte ich noch genau: Es waren nur noch zwei Straßen, allesamt ungepflastert und staubig, in einen holperigen Weg einbiegen und dann das Dritte Haus.
Ich hing meinen Gedanken nach, das war der Grund, warum Justin sie zuerst sah. Vielleicht hätte alles ein anders Ende genommen, wenn ich nicht so eine Träumerin wäre. Wer weiß das schon.
Vor mir, mitten auf der staubigen Straße standen zwei Gestalten, zwei Vampire, Thomas und Elisabeth. Beide stemmten ihre Fäuste in die Seite und fixierten uns wütend und … hungrig.
Bei einem Menschen würde man instinktiv versuchen auszuweichen. Aber diese beiden da, waren schon tot. Das Einzige, das passieren konnte, war, dass ich mir den Lack an meinem Mustang verkratzte.
Meine Hände umfassten das Lenkrad ein wenig fester, die Knöchel an meiner Hand traten weiß hervor. Mein Mund war zu einer harten Linie gepresst. Neben mir krallte sich Justin an seinem Sitz fest und stieß ein erschrecktes Keuchen aus. Ohne den Kopf zu wenden flüsterte ich ihm zu:
»Schnall dich ab. Wenn ich den Wagen wende, springst du raus und läufst weg. Versteck dich, ich werde dich schon finden.« Ein kurzer Blick zu ihm, hatte er mich verstanden? Er löste seinen Gurt, ich fuhr weiter, genau auf die beiden Vampire zu. Kurz bevor der Aufschlag erfolge, sah ich nur Beine fliegen. Sie sprangen über meinen Mustang, das war zu erwarten.
Ich fuhr ein Stück weiter, zog die Handbremse und machte eine halbe Drehung.
»Jetzt, raus hier«, flüsterte ich Justin zu. Er sprang aus dem Auto. Kaum, das sein Körper den Boden berührte, war er auch schon wieder auf den Beinen und rannte geduckt in den Wald neben uns. Durch den Schwung der Drehung schloss sich die Tür von selbst wieder. Ich gab Gas, ließ die Kupplung kommen, trat aber weiterhin fest auf die Bremse. Eine riesige Staubwolke breitete sich hinter meinen durchdrehenden Rädern aus. Kleine Steine und Dreck wurden nach hinten geschleudert. Ich hoffte, ich verschaffte Justin so ein wenig Deckung.
Ich vollendete die Drehung und stand den Vampiren gegenüber. Erneut fuhr ich genau auf sie zu. Ich überlegte kurz, ob sie Justins Flucht bemerkt haben, oder ob sie dachten, er kauert ängstlich im Fußraum. Hatten sie die Zeit seinen Geruch zu suchen?
Beide kamen auf mich zugerannt, mein Blick ging rastlos zwischen Thomas und Elisabeth hin und her.
»Sie oder Er? Sie oder Er? Sie oder Er?« Ich konnte mich nicht entscheiden, wen ich von beiden überfahren sollte. Da sah ich, wie Thomas Elisabeth ein kurzes Zeichen in Richtung Wald gab. Sie hatten Justins Rückzug also bemerkt. Meine Entscheidung war gefallen, ich riss das Lenkrad herum und eine Sekunde später schlug Elisabeths Körper wie eine Bombe in meinen Wagen ein. Sie hatte einen Moment nicht aufgepasst und nach Thomas’ Zeichen den Blick kurz auf den Wald gerichtet. Ich hüpfte auf und ab in meinem Sitz, als ich Elisabeth überrollte. Ich konnte mir unmöglich ein Lachen verkneifen und spürte, wie mein ganzes Gesicht vor Freude strahlte.
Natürlich hatte ich sie damit nicht vernichtet, dazu gehörte schon ein wenig mehr. Sie müsste ihren Kopf verlieren. Im wahrsten Sinne, des Wortes.
Im Rückspiegel sah ich sie auch schon wieder aufstehen. Thomas war bei ihr, packte sie am Arm und redete auf sie ein. Sie schüttelte kurz den Kopf und rannte dann in die Richtung, in der Justin im Wald verschwand.
Ich vollführte erneut eine Drehung mit dem Wagen und stand Thomas alleine gegenüber. Ich überlegte, wie ich weiter vorgehen sollte.
Ich stellte den Motor ab und stieg aus. Immer Thomas im Blick, der etwa hundert Meter von mir entfernt stand und mich lauernd beobachtete.
Langsam ging ich zum Kofferraum, öffnete ihn und holte meine Machete heraus.
Ich bekam sie vor ein paar Jahren von Frank geschenkt. Er hatte sie seinerzeit von einem der kubanischen Sklaven erhalten, um mit ihnen bei den Aufständen in den Zuckerkolonien zu kämpfen. Das musste so ungefähr im 18. Jahrhundert gewesen sein. Hatte bestimmt Spaß gemacht.
Ich betrachtete die schöne glänzende Machete und tippte mit meinem Finger auf die Spitze. Aus den Augenwinkeln beobachtete ich Thomas weiterhin.
Rasch drehte ich mich um und rannte in den Wald. In die entgegengesetzte Richtung, in die Justin und Elisabeth verschwunden waren. Ich wollte Thomas von Justins Spur ablenken, ihn beschäftigen. Mit einem Vampir würde Justin vielleicht alleine fertig, aber bei zwei von der Sorte … Keine Chance.
Natürlich rannte Thomas hinter mir her.
Keine halbe Minute später stand ich auf einer kleinen Lichtung. Die Sonne schien noch sehr schräg herein, es war erst acht Uhr morgens, und es war wunderschön hier.
Ein guter Platz zum Sterben.
Thomas war mir dicht auf den Fersen. Mitten auf der Lichtung drehte ich mich um und erwartete ihn.
Am Rande der Lichtung stoppte Thomas. Er griff mit einer Hand über seine Schulter und zog nun seinerseits eine Waffe. Es war ein Schwert, aber ein ganz Besonderes.
Er erzählte mir früher schon Geschichten über diese Waffe. Es war ein sogenanntes Richtschwert und wurde ausschließlich zur Enthauptung von Verurteilten benutzt. Nicht schwer zu erraten, woher es kam und wie es in Thomas’ Besitz gelangte.
Auch nicht schwer zu erraten, was er jetzt damit vorhatte.
Er hielt sein Schwert mit beiden Händen über seinen Kopf und kam auf mich zugerannt. Ich stellte mich in Position und erwartete ihn. Es erklang ein hohes, kreischendes Geräusch, als unsere Waffen zusammenprallten. Ich drückte ihn mit aller Kraft wieder von mir weg. Er stand mir gegenüber, mit erhobenem Schwert. Auch ich hob mit einer Hand meine Machete an. So umkreisten wir uns, ganz langsam.
»Hallo Tom«, sagte ich und fixierte sein Gesicht, um auf jede Bewegung von ihm, sofort zu reagieren.
»Lust auf ein bisschen Sterben?«, meine Stimme hatte einen ironischen Unterton.
»Tascha, schade, dass wir uns auf diese Weise wiedertreffen. Wir hätten Freunde werden können. Aber jetzt …« Thomas lächelte grausam, »muss ich dich leider töten. So leid es mir tut und dann werde ich mich um deinen Menschenfreund kümmern.«
Wir umkreisten uns immer noch. Langsam, abwartend und lauernd. Wie zwei Raubtiere.
»Hat Frank dich geschickt?«
»Nein«, antwortete er, »er hat mich beauftragt deinen Sohn zu töten. Aber ich dachte mir schon, dass wir uns hier treffen.«
Ich machte blitzschnell einen Schritt nach vorne und schlug seitlich meine Machete zu seinem Körper. Er parierte und führt seinerseits einen Hieb zur anderen Seite aus. Meine Waffe hielt das Schwert auf. Wir sprangen gleichzeitig einen Schritt zurück um unsere abwartenden Umkreisungen wieder aufzunehmen.
Wieder und wieder wagte ich einen Vorstoß. Jedes Mal parierte er meine Schläge. Mein Gehirn arbeitete auf Hochtouren, ich suchte nach einem Ausweg. Nach einer Lösung, wie ich Thomas ausschalten konnte und zwar schnell.
Plötzlich bemerkte ich eine kleine Bewegung zwischen den Bäumen. Nur eine Lidschlaglänge hatte ich mich davon ablenken lassen. Das war genau die Schwäche, auf die Thomas wartete, um mir sein Richtschwert in die Seite zu rammen.
Eine Flut des Schmerzes überrollte mich, vor meinen Augen explodierten kleine Kreise. Die Machete entglitt meinen Händen. Ich ließ mich auf die Knie fallen, presste meine Hand auf die Wunde und war erstaunt, wie tief ich in meinen Körper fassen konnte. Thomas hatte nicht mit voller Wucht zugeschlagen und ich hatte mich währenddessen ein paar rettende Zentimeter zur Seite bewegt. Eine überaus verzweifelte Reaktion.
Thomas stand erneut mit erhobenem Schwert in Position. Ich kämpfte noch mit den Schmerzen. Jetzt hätte er ein leichtes Spiel mit mir. Er könnte mir den Kopf abschlagen und mein verdammtes Dasein mit einem Schlag beenden. Aber er blieb fair und wartete.
Lauerte darauf, dass ich mich erholte. Da trat plötzlich die Bewegung, die ich eben bemerkt hatte, aus dem Wald und auf die Lichtung.
Es war Elisabeth mit Justin. Sie hatte ihn am Kragen gepackt und zerrte ihn hinter sich her. Justin sah schwer angeschlagen aus, er blutete aus verschiedenen Wunden, die auf seinem ganzen Körper verteilt waren.
Bei seinem Anblick verkrampfte sich etwas in meinem Körper. Ich sah, wie Elisabeth, Justin auf die Lichtung schleuderte. Er rappelte sich schnell in eine hockende Position hoch, kaum dass er auf dem weichen Boden landete. Er sah mich an, verschlang meine Augen mit seinem Blick.
»Es tut mir leid.«, hörte ich ihn leise sagen.
Thomas richtete sich auf, steckte sein Schwert in den weichen Boden und ging gemächlich zu Justin.
»Lass ihn in Ruhe, Tom«, presste ich zwischen den zusammengebissenen Zähnen hervor.
»Ich warne dich!«
Langsam richtete ich mich auf und zuckte zusammen, als eine neue Schmerzwelle meinen Körper überrollte. Die Wunde war sehr tief, mein Körper musste sie von innen her heilen, das konnte ein bisschen dauern.
Noch bevor ich richtig stand, war Elisabeth auch schon bei mir. Sie riss mir die Arme auf den Rücken und stemmte sich mit ihrem Knie dagegen. Ich konnte mich nicht mehr bewegen, da die Schmerzen aus meiner Seite mich immer noch lähmten. Ich spürte zwar schon, wie mein Körper den Heilungsprozess begann, aber ohne frisches Blut, das ich trinken könnte, dauerte das Ganze ohnehin noch länger.
Thomas hatte Justin erreicht und riss ihn an den Haaren hoch. Er stöhnte auf, ohne seinen Blick von mir abzuwenden. Seine schönen Augen sahen mich immer noch wie um Verzeihung bittend an.
Ich konnte es kaum ertragen.
Thomas sah zwischen Justin und mir hin und her. Dann wendete er sich mir zu. Er hielt das Halbblut immer noch bei den Haaren gepackt:
»Ihr zwei seid ja ein schönes Pärchen, wahre Gefährten der Nacht.« Thomas lachte laut auf, auch Elisabeth, in meinem Rücken, gackerte wie ein Huhn.
Abrupt stoppte Thomas sein Lachen und blickte mich grimmig an. »Und wann sterbt ihr?«, er wendete seinen Blick zum Himmel, »am hellen Tag!«
Ich sah noch, wie seine Zähne zu Dolchen wurden, dann hatte er sie Justin auch schon in den Hals geschlagen.
Justins Gesicht verzerrte sich zu einer Maske des Schmerzes. Ich sah sein Blut spritzen, jedes Mal, wenn Thomas erneut zubiss. Voller Schrecken erkannte ich, dass Thomas ihn nicht aussaugen wollte, er wollte ihn zerkauen, ihn zerfleischen, er würde ihn töten.
Immer wieder sah ich Justins Blut spritzen, roch es, atmete seinen Duft ein.
Plötzlich war es da, das Monster in mir, ich hörte mich brüllen. Laut und stark, unmenschlich und voller Wut.
Die Kraft war wieder da, ich bückte mich und schleuderte Elisabeth über mich hinweg. Sie schlug einen halben Salto, ließ meine Arme aber nicht los. So vollführte auch ich einen halben Salto und landete mit meinem Rücken krachend auf ihrem Oberkörper. Unter mir hörte ich die Knochen knacken und Rippen brechen. Das würde ihr nicht viel ausmachen, nur ein bisschen Schmerzen zufügen. Wie auf Kommando brüllte Elisabeth unter mir laut auf.
Endlich ließ sie meine Arme los. Schnell ergriff ich meine Machete, die neben uns im Gras lag.
Ich war frei und schoss auf Thomas zu. Das Ganze hatte nur ein paar Sekunden gedauert und Thomas war bei Justin in einen regelrechten Blutrausch verfallen, so konnte er nicht mehr zeitnah reagieren. Meine Chancen standen gut.
Mitten im Lauf hob ich vom Boden ab und traf Thomas mit meinen Füssen an der Brust, das schleuderte ihn einige Meter nach hinten. Justin fiel in sich zusammen. Ich beachtete ihn nicht, hatte nur Augen für Thomas, auf den ich langsam zuging.
Meine Sinne waren aufs äußerste gespannt. So nahm ich das Geräusch hinter mir wahr, beinahe, noch ehe es erklang.
Es war eine einzige, fließende Bewegung: Mich umdrehen, die Machete anheben und Elisabeth damit den Kopf abschlagen. Ohne in meiner Drehung innezuhalten stand ich Thomas auch schon wieder gegenüber und ging weiter auf ihn zu.
Erst war sein Blick erstaunt, dann sah ich die Wut, die grenzenlose Wut über den Tod seiner Gefährtin.
Erneut hallte ein schier unmenschliches Gebrüll über die Lichtung. Diesmal nicht von mir, sondern aus Thomas’ Mund. Er stand vor mir, riss seine Arme in die Höhe und brüllte seine Wut in den Himmel.
Ich bin keine besonders gute Kämpferin, sonst hätte Thomas mich wohl nicht erwischen können. Mir fehlte einfach die Übung aus den letzten Jahrhunderten, die viele Vampire genossen.
Aber vor allem bin ich keine faire Kämpferin. Wie Thomas mich eben meinem Schmerz überließ, obwohl es die Gelegenheit für ihn war, das zeichnet einen fairen und gerechten Kämpfer aus.
Ich bin nicht so, ich nutze jede Chance, ich bin ein Schweinehund.
So stieß ich dem, immer noch himmelwärts brüllenden Thomas, im vollen Lauf meine Machete tief zwischen die Rippen. Sein Gebrüll ging in ein Ächzen über und sein Oberkörper klappte nach vorne. Ich zog die Machete aus seinem schon lange toten Körper, hob sie an und ließ sie auf seinen, nun frei liegenden Nacken, niedersausen.
»Ich hatte dich gewarnt«, brüllte ich ihn an.
Sein abgetrennter Kopf flog mindestens sechs Meter weit, ehe er auf der Lichtung liegen blieb, wie ein vergessener Fußball. Erst Sekunden später fiel sein, nun wirklich toter Körper, in sich zusammen.
Ich atmete stoßweise aus, ließ die Machete achtlos fallen. Dann hob ich meine Hände zum Himmel und ließ ein lautes Brüllen erklingen.
Ein Siegesgebrüll.
Die zwei toten Körper, die über die Lichtung verstreut waren und die abgetrennten Köpfe fingen, wie aus dem Nichts, Feuer. Sie brannten, nun waren sie endgültig vernichtet.
Es war vollbracht, ich kam siegreich aus der Geschichte heraus.
Jetzt lag noch eine schwere Aufgabe vor mir. Ich ließ meine Arme kraftlos sinken, drehte mich um und betrachtete den einzigen herumliegenden Körper, der nicht brannte:
Justin.
Lebte er noch? Ich lauschte. Ja, ich konnte sein Blut rauschen hören.
Er atmete unregelmäßig, Thomas hatte ihn schwer verletzt.
Justins Geruch wehte über die Lichtung, hüllte mich ein. Überall um mich herum roch es nach seinem Blut, nach Angst und Verzweiflung … und nach Tod.
Langsam ging ich auf Justin zu, je näher ich kam, umso stärker roch ich die Verzweiflung und die Angst. Als ich über ihm stand merkte ich mit einem Mal, dass der Geruch nicht von ihm stammte.
Er kam von mir und es strömte aus jeder Pore meines kalten Körpers.
Ich roch nach Verzweiflung und Angst.
Ich war verzweifelt, ich hatte Angst, sogar sehr große Angst.