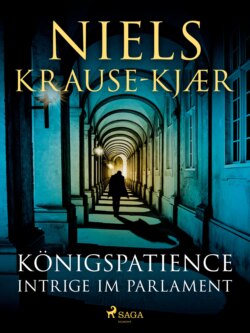Читать книгу Königspatience - Intrige im Parlament - Niels Krause-Kjær - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ZWEI
ОглавлениеWären die Ampeln in der Stadt doch nur rot gewesen. Oder wäre sie nur vorsichtig im vierten Gang gefahren, wie sonst, und hätte nicht in den fünften geschaltet. Hätten sie doch eine zweite Tasse Morgenkaffee getrunken. Hätten sie nur den Strandvejen genommen.
Doch wie vorbestimmtes Schicksal griffen eine Reihe von Zufällen an diesem Oktobermorgen ineinander. Eine leichte Rechtskurve, eine Windböe, ein kleiner Schwung mit dem Damenrad. Eine leicht überhöhte Geschwindigkeit. Ein etwas zu heftiges „Achtung!“ vom Beifahrer. Alles passte zusammen wie bei einem außergewöhnlich gerissenen und bösen Plan. Eine Sekunde vorher oder eine Sekunde später wäre es egal gewesen, dass der Wagen einen halben Meter auf die andere Spur kam. Dann wäre der Lkw entweder schon vorbei gewesen oder hätte ausweichen können. Doch in genau dieser Sekunde, an genau dieser Stelle der Kurve hatte weder die Fahrerin des Autos noch der Lkw-Fahrer eine Chance.
Das Auto faltete sich vorn, wo die Fahrzeuge aufeinandertrafen, wie ein Akkordeon zusammen. Der linke Flügel des Autos und der Motor wurden durch den Aufprall verschoben und brachen der Fahrerin die Beine, obwohl die japanischen Ingenieure jahrelang daran gearbeitet hatten, genau das zu verhindern.
Der Krach ruinierte den Frieden auf der Landstraße in weniger als einer Sekunde. Länger dauert es nämlich nicht, ein Auto zu zerstören, eine Frau zu töten und einen Mann schwer zu verletzen. Noch bevor der Schauer aus Glassplittern zu Boden gefallen war, ging der Tag weiter. Als wäre er nur einen kurzen Augenblick eingefroren gewesen. Eine Krähe schrie heiser. Ein Moped schleppte sich am Horizont den Hügel hinauf. Bloß der Lkw, der hundert Meter weiter zum Stehen kam, schien sich zu kümmern. Die Reaktion des Rad fahrenden Mädchens auf das, was sie zunächst hörte und dann eine Sekunde später beim Blick über die Schulter sah, hatte es noch nicht bis ins Hirn und aus der Kehle geschafft.
Die Polizei bestätigte, dass der geschockte Lkw-Fahrer die Situation korrekt erfasst hatte, als er über sein Handy den Notruf informiert hatte. Die Autofahrerin – eine ältere Frau – war durch schwere Kopfverletzungen auf der Stelle tot. Der Mann auf dem Beifahrersitz war auf den ersten Blick besser davongekommen. Auch wenn die eine Gesichtshälfte ein einziger Blutfleck war, so lebte er noch. Doch er war bewusstlos, es war also nichts sicher.
Durch das unbeschädigte Nummernschild wussten die Polizisten schnell, dass die tote Frau die zweiundsechzigjährige Hanne Bruun sein musste, Kinderärztin mit dem Schwerpunkt Psychiatrie und Ehefrau des Abgeordneten, früheren Außenministers und aktuellen Vorsitzenden der Demokratischen Partei, des dreiundsiebzigjährigen Aksel Bruun. Also musste er es sein, den der Rettungsdienst gerade aus dem Auto holen wollte. Das war leichter gesagt als getan. Mehrere Minuten lang versuchten die Retter vergeblich, die rechte Vordertür zu öffnen. Schließlich schnitten sie mit einer Rettungsschere das Blechdach des japanischen Autos auf.
Der Polizist bemühte sich, ganz unbeeindruckt zu klingen, als der diensthabende Beamte über Funk das prominente Ergebnis der Computersuche des Nummernschildes mitteilte.
Weiter vorn versuchte sein Partner das Mädchen auf dem Fahrrad zu trösten. Kollegen aus dem anderen Polizeiwagen sprachen mit dem Lkw-Fahrer. Noch wusste niemand von ihnen, dass die Arbeit des Tages und ein tragischer Unfall zu einem nationalen Zwischenfall werden würden.
„Wird er durchkommen?“, erklang die Stimme des diensthabenden Beamten krächzend über Funk. Die Frage entsprang eindeutig privater und nicht professioneller Neugier.
„Woher zum Teufel soll ich das denn wissen?“, antwortete der Polizist, ohne wirklich zu registrieren, was er sagte. Dreißig Meter weiter vorn sah er, dass es der Rettungsmannschaft endlich gelungen war, den bewusstlosen Aksel Bruun aus dem Auto zu ziehen. Um Hanne Bruun kümmerte sich noch niemand. Jetzt galt es zuallererst, den Verletzten auf eine Trage und in den Rettungswagen zu bringen.
Der Rettungswagen fuhr an der Absperrung vorbei und dann mit Vollgas in Richtung Krankenhaus Hillerød. Auf der fast verlassenen Landstraße war keine Sirene nötig. Um den Ernst der Situation trotzdem zu betonen, schaltete der Fahrer das Blaulicht an. Kurz danach hatte man Hanne Bruun auf eine Trage gelegt und in den anderen Rettungswagen gebracht.
Im Gegensatz zu Aksel Bruun verließ Hanne Bruun die leichte Rechtskurve ganz langsam.
*
Keine Stunde nach dem Zusammenstoß erfuhr Ritzaus Bureau davon. Früher waren die Polizisten auf dem Revier darüber irritiert gewesen, dass Journalisten routinemäßig auf der ewigen Jagd nach „Neuigkeiten“ anriefen. Inzwischen hatten sich die Partner angewöhnt, dass der diensthabende Beamte selbst anrief, wenn es etwas Neues gab. Auf diese Weise waren die meisten etwas entspannter. Das System funktionierte gut.
Nicht zuletzt, weil die Polizisten mit der Zeit ein gutes Gespür entwickelt hatten, was als „Neuigkeit“ für das Lokalradio, die Wochenzeitung, die regionale Tageszeitung und die landesweiten Medien zählte.
Zwei Minuten nachdem der Journalist von Ritzau an diesem Montagmorgen mit dem Polizisten gesprochen hatte, ging die Geschichte als Eiltelegramm an die Redaktionen:
Aksel Bruun lebensgefährlich verletzt:
Aksel Bruun, der Vorsitzende der Demokratischen Partei, Abgeordnete und früherer Minister wurde am Montagmorgen bei einem Autounfall schwer verletzt. Seine Ehefrau Hanne Bruun war sofort tot, wie die Polizei Hillerød mitteilt. (Später mehr).
Noch war es bloß eine elektronische Nachricht unter den Eingeweihten und Informierten. Doch in sechs Minuten, um zehn Uhr, würden die Radionachrichten diese spärlichen Informationen einer Million Dänen mitteilen.
In der Redaktion des Dagbladet in Christiansborg saß Ulrik Torp allein und blätterte etwas willkürlich in den Sonntagszeitungen. Überprüfung der Konkurrenz. Hatten die anderen Zeitungen etwas gebracht, worüber das Dagbladet hätte schreiben sollen? Nein, dieses Wochenende nicht, sagte Ulrik Torp sich selbst. Vielleicht abgesehen von einem erneuten Artikel im Feuilleton des Expressen über eine junge Abgeordnete der Demokraten, die behauptete, dass sie sich bis vor einem Monat vier Jahre lang in ihrem Wahlkreis in Thyborøn anderthalb Zimmer mit einer Freundin geteilt habe und nicht mit ihrem Freund in einer Fünfzimmerwohnung auf Amager zusammenwohnte. Der Unterschied zwischen den beiden Adressen– abgesehen vom Ort, dem Freund, ihren Möbeln, dem Weg zur Arbeit und zu den Bekannten – betrug 57.000 Kronen jährlich steuerfrei als besondere Kostenpauschale vom Parlament.
Am Sonntag ging es im Expressen um eine anonyme Information eines Lebensmittelladens in Thyborøn, dass die Abgeordnete nicht mal für ein bescheidenes Wochenende dort eingekauft hatte. Der Artikel brachte eigentlich kaum etwas Neues und diente nur noch dazu, die Geschichte rund um die Abgeordnete am Kochen zu halten. Doch der Rauch rund um die Affäre verzog sich langsam.
In den Fluren von Christiansborg war den meisten klar, was hinter der Geschichte mit den zwei Adressen steckte. Darüber war auch schon mehrfach geschrieben worden, aber man kann ja nicht ständig weitermachen! Meine Güte, so wichtig war sie als Politikerin nun auch nicht, selbst wenn die meisten fanden, dass sie viel zu billig davongekommen war, indem sie verkündet hatte, nun mit ihrem Freund zusammenzuziehen und auf alle besonderen Zulagen zu verzichten. Insbesondere weil – wie Ulrik Torp wusste – sie schon vor einiger Zeit wegen des Arrangements gewarnt worden war. Aber es war nicht der Stil des Dagbladet, Kampagnen gegen Personen zu fahren, rief Ulrik Torp sich ins Gedächtnis. Das konnte er auch später dem Chef vom Dienst sagen, wenn dieser über die Sonntagsgeschichte des Expressen nörgeln würde.
Die Christiansborgredaktion des Dagbladet hatte sich vor mehreren Wochen von der Sache abgewandt.
Zum vierten Mal an diesem Morgen blätterte er zu seiner eigenen Seite in der Sonntagsausgabe und genoss es, seinen Namen über dem Artikel zu sehen und seine Einleitung zum Skandal um die Gesundheitsministerin zu lesen: Wäre die Gesundheitsministerin ein Pferd, wäre sie geschlachtet worden.
Wer weiß, vielleicht war sie ja ein Pferd? Jedenfalls waren alle Medien dabei, den Kadaver aufzuteilen, nachdem das Dagbladet letzte Woche enthüllt hatte, dass die Ministerin über ihren Staatssekretär zwei Beamte gebeten hatte, die Statistiken zur Warteliste zu frisieren, damit sie besser aussahen. Würde gern wissen, ob sie die Woche überlebt, dachte Ulrik Torp gerade kühl, als das Telefon klingelte.
„Torp!“
„Willatzen. Hast du die Pressemitteilung von Ritzau gesehen?“, fragte der Nachrichtenchef aus der Hauptredaktion weniger als tausend Meter von Christiansborg entfernt. Willatzen verfügte nur über einen einzigen Tonfall, egal, ob er plauderte, befahl, fragte oder erklärte. Alles wurde im selben Stil und Rhythmus vorgebracht wie die Telegramme, die Willatzen zu Anfang seiner journalistischen Karriere bei Ritzau geschrieben hatte. Ob er auch mit seiner Frau so sprach?
„Es ist Montag. Noch nicht mal zehn.“ Torp schielte auf den Computerbildschirm, der nicht mehr angeschaltet worden war, seit er am Freitagabend seinen Pferdemetzgerartikel beendet hatte.
„Aksel Bruun hatte einen Autounfall. Seine Frau ist tot. Sieht so aus, als sterbe er auch. Treffen um elf Uhr. Leg los!“ Willatzen war weder wütend noch aufgeregt. Er war einfach im Arbeitsmodus. Er wusste auch, dass Ulrik Torp mit seinen zwölf Jahren Erfahrung als Journalist – die letzten fünf davon in Christiansborg – keine Belehrung darüber brauchte, wie man so eine Nachricht angeht:
Eine Reportage über den Unfall, Zeugen, Details. Beschreibung seines Zustands. Nachruf auf die Frau, Aussagen von Angehörigen, Freunden und Feinden – auch von früher –, um all das soll sich die Inlandsredaktion kümmern. Wer war der letzte Politiker, mit dem er gesprochen hat? Nachruf, klar, falls er kurz vor Redaktionsschluss sterben sollte. Ansonsten ein Porträt. Politische Kommentare. Politische Konsequenzen, wer übernimmt die Macht in der Demokratischen Partei?
Ulrik Torp konnte die fertigen Zeitungsseiten praktisch schon vor sich sehen, während er den Computer hochfuhr und die Telefonistinnen des Dagbladet bat, die anderen drei Politikreporter und den Volontär zu kontaktieren, die unter seiner Leitung das Politikressort der Zeitung ausmachten. Ja, sie sollten auf der Stelle kommen!
*
Aksel Bruun war im Grunde die Demokratische Partei, soweit viele sich erinnern konnten. Er saß seit zweiunddreißig Jahren im Parlament. Die letzten einundzwanzig Jahre als unbestrittener Anführer seiner Partei. Er war nicht das, was man in Christiansborg als typischen Parteibesitzer verstand. Parteibesitz verlangt vollkommene Aufopferung und Brutalität. Aksel Bruun betrieb ihn nicht und strebte ihn auch nicht an. Die Aufopferung verlangte einen zeitlichen Einsatz, den er nicht leisten wollte. Selbst als jüngerer Mann wollte er oft schnell nach Hause zu „Hanne“, wie sie hieß und daher auch von allen Freunden und Parteigenossen sowie Feinden und Medien genannt wurde. Und die Brutalität, die so viele Machtmenschen liebten, sagte ihm nichts. Im Gegenteil, er konnte auch nachsichtig sein. Den Leuten eine zweite Chance geben. Er musste bei Fraktionstreffen keine Parteigenossen fertigmachen, bloß um anderen zu zeigen, was passieren könnte. Einen Anschiss gab es – fast – immer hinter verschlossenen Türen und unter vier Augen. Und wenn andere davon erfuhren, dann nicht von Aksel Bruun.
Maßvoller Widerspruch war erlaubt, das wussten die Parteimitglieder. Aksel Bruun schätzte ein anspruchsvolles Gegenspiel. Wohlgemerkt solange man akzeptierte, dass er zu jeder Zeit die Grenzen ziehen konnte. Das tat er bei Weitem nicht immer. Oft ließ er andere die Konsequenzen ziehen, und manche hielten die Offenheit zu Beginn für Konfliktscheue, Wankelmut oder den Wunsch nach einer gemeinsamen Entscheidung. Aber das waren keine Zufälle, das wusste man in der Partei.
Als Parteivorsitzender kam Aksel Bruun manchmal in Situationen, in denen es keine Alternative zur Brutalität gab. Und dann zögerte er nicht. Es war, als würde seine normale, etwas übertriebene Offenheit dann zu einer übertriebenen Gewalt.
Als ob er, psychologisch gesehen, eine Brutalitätsquote zu erfüllen hatte, die jeder Parteivorsitzende auf Lager haben musste, um zu funktionieren. Eine Quote, die er nicht in täglichen Minidosen verschwendete, sondern nur in wenigen Momenten seines Lebens aufbrauchte.
Wenn es denn also geschah, kam die Brutalität – selbst nach den Normen von Christiansborg – in so gewaltigen Mengen und mit einer solchen Kraft, dass die meisten im Schloss – Freunde, Feinde, Journalisten, Reinigungskräfte, Kantinenangestellte und Wachen – nach Luft schnappten. Viele erinnerten sich immer noch daran, wie Aksel Bruun vor neun Jahren seinen besten Freund und politischen Kampfgefährten live im Fernsehen abgeschossen hatte. Dem vorausgegangen waren mehrere Tage mit Artikeln über den wirtschaftspolitischen Sprecher Bo Hartmann, der Verluste in seinem Unternehmen durch Währungsspekulationen ausgleichen wollte. Eine Zeit lang war das gut gegangen, doch als das internationale Währungssystem plötzlich einbrach, verlor Bo Hartmann in wenigen Tagen sein ganzes Vermögen und 240 Mitarbeiter seines Unternehmens ihre Arbeit. All das wegen einer – selbst in den Augen der liberalsten Geldwechsler – wahnwitzigen Währungsspekulation.
Als es herauskam, tobte die Debatte über Hartmanns Rolle zwei Tage lang in den Medien. Ob er den Posten als wirtschaftspolitischer Sprecher behalten könnte? Und was sagte sein Jugendfreund, der Parteivorsitzende Aksel Bruun dazu? Niemand zweifelte daran, dass Bo Hartmanns hohes Ansehen beim Parteivorsitzenden und seine ansonsten makellose politische Karriere sein politisches Leben retten würden. Die Frage war nur, wie viele Schrammen er davontragen würde.
Zwei Tage lang versuchte Bo Hartmann vergeblich, Aksel Bruun zu erreichen. Bei Fraktionstreffen wurde die Sache mit keiner Silbe erwähnt. Aksel Bruun würdigte Bo Hartmann keines Blickes. Jeder Versuch des persönlichen Kontakts wurde ignoriert. Genau wie Telefonnachrichten. Alles Nachhaken von Journalisten, um eine Meinung aus ihm herauszubekommen, wurde auf den täglichen achtzig Metern zwischen dem Fraktionsraum und dem Büro freundlich aber bestimmt abgewiesen.
Alle – Bo Hartmann, Fraktionsmitglieder, die Partei, Christiansborg und die Öffentlichkeit – warteten auf Aksel Bruuns Urteil.
Das kam am dritten Tag bei einem Livebeitrag in den Fernsehnachrichten.
Die Demokratische Partei hatte eine abendliche Fraktionssitzung und alle Medien warteten geduldig vor dem Fraktionszimmer. Nicht, weil man annahm, dass diese Sitzung zu einer Klärung führen würde. Aber irgendwann müsste Aksel Bruun reagieren, und es wäre eine Katastrophe, dann nicht zur Stelle zu sein. Daher waren die Medien in diesen Tagen alle ziemlich darauf fixiert. Die Klärung stand kurz bevor und egal, wie sie ausfiel, würde daraus eine gute Story werden. Entweder wurde Hartmann in der Fraktion degradiert, dann könnte man einen politischen Nachruf schreiben. Oder ihm passierte nicht viel, dann musste man über den moralischen Anspruch an Politiker schreiben und die Frage, wieso der nicht für die Demokratische Partei galt. Die Morgenzeitungen müssten sich mit einer empörenden Geschichte zufriedengeben.
Die Tür ging auf und Aksel Bruun kam als Erster aus dem Fraktionsraum. Er blieb stehen, ohne dass ihm andere aus dem Raum folgten. Damit wussten alle, dass jetzt das Urteil gefällt werden würde.
Die Journalistin der Fernsehnachrichten lachte fast vor Begeisterung. Aksel Bruun kam mitten in der Sendung. Eine Viertelstunde später wäre das Ganze live in den Nachrichten der Konkurrenz gelandet. Jetzt kam es „live von Pia Baggesen in Christiansborg“:
„Ich habe gerade die Fraktion und damit auch Bo Hartmann über die politischen Konsequenzen einer Reihe von Währungsspekulationen, über die Sie in den letzten Tagen so oft berichtet haben, informiert. Ich habe erklärt, sollte er bis zur Fraktionssitzung morgen um zehn Uhr nicht aus der Fraktion ausgetreten sein, wird er sowohl aus der Fraktion als auch aus der Partei ausgeschlossen. Am liebsten wäre mir, wenn er das Parlament verlassen würde, aber das ist natürlich seine eigene Entscheidung. Was Bo Hartmann getan hat, war nicht illegal. Aber es war falsch!“
„Hat Hartmann gesagt, dass er sich zurückziehen will?“ Pia Baggesen spürte die Aufregung im ganzen Körper. Sie war 26, hatte gerade die Journalistenschule beendet, hatte eine Vertretungsstellung bei den Fernsehnachrichten und stand jetzt genau da, wo sie stehen sollte: Im Zentrum, live und mit der Chance sowohl auf eine Außenreportage als auch auf eine Festanstellung.
„Bo Hartmann hat sich bei der Fraktionssitzung nicht zur Situation geäußert. Das war auch nicht geplant. Aber ich sehe es als selbstverständlich an, dass er natürlich meinem Rat folgen wird.“
„Schadet das der Demokratischen Partei?“
„Keine weiteren Kommentare.“
Unbeantwortete Fragen prasselten auf Aksel Bruun ein, während er ging. Die anderen Fraktionsmitglieder drängten gleichzeitig aus dem Raum. Als Bo Hartmanns gejagtes Gesicht in der Tür auftauchte, ging ein Ruck durch die vierte Macht. Die Kontrolleure der Demokratie drückten, riefen, schubsten und drängelten sich. Ein Fotograf, der aus Erfahrung einen kleinen Tritt mitgebracht hatte, um das richtige Bild zu schießen, fiel um, doch niemand achtete darauf. Pia Baggesen, die normalerweise immer Platz für ihre hübschen Ellbogen fand, landete eingequetscht zwischen Dagbladet und Expressen. Wie ein Kind, das in Tivoli in wenigen Sekunden von seinen Eltern getrennt wurde, verlor sie den Blickkontakt zu ihrem Kamerateam. Tränen traten ihr in die Augen, als ihr bewusst wurde, dass ihr die erste Livereportage ihrer Karriere entglitt.
Mehrere der Demokraten bildeten nun einen Schutzkreis um Bo Hartmann. Wie durch ein Wunder schaffte er es in den Flur und zum Aufzug, der unbeirrt auf und ab fuhr, egal, was in Christiansborg geschah.
Der Nachrichtensprecher bedankte sich bei Pia Baggesen in Christiansborg und versprach eine Fortsetzung. Das war natürlich besser als nichts.
Die Fortsetzung kam am nächsten Morgen, als Hartmann schriftlich seinen Rückzug aus dem Parlament mitteilte. Zwei Tage später beging er Selbstmord.
Aksel Bruun kommentierte diese Tragödie nie. Im darauffolgenden Jahr ging die Demokratische Partei eine Koalition ein. Der neue Außenminister konnte kurz darauf in einem bunten Wochenblatt lesen, dass er gerade eine Diät beendet hatte. In nur zehn Monaten hatte er sechzehn Kilogramm abgenommen und war mit seinen nun sechsundachtzig Kilo auf einhundertfünfundachtzig Zentimetern nah am Idealgewicht, wie es im Blatt hieß, das ebenfalls wusste, dass die Ehefrau des Außenministers begeistert von ihrem „neuen“ Mann war. Nur Hanne Bruun wusste, dass ihr Mann nicht mal im Traum eine Diät machen würde.
Seine Zeit als Außenminister hätte Aksel Bruuns politischer Höhepunkt werden sollen. Stattdessen wurden es drei Jahre voller harter Arbeit. Die Koalition war mehr eine Vernunftehe als eine Liebesheirat. Und mit der Zeit schliefen die Parteien auch getrennt auf dem Sofa, wenn sie sich nicht gerade anknurrten, wie die Tageszeitungen es beschrieben. Schließlich teilte Aksel Bruun mit, dass die Demokratische Partei die Regierung verließ, sie aber noch stützen wolle. Da war die Regierung eigentlich tot, das wusste man. Im darauffolgenden Jahr übernahmen die Oppositionen die Ministerwagen.
In den fünf Jahren danach gab Aksel Bruun mehr und mehr seinen direkten Einfluss auf die Partie ab. Er war immer noch der Vorsitzende. Er konnte immer noch zu jeder Zeit Grenzen setzen, aber er tat es immer seltener. Stattdessen ließ er den politischen Sprecher Sven Gunnar Kjeldsen und den Fraktionsvorsitzenden Erik Pingel den Laden leiten. Einer der beiden würde ihm nachfolgen, das hatte Aksel Bruun beschlossen. Ein edler Wettstreit sollte entscheiden, wer.
*
„Kjeldsen oder Pingel?“
Der Chef vom Dienst hatte die Konferenz um Punkt elf mit der Ankündigung eingeleitet, dass für die Berichterstattung in der morgigen Zeitung sechzehn Spalten und die erste Seite vorgesehen waren. Aber Willatzen war, ungeduldig wie immer, schon einen Schritt weiter als die Tagesordnung. Egal, ob Aksel Bruun überlebte oder nicht, als Vorsitzender war er am Ende.
„Kjeldsen oder Pingel?“, wiederholte Willatzen, ohne jemanden anzusehen.
Auch wenn am Konferenztisch des Dagbladet ein Chef vom Dienst, ein Cheffotograf, ein Fotograf, ein Grafiker, zwei Redaktionssekretäre, vier Politikjournalisten, zwei Reporter, zwei Praktikanten und ein Chefredakteur saßen, wusste Ulrik Torp genau, an wen die Frage gerichtet war.
„Kurz und knapp: Kjeldsen ist in der Fraktion der Beliebtere. Pingel ist innerhalb der Partei der Beliebtere. Würde man jetzt die Entscheidung fällen, läge Kjeldsen vorn. Pingel wird alles tun, um die Entscheidung hinauszuzögern.“
Ulrik Torp lehnte sich zurück. Ein bisschen von sich selbst beeindruckt. So klar hatte er die Situation bisher noch nicht zusammengefasst. Doch während er sich selbst zuhörte, war er überzeugt davon, dass es genauso war.
„Gibt es bei Ritzau etwas Neues zu Bruun?“
Willatzen kommentierte Torps Analyse nicht. Das bedeutete, dass er zufrieden und derselben Meinung war. Der Nachrichtenchef hasste diese Konferenzen. Er fand, es war Zeitverschwendung, die Leute um einen Tisch zu versammeln, wenn sie das, was sie tun sollten, auch direkt von ihm erfahren könnten. In Willatzens Weltbild dienten diese Meetings nur dazu, die Firmenwagen zu ehren – so nannte er konsequent die Gruppe von Chefs, von denen moderne Zeitungshäuser glaubten, dass sie für die Herstellung einer Zeitung nötig seien. Heute waren nur drei von ihnen anwesend, es schien also Grenzen zu geben, wie lange man dieses Schauspiel durchziehen wollte. Es war klar zu sehen, dass Willatzen endlich loslegen wollte. Und diese Konferenz passte seiner Meinung nach so gar nicht zum „Loslegen“.
Ulrik Torp stimmte ihm teilweise zu. Aber eben nur teilweise. Willatzen war altmodisch. Ein eminenter Blattmacher und katastrophaler Pädagoge. Er stammte aus einer Zeit, als eine Zeitung noch das Werk weniger Menschen war. Ein Chefredakteur an der Spitze, ein Lehrling ganz unten und dazwischen ein paar Journalisten. Heute war die Produktion einer Zeitung eine komplizierte Angelegenheit, bei der Design, Marketing, Vertrieb und Bündnisse drohten, die Konzentration der Leitung auf das Eigentliche zu ersticken – den Journalismus. Umgekehrt war das Ergebnis – die fertige Zeitung – heute stets von höherer Qualität als jemals zuvor. Sie war übersichtlich, kritisch, informativ, analysierend und viel besser geschrieben als pensionierte Journalisten zugeben wollten. Wenn man das Beste aus Willatzens Welt mit der heutigen Zeit mischte, konnte es kaum besser werden. Das Problem war nur, dass es nicht mehr viele Willatzens gab, dachte Torp und betrachtete das immer unruhige Gesicht des Nachrichtenchefs liebevoll: die breite Nase und die unglaublich vielen Haare, die aus seiner Nase und seinen Ohren quollen und dieselbe grauschwarze Farbe hatten wie der chaotische Heuhaufen auf seinem Kopf und die zusammengewachsenen, buschigen Augenbrauen.
Wäre er eitel gewesen, hätte er ein Vermögen für den Friseur und Rasierer ausgegeben. Aber das war Willatzen nicht. Er war ungeduldig.
„Ritzau. Bruun!“
Die jüngste Redaktionssekretärin wedelte mit einigen kurzen Telegrammen.
„Das hier kam um 10:58 Uhr. Bruun liegt im Koma und wurde ins Rigshospital gebracht. Zwischen den Zeilen wird angedeutet, dass er im Sterben liegt. Um 10:45 Uhr gab es eine Erklärung von Pingel. Einen Moment … hier ist sie: Ich bin über den Unfall tief betroffen. Hanne Bruun war nicht nur ein warmherziger Mensch und eine herausragende Kinderpsychiaterin. Sie war auch eine unschätzbare Stütze für Aksel Bruun und eine Inspiration für die Demokratische Partei. Meine Gedanken gelten ihrem Sohn und den Enkeln, die …“
Willatzen unterbrach den Redaktionssekretär, der sich nicht sehr gelungen an einer Parodie der Königin versuchte. „Er hat echt keine Zeit verloren, dieser Pingel.“
Für die Firmenwagen ließ Willatzen die Diskussion zwanzig Minuten gewähren. Alle wussten, dass sich der größte Wagen um 11:30 Uhr mit einem führenden Autor zu einem zweiten Frühstück traf. Von 11:28 Uhr an konnte man sich daher ganz in Ruhe der Zeitung widmen. Es war also wichtig, sich nicht zu sehr festzulegen.
„Den Unfall und das Krankenhaus haben wir abgedeckt. Bjarne und Lars sind mit den Fotografen auf dem Weg dorthin. Aber im Fernsehen und im Radio geht es den ganzen Tag darum. Das reicht für morgen früh also nicht. Wir MÜSSEN mehr bringen. Auf jeden Fall auf der ersten Seite. Wir müssen beantworten, wer der Neue an der Parteispitze wird. Und das ist deine Aufgabe, Torp.“ Willatzen schielte zur Uhr links neben der Tür. 11:27 Uhr.
„Es ist doch möglich, dass keiner eine Ahnung hat, wer von den beiden es wird“, warf der jüngste Redaktionssekretär ein.
„Na, dann können sie es ja im Dagbladet lesen“, verkündete Erhardsen fröhlich, der größte Firmenwagen im Raum, der zweitgrößte im ganzen Haus. „Es scheint ja zu laufen“, sagte er und klopfte sich offensichtlich gut gelaunt auf den Oberschenkel. „Beweisen wir, dass wir die anderen Zeitungen um Längen schlagen. Auf, Leute!“, fuhr der Chefredakteur fort, stand auf, ging hinaus und schloss die Tür hinter sich.
„Was für eine Ansprache“, murmelte der Cheffotograf, worauf der gesamte Tisch laut loslachte. Sogar Willatzen.
*
Parteisekretär Peder Schou wand sich. Er hatte nur selten das Gefühl, den Fraktionsvorsitzenden zurechtweisen zu müssen. Doch seit zwei Stunden war das Handy, dessen Nummer nur er und wenige andere kannten, auf Voicemail geschaltet. Das einhundertzweiundfünfzig Gramm schwere Telefon in Erik Pingels Innentasche war das Rote Telefon der Partei, wie jenes, das im Kalten Krieg den Kreml und das Weiße Haus verbunden hatte. Man sollte den Fraktionsvorsitzenden immer erreichen können. Egal warum. So war es abgesprochen. Doch obwohl es alle fünf Minuten klingelte, hatte es fast zwei Stunden gedauert, bis Pingel rangegangen war. Und nicht zum ersten Mal machte Peder Schou in einem vorsichtigen Tonfall darauf aufmerksam, während er von dem Unfall erzählte.
„Ach, was für ein Mist. Kommt er durch?“
„Ich weiß nicht mehr als Ritzau. Das letzte Telegramm zu Aksel ist eine halbe Stunde alt. Da lag er im Koma, aber es heißt, er werde sterben. Lars Bruun ist im Krankenhaus. Ich habe eine Nachricht hinterlassen, dass er anrufen soll.“
„Lars?“
„Aksels Sohn.“
„Ich komme sofort. Kannst du irgendwas schreiben, dass ich trauere, dass Hanne ein großer Verlust für die Partei ist, die Familie in unseren Gedanken ist und all so was und das dann an Ritzau schicken?“
„Das hast du vor einer dreiviertel Stunde gemacht.“
„Gut! Ich bin in einer halben Stunde da.“
Peder Schou legte auf. Erik Pingel klappte sein Handy zusammen. In acht Jahren einer sehr engen Zusammenarbeit hatte er gelernt, wann ein Gespräch beendet war und dass banale Höflichkeitsfloskeln wie Danke, Tschüss und Hallo formelle Umgangsformen waren, mit denen sie ihre Zeit nicht verschwenden wollten. Außerdem schuldeten sie einander so viel, dass sie sich den ganzen Tag über beieinander hätten bedanken können. Schou wusste jedoch genau, dass er Pingel mehr schuldete. Und wenn er es doch mal vergaß, ließ Pingel keine Gelegenheit verstreichen, um ihn – sehr diskret, oft bloß durch einen kleinen Blick – daran zu erinnern.
Peder Schou rauchte die neunte von täglich sechzig Zigaretten. Er wusste genau, dass es Nummer neun war. Bis auf zwei lagen alle Kippen in seinem großen Aschenbecher. Der Parteisekretär hatte die Angewohnheit, seine Aschenbecher aufzuteilen. In den einen aschte er – die pyramidenförmige Asche wurde im Laufe des Tages immer höher. In den anderen drückte er die Filter aus, die immer bis ganz an den Rand geraucht waren. Sie lagen in ordentlichen Reihen wie ein Holzstapel. Zwölf ganz unten. Die ersten beiden Zigaretten des Tages lagen auf der Helsingør-Autobahn. Da landeten normalerweise auch die letzten zwei des Tages, wenn er spätabends zurück in sein Haus in Hørsholm fuhr, um sofort ins Bett zu gehen. Bis vor wenigen Jahren war er verheiratet gewesen. Die Scheidung war undramatisch und gleichgültig gewesen. Sie hatte sein Leben nicht verändert, sie hatten keine Kinder und keine finanziellen Probleme, sodass er im Haus bleiben konnte. Abgesehen von den sechzig Zigaretten brauchte Peder Schous langer, schlaksiger Körper bloß einige Liter Kaffee, ein Käsebrot, zwei belegte Brote und abends ein ganz kleines, etwas exklusives Essen. Üblicherweise in einem Restaurant in der Stadt. Er sah das nicht als Luxus, dachte kaum daran, was es kostete. Der Parteisekretär konnte sich gar nicht mehr daran erinnern, wann er das letzte Mal ein Abendessen in der Stadt selbst bezahlt hatte. Auch diesen Teil des Lebens übernahm die Diners-Karte der Partei. Er wusste, dass er ein ungesunder Vierundvierzigjähriger war. Er wusste, dass ihm mindestens zehn Kilo fehlten, um auch nur in die Nähe des Normalgewichts zu kommen. Er wusste ebenfalls, dass er sich daran gewöhnt hatte, dass es ihm egal war.
Das Telefon klingelte.
„Peder Schou.“
Er nahm das Telefon und feuerte seinen Namen ab wie eine Maschinengewehrsalve. „Peder“ verschwand fast im Mund. „Schou“ erklang hart zwischen den dünnen Lippen und in einem Was-zum-Teufel-willst-du-Tonfall, ein Resultat der acht Jahre, in denen er viel zu oft von Leuten angerufen worden war, die praktisch alle etwas wissen oder eine Erlaubnis haben wollten.
„Pia Baggesen, Fernsehnachrichten, hallo Peder.“
„Hallo Pia.“
„Was für eine Scheiße, was?“
„Das kann man wohl sagen.“
„Was passiert nun?“
„Ich weiß gar nichts. Ich habe gerade mit Erik gesprochen. Er ist auf dem Weg hierher.“
„Können wir ihn filmen, wenn er nachher kommt? Draußen auf dem Parkplatz zum Beispiel?“
„Ja … das könnt ihr sicher.“
Peder Schou überlegte einen Sekundenbruchteil: Gute oder schlechte Idee? Gut. Also abgemacht, gut.
„Ich bespreche das mit ihm. Es dauert noch eine knappe halbe Stunde.“
„Was ist mit der Fraktionssitzung?“
„Die kommt wahrscheinlich erst morgen früh, wie geplant. Ich weiß es nicht hundertprozentig, aber danach solltest du Erik lieber nicht fragen, wenn du ihn erwischst. Ich meine, … bei dem Beitrag sollte es wohl um den Schock des Unfalls gehen. Um die Hoffnung, dass Aksel überlebt und so was.“
„Ja, ja. Das ist klar.“
„Was die Fraktionssitzung angeht, entscheiden wir später, aber rechne nicht damit, dass es vor morgen etwas Offizielles gibt.“
„Wie geht’s euch?“
„Was meinst du?“
„Ja, wegen Aksel und seiner Frau und allem.“
„Nun. Wir sind natürlich schockiert. Aksel war wirklich okay, oder ist es. Er ist ja schließlich nicht tot. Noch nicht. Birthe, meine Sekretärin sitzt vor dem Büro und weint leise. Wobei man das nicht zu hoch hängen darf. Sie weint auch, wenn eine Hausfrau einen Volkswagen beim Glücksrad gewinnt. Aber es ist scheiße. So richtig scheiße.“
„Das allerdings. Wir sprechen uns. Danke für die Hilfe mit Erik.“
„Das war doch nichts. Soll ich ihn bitten, zunächst rechts vor dem Schlossgarten zu parken? Dann könnt ihr die Kamera direkt richtig platzieren?“
„Das wäre toll. Danke, Peder. Tschüss.“
Peder Schou zündete eine Zigarette an und rief sofort Erik Pingel an. Er war immer noch auf der Autobahn, noch fünfzehn Minuten entfernt, und würde darauf achten, nach rechts in Richtung von Pia Baggesen, ihrem Kamerateam und den dänischen Wohnzimmern zu fahren, wenn er in den Schlossgarten kam.
Pia Baggesen! Peder Schou konnte sie vor sich sehen. Wie sie zielstrebig aus der Nachrichtenredaktion in der zweiten Etage die Treppe hinunterging, die spitzen Absätze hallten auf den Marmorstufen wider, der Kameramann mit seinen Geräten wie üblich sechs bis acht Schritte hinter ihr.
Sie hatten fast gleichzeitig in Christiansborg angefangen. Sie hatte eine feste Stelle bei den Fernsehnachrichten bekommen, nachdem sie eine Weile Vertretung gemacht hatte. Wäre sie nicht so hübsch oder ein Mann gewesen, hätte man sie nicht etwas kritisch ehrgeizig genannt. Dann hätte sie einfach nur zum Job gepasst. Doch wenn man zwar keine klassische Schönheit, aber doch hübsch war, 35 Jahre, ohne Kinder und Mann und ganz in seinem Beruf in einem traditionell männlichen Umfeld wie Christiansborg aufging, dann war man auf eine etwas suspekte Art ehrgeizig. Jedenfalls fanden das viele. Peder Schou mochte sie allerdings. Sie war kompetent, schnell und hatte keine Angst, gute Storys zu bringen, wenn beide etwas davon hatten.
Jetzt bekäme sie zum Beispiel gute und exklusive Bilder. Der Fraktionsvorsitzende der Demokratischen Partei auf dem Weg nach Christiansborg, nachdem er von dem schrecklichen Unfall gehört hatte. Dadurch erhielten eine Million Zuschauer den Eindruck, dass Erik Pingel die Trauer der Partei ausdrückte und die Person der Einheit war. Vielleicht würde Pia Baggesen zu dem Bild des ernsten Erik Pingel etwas sagen wie, dass hier der wahrscheinlich zukünftige Parteivorsitzende zu sehen war, sollte Aksel Bruun es nicht schaffen. Nein, darauf zu hoffen, wäre schon wieder zu viel.
Das Telefon klingelte schon wieder.
„Peder Schou.“
„Ivan Pedersen. Guten Tag, Peder.“
„Guten Tag, Ivan.“
„Das ist ja wirklich eine furchtbare Sache“, begann Ivan Pedersen, Bezirksvorsitzender in Hobro. Er wollte ein längeres Gespräch über das Leben, den Tod und die Politik mit dem Parteisekretär führen, mit dem er sich vor drei Monaten so gut bei einem Kurs für Kandidaten unterhalten hatte.
„Ja, wir sind ziemlich erschüttert.“ Peder Schou schaltete seinen erfahrenen Autopiloten ein, er hatte ihn noch nie enttäuscht. Er sagte an den richtigen Stellen ja und nein.
Er konnte nicht einfach auflegen oder sagen, dass er keine Zeit hatte. Hobro war sein Zugang zu Ehrenamtlichen im Landkreis Nordjütland. Der verfügte über viele Stimmen bei einer regionalen Sitzung und zwei Stimmen im Hauptvorstand. Vier bis fünf Minuten mussten allerdings genügen. Er ließ den Parteigenossen reden, während er auf seine Rolex sah. Alle dachten, es wäre eine Fälschung, was ihn unfassbar ärgerte. Nach vier Minuten und einer kleinen Öffnung im Redestrom wurde der Parteisekretär aktiv.
„Ja, wir sind alle sehr geschockt.“ Peder Schou tippte mit einer Hand auf seinem Handy. Acht wohlbekannte Ziffern.
Das Telefon Nummer zwei klingelte wie geplant auf dem großen, ordentlichen Mahagonischreibtisch, der schon seit den 1920er-Jahren im Besitz der Partei war. Der Tisch hatte einem kinderlosen Konsul gehört, der alles der Partei vermacht hatte.
„Ivan. Ich muss Schluss machen. Mein anderes Telefon klingelt. Das ist sicher das Krankenhaus. Wir sprechen später noch.“
„Kann sein, dass ich in drei Tagen nach Kopenhagen komme. Dann schaue ich mal vorbei“, sagte der Bezirksvorsitzende von Hobro. Seine Stimme klang, als würde er sich mit den Fingerspitzen an eine Poolkante klammern, wohl wissend, dass er in wenigen Sekunden ins Dunkle rutschen würde. Das Wasser lief ihm bereits in die Nase, nach dem ersten Schluck Wasser hustete er. Gleichzeitig drückte die Stimme Dankbarkeit aus, überhaupt so lange gelebt zu haben.
„Vielleicht Donnerstag?“
„Ja, tu das. Tschüss, Ivan“, sagte Peder Schou, drückte damit sozusagen den Kopf des Bezirksvorsitzenden unter Wasser und hielt ihn dort.
Der Parteisekretär klappte sein Handy zusammen, damit sein anderes Telefon aufhörte zu klingeln, stand abrupt auf und ging ins Vorzimmer.
„Was denkst du dir denn nur? Mir jetzt Regionalleute durchzustellen. Setz doch einmal deinen Kopf ein, wenigstens ein bisschen. Und jetzt will ich einen frischen Kaffee und was zu essen von Brydesen. Sofort!“
Wie ein geschlagener Hund stand seine Sekretärin auf und gehorchte.
*
„Zunächst ist es ein schrecklicher Verlust und ein furchtbares Unglück für Aksels und Hannes Sohn Lars Bruun und seine Familie. Mein Mitgefühl gehört ihnen. Es ist auch für mich ein großer Verlust. Ich kannte Hanne als eine lebensbejahende und aufrichtige Frau. Sie war – im Privaten – die größte Kritikerin ihres Mannes und der Partei. Und wir können nicht ohne sie. Das müssen wir nun aber leider. Unsere Hoffnung ist bloß, dass Aksel Bruun uns nicht auch genommen wird. Er ist ein Stützpfeiler der gesunden Vernunft und der Stärke. Nicht nur die Demokratische Partei und die dänische Politik werden ihn vermissen. Ich persönlich kann mir Christiansborg ohne ihn gar nicht vorstellen.“
Erik Pingel stand auf dem Parkplatz im Schlossgarten. Der Wind fuhr in sein etwas zu langes Haar, das auf seine Brille wehte. Mit der allen Dänen aus vielen Jahren im Fernsehen wohlbekannten Geste, linke Hand darunter und dann nach hinten, richtete er es wieder. Erik Pingel hatte fast eine Überkämmfrisur, aber nur fast. In den nächsten Jahren müsste er eine Entscheidung treffen. Eigentlich war die schon getroffen. Von seiner Frau. Sie hatte sein Übergewicht und seinen Bauch akzeptiert, aber sie wollte keinen Mann mit überkämmter Halbglatze. Die Wähler wahrscheinlich auch nicht, also fiel die Entscheidung nicht schwer. Pingel bereitete sich als Sechsunvierzigjähriger mental auf ein Leben mit Halbglatze vor.
„Was geschieht jetzt?“
„Jetzt geschieht Folgendes: Ich setze mich in mein Büro und starre eine Weile vor mich hin. Denn ehrlich gesagt, ist das hier nicht auszuhalten.“
Erik Pingel war offensichtlich betroffen. Seine Stimme brach leicht, als er, die Haare vor den Augen und die linke Hand bereits auf dem Weg nach oben, umdrehte, um über den Parkplatz zur Hintertreppe von Christiansborg zu gehen.
Die Fernsehkamera folgte ihm bis zum Schluss. Pia Baggesen hatte ganz selbstlos auf eine Außenreportage verzichtet. Stattdessen sprach sie über die Bilder:
„Die Demokratische Partei steht heute nach dem tragischen Unfall unter Schock. Die Fraktion trifft sich erst morgen, am Dienstag um zehn Uhr zur üblichen Fraktionssitzung. Sollte Aksel Bruun sterben oder nicht mehr in der Lage sein, als Parteivorsitzender zurückzukehren, muss ein neuer gefunden werden. Wenn es schnell geschieht, ist der Favorit wahrscheinlich Erik Pingel.“
„Ach, was für ein Quatsch!“
Ulrik Torp war fast allein. Die Fernsehnachrichten liefen im kleinen Büro unterm Dach von Christiansborg bloß im Hintergrund. Das Büro im dritten Stock mit den schrägen Wänden bot nur drei Journalisten Platz. Sie saßen zu fünft hier. Wären da nicht die Stapel alter Zeitungen vor dem Dachfenster, hätte dort noch einer sitzen können. Und ohne den kleinen, runden Tisch mit den kurzen Beinen und den schlecht platzierten, drehbaren Lehnstuhl, der nur als Ablage für Jacken und Taschen benutzt wurde, wäre es eigentlich ganz geräumig in der Christiansborgredaktion des Dagbladet gewesen. Jetzt war es allerdings bloß unordentlich und überfüllt. Der Regen trommelte gegen die Fensterscheiben, und es zog durch die alten Fensterrahmen des Schlosses. Abgesehen vom Fernseher an der Wand störte nur noch das heftige Tippen auf den Tastaturen Ulrik Torps Ausbruch. Es herrschte weder Stress noch Panik. Konzentriert wurde nur an den zehn Spalten plus Titelseite über den Aksel-Bruun-Unfall gearbeitet, die die vier Politikjournalisten und der Volontär füllen mussten. Das würden sie schon schaffen. Und die Hauptredaktion würde die Artikel zu gegebener Zeit und nicht erst kurz vor knapp bekommen. Es war 18:40 Uhr. Noch viel Zeit.
„Bei uns im Studio ist der Politikredakteur des Expressen, Oluf Hansen. Wird sich die politische Landschaft verändern, wenn Aksel Bruun nicht mehr zurückkehrt?“
„Idiot!“, rief Ulrik Torp. Er genoss es, alles zu kommentieren, was er im Fernsehen verfolgte. Seine Kollegen verdienten hier ihr Geld und hatten sich daran gewöhnen müssen. Seine Frau dagegen ärgerte es ganz furchtbar.
Das Telefon klingelte. Nicht das gemeinsame für die ganze Redaktion, sondern Ulrik Torps persönliches. Auf dem Display sah er, dass es Willatzen war.
„Ja!“
„Im Fernsehen heißt es, dass Pingel klarer Favorit ist, wenn es schnell geht. Du schreibst etwas anders.“
„Glaubst du Pia Baggesen mehr als mir, weil sie mehr verdient als ich?“
„Nein, weil sie hübscher ist!“
Ulrik Torp war gerade nicht in der Laune für solche Bemerkungen. Er hatte es so satt, dass alle – nicht nur die Leser, Freunde, Familie, seine eigene Frau, sondern jetzt sogar noch seine Chefs – dem Fernsehen mehr trauten als den Zeitungen.
„Du fragst, weil Erhardsen angerufen hat, stimmt’s?“
„Das ist vollkommen gleichgültig“, unterbrach Willatzen. „Eine Million Dänen gehen heute Abend in dem Glauben ins Bett, dass Pingel der Favorit ist. Wenn ihr morgen früh das Gegenteil behauptet, haben sie ein Problem. Was sollen sie glauben?“
„Sie sollen mir glauben. Ich habe vielleicht nicht recht, aber meine Analyse ist weiß Gott die qualifizierteste. Zweifelst du wirklich daran?“ Torp nahm es fast als Beleidigung.
„Nein, du weißt sehr gut, dass ich das nicht tue“, Willatzen stand zweifellos unter Druck, „aber bau bitte ein paar Vorbehalte ein, okay?“
„In meinen Analysen finden sich immer Vorbehalte.“
„Ja, dann bau halt noch mehr ein, Herr Gott.“
„Dann wird es doch völlig nichtssagend. Sag mal, was ist denn da los?“
„Schick mir eine neue Version mit mehr Vorbehalten“, sagte Willatzen fast entschuldigend und legte auf.
Ulrik Torp lehnte sich zurück. Oluf Hansen, der politische Redakteur des Expressen tat immer noch klug im Fernsehen.
„Wir müssen bis zurück in die 1960er, um eine ähnliche politische Situation zu finden“, belehrte er. „Woher weiß er das?“, rief Torp aggressiv in den Raum, „Oluf Hansen war damals noch nicht mal mit der Grundschule fertig“, sagte er und ignorierte, dass er die selbst erst in den Siebzigern abgeschlossen hatte.
Keiner seiner Kollegen sah auf. Sie schrieben. Gereizt setzte Torp sich an den Computer, um eine Handvoll Vorbehalte in seine politische Analyse zum Vorteil von Erik Pingel einzubauen.
*
Eine ratlose Fraktion wird vermutlich in recht kurzer Zeit einen Nachfolger von Aksel Bruun als Parteivorsitzenden auswählen. Zwanzig Jahre lang hat sich niemand in der Partei fragen müssen, wer bestimmt. Weder unter den Ehrenamtlichen noch in der Fraktion. Eine solche Situation prägt die Seele und Selbstwahrnehmung einer Partei. Kämpfe fanden in der zweiten Reihe statt, zwischen den Offizieren. Und auch wenn diese Kämpfe manchmal heftig waren, so haben sie nie die Partei gefährdet. Aksel Bruun bestimmte schließlich! Daher sind die Folgen des plötzlichen Vakuums, das durch den Unfall des dreiundsiebzigjährigen Aksel Bruun entsteht, schwer vorherzusehen. Stirbt er, muss sofort jemand Neues gefunden werden. Überlebt er, wird das Bewusstsein, dass er nicht unsterblich ist, die Partei zutiefst verändern. In jedem Fall rücken die Offiziere ins Rampenlicht, der politische Sprecher Sven Gunnar Kjeldsen und der Fraktionsvorsitzende Erik Pingel …
Jan, der ehrgeizige und recht talentierte Journalistenschüler hörte auf, die Analyse des Politikredakteurs zu lesen. Er hatte sich angewöhnt, nach Redaktionsschluss am Computer in den Artikeln zu stöbern. Nicht, um etwas über Journalismus zu lernen, sondern vor allem, weil er sich sehr für Politik interessierte und nicht bis zum Morgen warten wollte, um die Artikel zu lesen.
„Warst du bei der Redaktionskonferenz heute Morgen nicht schärfer?“ Es waren nur noch er und Ulrik Torp übrig. Die anderen drei wollten schnell nach Hause. Zwei von ihnen hatten an diesem Montag eigentlich freigehabt. Alle drei waren letztes Jahr zum ersten Mal Vater geworden. Sie wollten nach Hause zu den Windeln und einer müden Frau und dem ewig schlechten Gewissen. Torps zwei Kinder waren vergleichsweise alt – fünf und neun Jahre. Aber er erinnerte sich noch gut daran, wie es war, als sie noch ganz klein waren.
„Die Welt ist selten so eindeutig wie eine Redaktionskonferenz“, erwiderte Ulrik Torp. Er wollte niemandem von seinem kleinen Zusammenstoß mit Willatzen erzählen.
„Außerdem habe ich heute Nachmittag von meinen Quellen gehört, dass die Situation etwas undurchsichtiger ist, als ich heute Morgen dachte“, log er. Eigentlich klang das noch glaubwürdig. Es könnte durchaus stimmen. Vielleicht war es doch gut, dass noch ein paar Vorbehalte in die Analyse eingeflossen waren.
Jan stand auf und nahm seinen Mantel vom alten Lehnstuhl.
„Kommst du morgen mit laufen? Eine kleine Runde um die Seen? Sechs Kilometer?“
Der Volontär scherzte. Vor ein paar Wochen hatte Torp sich vor lauter Übermut und schlechtem Gewissen überreden lassen. Als er selbst Volontär und zweiundzwanzig war, rannte er, so oft er wollte, um die verdammten Seen. Vierzehn Jahre, vierzehn Kilo und fünfundzwanzig Prince-Zigaretten täglich, die schnell zu Light, dann zu Ultra Light und dann zu nichts mehr geworden waren – später war er demütig geworden. Er hatte sich in einen etwas ungesunden Vorstadtehemann verwandelt, der jeden Tag zur Arbeit fuhr, zwei Mal pro Woche die Kinder abholte, am Wochenende den Rasen mähte und sich einmal im Monat kontrolliert betrank. Alles, was er in Jans Alter verachtet oder worauf er bestenfalls herabgesehen hatte – hatte er übernommen. Erst an dem Tag, als er um die Seen gelaufen war, war ihm das richtig bewusst geworden. Zu seiner eigenen Überraschung störte es ihn kaum. Er fand es sogar ein bisschen witzig, dass es plötzlich einen Generationenabstand zwischen ihm und einem anderen Menschen, dem er sich verbunden fühlte, gab. Ulrik Torp genoss es, sich gegenüber dem Volontär ein onkelhaftes Image zu geben.
„Lass uns morgen lieber um die Wette schreiben“, sagte er grinsend.
„Dann laufe ich allein. Bis morgen.“
„Komm lieber früh. Wir werden viel zu tun haben.“
„Klar. Tschüss.“
Ulrik Torp war allein. Er hatte noch eine halbe Flasche Bier, und er mochte das Gefühl, fast allein in Christiansborg zu sein. Es war bald halb elf. Der Regen wurde stärker und wurde von Windböen gegen die Fenster gedrückt. Es war hier fast wie in einer Höhle unter Christiansborg.
Das Telefonklingeln schreckte ihn auf. Es war seine Durchwahl. Dann war es sicher Karen, die wissen wollte, wann er nach Hause käme.
„Ulrik.“
„Peder Schou. Entschuldige, wenn ich störe.“
„Das macht nichts.“ Ulrik Torp setzte sich hin.
„Bist du allein?“
„Ja, nur als Chef darf man so lange auf der Arbeit bleiben. Was kann ich für dich tun, Peder? Übrigens tut es mir aufrichtig leid für Aksel. Ich mochte ihn.“
„Wir alle mochten ihn. Nein, ich rufe eigentlich nur an, um zu sagen, dass die Fraktionssitzung morgen erst um zwölf Uhr stattfindet anstatt um zehn Uhr.“
„Ja?“
„Außerdem, ähh …“, der Parteisekretär der Demokratischen Partei zögerte, das Gespräch zu beenden, „… was sagt ihr sonst zu all dem? Also im Dagbladet?“
„Gelinde gesagt, wird es die Zeitung morgen prägen. Ich weiß, dass es im Gespräch war, es als Aufmacher zu nehmen, aber weil er nicht tot ist, machen sie es doch nicht. Offiziell hat die Zeitung also keine Stellung zu irgendwas bezogen.“
„Also, ich meinte auch so … ganz allgemein.“
„Aha. Na ja, viele Kollegen sind persönlich sehr betroffen. Also jedenfalls betroffen. Ich glaube, das sind wohl viele im Land, egal, wo sie politisch stehen. Ein Autor – ich habe nicht gehört, wer – hat heute Nachmittag im Radio gesagt, das Aksel Bruun zum Teil des nationalen Mobiliars geworden wäre. Das hätte ich gern selbst geschrieben.“
„Robert Madsen.“
„Was sagst du?“
„Robert Madsen. Der Autor mit dem nationalen Mobiliar. Das war Robert Madsen“, erklärte der Parteisekretär.
Der Name sagte Ulrik Torp nichts, aber es konnte trotzdem gut ein halbwegs bekannter Schriftsteller sein. Die Literatur war nicht gerade seine starke Seite.
„Es wird sich irgendwann wohl ein Nachfolger für ihn finden“, philosophierte Schou vorsichtig.
„Ich habe es heute Morgen analysiert. Es wird wahrscheinlich entweder Kjeldsen oder Pingel.“ Torp formulierte es nicht wie eine Frage. Er war verwirrt und wartete etwas ab. Sie waren gewohnt, miteinander zu sprechen, tauschten oft Informationen aus, nutzen und kannten sich beruflich sehr gut.
Die Gespräche waren immer sehr konkret. Dieses hier nicht.
„So wird es sein.“
Ulrik Torp hätte am liebsten geradeheraus gefragt, was dieses Gespräch sollte. Aber irgendetwas sagte ihm, dass er es lieber bleiben lassen und stattdessen mitspielen sollte.
„Siehst du denn noch andere Möglichkeiten?“
„Ich? Nein, nein. Das tue ich nicht. Gar nicht.“
Wäre das Gespräch ein Motor, wäre der jetzt stehen geblieben. Torp wollte nicht den Choke ziehen. Er wollte auch nicht den Zündschlüssel drehen. Das musste Schou tun.
„Das heißt“, stotterte der Motor, „manche meinen, dass Svenningsen der Richtige wäre.“
Svenningsen brachte vorübergehend etwas Treibstoff ins Gespräch. Beide wussten, dass der Namen garantiert im Laufe des Tages vorgeschlagen worden war. Beide wussten auch, dass es Svenningsen selbst war, der das getan hatte. Und beide wussten, dass niemand – außerhalb seines eigenen Wahlkreises – es ernst nahm. Genau deswegen konnte er sich so etwas erlauben, ohne dass es Konsequenzen hatte. Svenningsen war aus irgendeinem Grund in seiner Heimatstadt sehr beliebt, man sah ihn dort als großes politisches Talent. In Christiansborg wurde er geduldet, nach der Devise, dass sich 8.000 Wähler durchaus irren können. Und sie hatten das verfassungsmäßige Recht, das immer und immer wieder zu tun.
Torp lachte nicht nur pflichtschuldig über Schous Bemerkung. Er konnte sich sehr gut vorstellen, dass Svenningsen das Gefühl hatte, dass der politische Spitzenposten ganz nah war. Wie er als heimlicher Glücksjäger „zufällig“ in einer offenen Bürotür stehen und sich als Kompromisskandidat anbieten würde. Und wie die Fraktion die Maske aufbehalten und Svenningsen ernsthaft erklären würde, dass er als gewichtiger Politiker zu viele Parteigenossen zu oft vor den Kopf gestoßen hatte, um als Kompromiss zu gelten. Und er konnte sich gut vorstellen, wie Svenningsen diese Aussage nach einem kurzen Zögern als Rettungsanker für sich selbst, seine Frau und seinen Wahlkreis akzeptieren würde.
Das Lachen verklang. Nach einem heftigen, aber kurzen Aufheulen, stand der Motor wieder still. Torp ließ das Gespräch ersterben.
„Aber manche reden darüber, dass sie sich nicht trauen werden, Kjeldsen zu wählen“, sagte Peder Schou wie nebenbei.
„Er ist bei den Journalisten wohl nicht so beliebt wie Pingel, aber das macht sicher keinen Unterschied.“
„Neee. Daran denken sie nicht. Es geht mehr um alte Zeiten, weißt du.“
„Welche alten Zeiten?“
„… da gibt es ja diese alte Geschichte, als er eine eigene Firma und den Fiskus um viel Geld betrogen hatte und ins Gefängnis musste, das weißt du ja.“
„Den Fiskus! Was ist das für eine Geschichte?“
„Kennst du die denn nicht? Ich dachte, dass die meisten sie kennen. Vielleicht stimmt sie ja gar nicht. Was weiß ich schon. Vielleicht ist es gar nichts.“
Ulrik Torp wurde neugierig.
„Er hat eine Firma gehabt?“
„Allerdings nur eine kleine. Während des Studiums. Aber nach dem Gerichtsurteil hat er sie zugemacht, glaube ich. Doch das ist ja schon viele Jahre her. Na ja. Das hat heute sicherlich keine Bedeutung mehr.“ Peder Schou war jetzt kurz davor, das Gespräch abzuschließen.
„Vergiss es, Ulrik. Ich hätte es gar nicht erwähnen sollen. Denk dran, dass es morgen um zwölf Uhr ist. Grüß Karen schön, ja?“
„Ja, das mache ich.“
„Das war ein Scheißtag. Gute Nacht.“
„Ja, tschüss“, sagte Torp verwirrt und legte irritiert auf. Er hatte recht.
Es war ein richtiger Scheißtag gewesen.