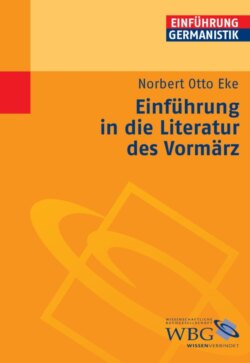Читать книгу Einführung in die Literatur des Vormärz - Norbert Otto Eke - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
1. Zur politisch-historischen Situation
ОглавлениеZeitalter der Revolutionen
Im Rückblick gesehen eröffnete die Revolution in Frankreich (wenn man so will, bereits die amerikanische Unabhängigkeitserklärung von 1776) ein Zeitalter der Revolutionen, das erst im zwanzigsten Jahrhundert zu Ende kommen sollte. 1830, 1848 und 1917 / 18 sind Wegmarken auf der Landkarte der Revolutionen, die Europa von der Wurzel auf umgegraben haben. Für die Zeitgenossen schien dieses Zeitalter der Revolutionen zunächst allerdings, kaum dass es begonnen hatte, gleich auch schon wieder beendet. Mit dem Sturz Robespierres am 9. Thermidor (also dem 27. Juli 1794) kam die jakobinische Gewaltherrschaft, freilich damit auch die revolutionäre Dynamik, zum Erliegen; Napoleon beendete mit dem Staatsstreich vom 18. Brumaire (9. November 1799) die Revolution dann auch ganz formell, ließ sich 1804 zum Kaiser krönen – und überzog Europa mit einem Krieg, der die alte Staatsordnung in sich zusammenbrechen ließ und ihn selbst zum Herrscher über weite Teile des Kontinents erhob. Unter Napoleons Druck traten am 16. Juli 1806 sechzehn Reichsstände aus dem Deutschen Reich aus und bildeten eine Konföderation unter dem Protektorat des französischen Kaisers, den sogenannten „Rheinbund“. Das alte deutsche Reich war damit faktisch zerschlagen, noch bevor Franz II. am 6. August 1806 die Reichskrone niederlegte und damit das Ende des „Heiligen Römischen Reichs deutscher Nation“ auch formell besiegelte. Mit der Niederlage Napoleons in der Völkerschlacht bei Leipzig (16. – 19. Oktober 1813), dem Einzug der Koalitionsmächte in Paris (31. März 1814) und der Abdankung Napoleons am 6. April 1814 war auch diese Ära zu Ende. Napoleons Versuch, im Frühjahr 1815 von Elba aus noch einmal das Ruder herumzureißen, änderte daran nichts mehr; nur hundert Tage währte der Traum der (seiner) Wiederkehr; mit dem Sieg der Preußen und Engländer bei Belle-Alliance (Waterloo) am 18. Juni 1815 hatte er sich schnell wieder erledigt.
Wiener Kongress
Bereits neun Tage zuvor war in Wien eine Friedenskonferenz zu Ende gegangen, auf der seit dem 18. September des Vorjahres mit Ausnahme der Türken Vertreter aller europäischer Staaten über die Neuordnung Deutschlands und Europas verhandelt hatten. Dieser Wiener Kongress setzte 1815 einen Schlussstrich unter die Ära Napoleon und bemühte sich eifrig darum, das Rad der Geschichte zurückzudrehen. ‚Restauration‘ nannten die Zeitgenossen selbst diese neue Epoche, und das war durchaus nicht negativ gemeint, zumindest nicht bei denen, die äußere Ruhe und die Rückkehr zu geordneten Verhältnissen nach der bald drei Jahrzehnte anhaltenden Phase der politischen Gärungen und der Kriege allem anderen vorzogen.
Gründung des „Deutschen Bundes“
Der Wiener Kongress errichtete mit einer politisch-restriktiven Stabilisierungspolitik Schutzwälle gegen alle nationalen, sozialen und intellektuellen Veränderungshoffnungen, die in der Zeit der Befreiungskriege der allgemeinen Mobilmachung gegen den zum Schrecken Europas dämonisierten Kaiser Napoleon noch so dienlich gewesen waren. Er konnte die politische ‚Modernisierung‘ der deutschen Länder damit zwar zumindest vorübergehend eindämmen, nicht aber zur Gänze anhalten, wovon die eruptiven Revolutionsbewegungen der Jahre 1830 und 1848 Zeugnis ablegen. Der Wiener Kongress hatte nach einem Vierteljahrhundert Revolution und Krieg vor der schwierige Aufgabe gestanden, die verschiedenen Interessenlagen der europäischen Staaten in einer Friedensordnung auszubalancieren, die sowohl dem deutschen Föderalismus und damit den Interessenlagen der deutschen Einzelstaaten (50 von den ursprünglich mehr als 300 dieser politischen Einheiten waren nach Napoleons Reformen noch übrig geblieben) gerecht zu werden als auch die jeweiligen Vormachtinteressen Österreichs und Preußens gegeneinander abzugleichen in der Lage sein sollte. Letztendlich schuf der Wiener Friedenskongress unter der Federführung des österreichischen Außenministers Clemens Wenzel Fürst von Metternich mit der Gründung des „Deutschen Bundes“ eine gemeinsame Plattform für die aus den Fugen geratene Staatenlandschaft der deutschsprachigen Länder Mitteleuropas. Artikel 1 der Bundesakte definierte den „Deutschen Bund“, dem schließlich 35 Fürstenstaaten und vier Freie Städte beitraten, als „beständigen“, d.h. unauflösbaren Bund. Als dessen Verfassung galt die am 8. Juni 1815 verabschiedete „Deutsche Bundesakte“ (in der Praxis eher ein ausgestaltungsfähiger Rahmenvertrag als ein Grundgesetz), die der Schlussakte des Wiener Kongresses vom 15. 5. 1820 eingefügt wurde. Mit dem Bundestag, der seit November 1816 in Frankfurt tagte, gab sich der „Deutsche Bund“ ein Beratungs- und Legislativorgan, dessen Vorsitz Österreich innehatte. Diese Bundesversammlung war kein gewähltes Parlament, sondern ein Gesandtenkongress, dem siebzehn weisungsgebundene Delegierte angehörten. Für Verfassungsänderungen und andere Beschlüsse ähnlicher Tragweite war die Erweiterung des Bundestages zu einer Bundesversammlung möglich. Die politisch gestaltende Macht des Bundestags war von vornherein beschränkt, zumal sich der Bund weder eine starke Exekutive noch ein oberstes Bundesgericht als letztentscheidende Instanz gab, auch wenn im Grundsatz das Bundesrecht über dem Landesrecht stand. Zudem erschwerte ein kompliziertes Abstimmungssystem die Durchsetzung politischer Maßnahmen.
Stillstellung der politischen Dynamik
Zwar verschaffte die Eingliederung der Bundesakte in die Wiener Schluss-Akte der Existenz und dem territorialen Bestand aller 39 Einzelstaaten (denen sich wenige Wochen später noch Baden [26. Juli] und Württemberg [1. September] anschlossen) eine völkerrechtliche Garantie; sie zementierte gleichzeitig aber auch den politischen und gesellschaftlichen status quo.
Die Frage der Nation
Weder erfüllten sich mit der Gründung des Deutschen Staatenbundes so die in den Befreiungskriegen bewusst genährten Hoffnungen auf die Schaffung eines deutschen Nationalstaates, und sei es nur in Gestalt eines Bundesstaates mit starker Zentralgewalt und eng begrenzter Autonomie seiner Mitglieder; noch gingen die Mitgliedsstaaten des „Deutschen Bundes“ in ihrer Mehrheit den Weg zum demokratischen (konstitutionellen) Verfassungsstaat, den die Bundesakte mit der im Artikel 13 formulierten Forderung zur Einrichtung einer „landständischen Verfassung“ in „allen Bundesstaaten“ selbst wies.
Ermordung August von Kotzebues
Bayern machte in dieser Hinsicht eine Ausnahme, insoweit es sich 1818 nach englischem Vorbild eine Verfassung mit einem Zweikammernsystem gab; diese räumte den Abgeordneten das Recht der Steuerbewilligung und der Mitwirkung an der Gesetzgebung und an der Schuldenverwaltung des Staates ein, garantierte überdies Gewissens-, Meinungs- und Pressefreiheit sowie gleichen Zugang zu allen staatlichen Ämtern, Gleichheit vor dem Gesetz, hinsichtlich der Wehr- und Steuerpflicht, die Freiheit der Person und des Eigentums sowie die Unparteilichkeit der Rechtspflege. Eine Sonderstellung nahm auch das Großherzogtum Baden ein, das mit seiner am 22. August 1818 in Kraft getretenen Verfassung den Abgeordneten selbst die Möglichkeit zur Kürzung des Militär- und Hofbudgets ermöglichte. Andere Staaten, insbesondere die Großmächte Österreich und Preußen, waren dagegen nicht bereit, diesen Reformweg mitzugehen: Preußen unter Bruch eines von Friedrich Wilhelm III. noch während der letzten Feldzüge im Mai 1815 gegebenen Versprechens (das Verfassungsversprechen des preußischen Königs ist enthalten bereits im Finanzedikt vom 27. 10. 1810; Friedrich Wilhelm III. hat es am 22. 5. 1815 noch einmal ausdrücklich bekräftigt), wenn auch anfänglich in seinen Zielsetzungen noch sehr unentschieden; Österreich unter Metternich dagegen von vornherein mit dem entschiedenen Willen, den Vormarsch des Konstitutionalismus um jeden Preis abzublocken und die zur Mobilisierung im Kampf gegen Napoleon noch dienliche Aussicht auf eine weitreichende Demokratisierung vergessen zu machen. Die Ermordung des russischen Staatsrats und Erfolgsschriftstellers August von Kotzebue durch den Jenaer Theologiestudenten Karl Ludwig Sand im März 1819 gab Metternich die Möglichkeit an die Hand, durch geeignete Maßnahmen das Feuer der in den Befreiungskriegen noch nützlichen, nun aber kaum noch zu kontrollierenden liberalen und nationalen Bewegungen auszutreten, bevor diese gefährlich werden konnten. Metternich selbst spricht in seinen nachgelassenen Papieren ganz offen von der willkommenen Gelegenheit, „den Ultraliberalismus aus[zu]rotten dank dem Beispiele, wie der vortrefliche Sand es mir auf Kosten des armen Kotzebue lieferte“. (Aus Metternich‘s nachgelassenen Papieren 3, 235)
Nationalismus als Emanzipationsideologie
Kotzebue hatte in seinen Schriften die Nachkriegsordnung entscheidend verklärt und war dadurch ins Visier der vom Ergebnis des Wiener Kongresses enttäuschten Opposition geraten, die in den unmittelbaren Nachkriegsjahren den Nationalismus der Befreiungskriege als Emanzipationsideologie aufnahm. Die Verschwommenheit des Nationen-Begriffs, der sowohl als geistige Kulturgemeinschaft wie als völkische Schicksalsgemeinschaft und als politische Gemeinschaft freier Menschen im 19. Jahrhundert Karriere machte, tut der historischen Bedeutung des frühen Nationalismus als integrierender Kraft im Prozess der Herausbildung der bürgerlichen Gesellschaft keinen Abbruch. (Im übrigen bleibt zu beachten, dass ebenso wenig wie von einer einheitlichen liberalen Gegenbewegung zum Metternich’schen System in ganz Deutschland die Rede von einer nur annähernd geschlossen auftretenden Opposition in dieser Zeit sein kann; eine solche konnte sich unter den politischen Bedingungen der Nachkriegsära nicht herausbilden. Opposition im Vormärz erstreckte sich bis in die zwischen konservativer Orthodoxie und innerkirchlichem Liberalismus zerrissenen Kirchen hinein, in denen liberale Gegenströmungen wie die Lichtfreunde [gegründet 1841, 1845 verboten] und die Deutschkatholiken [gegründet 1845] das Staatskirchentum der Amtskirchen in Frage stellten und so von hier aus die Revolution vorbereiteten; vgl. Graf 1978, Pilick 1999.)
Der frühe Nationalismus war „jahrzehntelang eine liberale Oppositions- und Emanzipationsideologie, welche die ständische Ungleichheit, die Vormacht des Adels, den deutschen Spätabsolutismus, den partikularstaatlichen Egoismus überwinden wollte“ (Wehler 21989, 240 f.) – und deshalb von den Konservativen auch als Bedrohung empfunden und energisch bekämpft wurde. Dies nicht zuletzt, weil die zentralstaatlichen Träume der deutschen ‚Patrioten‘ die politische Existenz der einzelnen Gliedstaaten prinzipiell in Frage stellten. Gleiches gilt für die scheinbar nachgeordnete Forderung zur Herausbildung einer nationalen Identität. Auch sie stand quer zu den partikularstaatlichen Interessen, die vom Untertanen ganz selbstverständlich eine jeweilige nationale, besser müsste man hier sagen: regionale oder landsmannschaftlichte Identität verlangten: als Bayer, Preuße, Württemberger usw. Und selbstverständlich rief auch der Traum vom gesamtdeutschen Nationalstaat als Verfassungsstaat die Abwehrkräfte der restaurativen Staaten auf den Plan, die sich zu immunisieren suchten gegen jede Form der Infragestellung des status quo. (Wehler 21989, 396f.)
Trägergruppen des Nationalismus
Trägergruppen dieses Nationalismus waren zum einen die zunächst in Süd- und Mitteldeutschland aufkommenden Männergesangsvereine, die bis 1848 etwa 100 000 Mitglieder zählten (Klenke 1998). Zum anderen zu nennen ist die Turnbewegung, die nach zwischenzeitlichem Verbot in den frühen vierziger Jahren einen zweiten Aufschwung erlebte (was auch damit zusammenhängt, dass Preußen 1842 den Gymnastikunterricht an den höheren Schulen eingeführt und damit das Turnen wieder legalisiert hatte); 1848 zählen die deutschen Turnvereine bereits rund 90 000 Mitglieder, überwiegend junge Männer kleinbürgerlicher Herkunft. Als dritte Trägerschicht erscheint die akademische Jugend, die sich sehr bald nach dem Kriegsende an einzelnen deutschen Universitäten in studentischen Vereinigungen, den sogenannten Burschenschaften, zu organisieren begann. Mit der Tradition der gegen Napoleon gerichteten vaterländischen Vereine überführte sie die seit den Befreiungskriegen nicht erloschenen liberalen und demokratischen Reformerwartungen in die Nachkriegsära (und stieß damit auf große Sympathien bei vielen Professoren). Die Enttäuschung über die politische Entwicklung, die lediglich eine Staatenkonföderation zu Wege gebracht hatte und eben nicht die ersehnte nationale Einheit der Deutschen, markiert die Grunderfahrung der aus den Freikorps und freiwilligen Jäger-Corps in die Hörsäle zurückgekehrten Studenten.
Wartburgfest
Sie führte zu einer von den Obrigkeiten argwöhnisch beobachteten Politisierung, die nach dem 1817 auf der thüringischen Wartburg gefeierten „Nationalfest“ zum Gedenken an die „Wiedergeburt des freien Gedankens und der Befreiung des Vaterlandes“ in Reformation und Völkerschlacht zu massiven Repressionen führte. Das dem Vorbild der revolutionären Volkfeste in Frankreich nachempfundene Studentenfest rief als erste machtvolle öffentliche Demonstration der politischen Opposition umgehend die Obrigkeiten auf den Plan. Preußen erließ eilends ein Verbot der studentischen Verbindungen an allen Universitäten, was allerdings nicht verhindern konnte, dass sich die Burschenschaften bereits in der zweiten Hälfte der zwanziger Jahre wieder zu reorganisieren begannen. Nach einem erneuten Verbot in den dreißiger Jahren fanden sie im darauffolgenden Jahrzehnt in der sogenannten „Progreß“-Bewegung eine neue Basis und in der liberalen Presse ein Ausdrucksmedium, kamen schließlich sogar mit eigenen Zeitschriftengründungen auf den Markt („Zeitschrift für Deutschlands Hochschulen“ [1844 – 45], „Akademische Zeitschrift“ [1845 – 1846]). Das in seiner Bedeutung für sich genommen eher nachrangige Attentat auf den Schriftsteller – und vor allem hohen Beamten eines der drei Mitgliedsstaaten der aus Preußen, Österreich, Russland bestehenden „Heiligen Allianz“ – Kotzebue, dessen „Geschichte des deutschen Reiches“ neben Schriften beispielsweise des preußischen Staatsrats Johann Peter Friedrich von Ancillon („Souveränität und Staatsverfassung“), des Direktors des preußischen Polizeiministeriums Karl Albert Christoph Heinrich von Kamptz (Codex der Gensdarmerie) und des Staatstheoretikers Karl Ludwig von Haller („Restauration der Staatswissenschaft“) auf dem Wartburgfest bereits von Anhängern Jahns dem Scheiterhaufen übergeben worden waren, sowie ein gescheitertes Attentat auf den nassauischen Minister Carl von Ibell am 1. Juli desselben Jahren taten ein übriges, um die teils berechtigte, teils von interessierten Kreisen gezielt geschürte Revolutionsfurcht weiter anzufachen.
Karlsbader Beschlüsse
In diesem Klima versammelte Metternich am 6. August 1819 Minister der zehn größten deutschen Bundesstaaten (Österreich, Preußen, Hannover, Sachsen, die beiden Mecklenburg, Nassau, Bayern, Baden, Württemberg) zu einer Geheimkonferenz in Karlsbad. Im Ergebnis ausführlicher Beratungen einigte man sich auf dieser am 31. August beendeten Konferenz auf ein Bündel von Bundesgesetzesvorlagen, die darauf abzielten, die öffentliche Meinung zum Schweigen zu bringen und durch die Kriminalisierung des Gedankenaustauschs jede Gruppenbildung bereits im Ansatz unmöglich zu machen. Kernstück dieser Absprachen, die am 20. September 1819 durch die Frankfurter Bundesversammlung zu geltendem Bundesrecht erklärt wurden, waren neben der strengen Beaufsichtigung der Universitäten und der Einrichtung einer außerordentlichen Bundes-„Central-Untersuchungs-Commission“ zur Ausspürung der „revolutionären Umtriebe und demagogischen Verbindungen“ mit Sitz in Mainz, die Einführung einer strengen Zensurpolitik, die unter anderem die Einführung einer präventiven Zensur für Zeitungen und Zeitschriften sowie aller weiteren Druckschriften mit einem Umfang von weniger als 20 Bogen (320 Seiten) vorsah. Umfangreichere Schriften, von denen man etwas unbedarft annahm, dass sie aufgrund ihres hohen Preises und ihres Umfangs sowieso wohl kein größeres Publikum würden erreichen können, waren von dieser Vorzensur ausgenommen, unterlagen allerdings der Nachzensur. Flankierende Zensurmaßnahmen der einzelnen Staaten engten den Spielraum von Verlegern und Redakteuren weiter ein. Die preußische Regierung beispielsweise behielt sich ein Vetorecht bei der Besetzung von Redakteursstellen vor (vgl. Huber, Dokumente zur deutschen Verfassungsgeschichte, S. 107). Ganz allgemein belegte das Bundes-Preßgesetz Redakteure einer verbotenen Zeitschrift für fünf Jahre mit einem Berufsverbot; „binnen fünf Jahren“ so lautet der entsprechende Paragraph im Bundes-Preßgesetz, dürften solche Redakteure „in keinem Bundesstaate bei der Redaction einer ähnlichen Zeitschrift zugelassen werden“ (§ 7). Abgesehen von punktuellen und allein vorübergehenden Auflockerungen blieben diese Zensurregeln innerhalb des Deutschen Bundes dem Grunde nach bis zum März 1848 gültig.
Die politische Situation nach den Karlsbader Beschlüssen von 1819 war dem Aufbau eines freien Publikationswesens alles andere als förderlich. Hatten die veralteten und uneinheitlichen Zensurgesetze in den deutschen Ländern Publizisten und Schriftstellern in der kurzen Zeitspanne nach dem Ende der Napoleonischen Besetzung zumindest in einigen Ländern (Holstein, Sachsen-Weimar-Eisenach, Hessen, Baden, Nassau, Württemberg) für einige Jahre eine relative Freiheit der Meinungsäußerung ermöglicht, beendete die strafbewehrte Einführung der Zensur eine kurze Blütezeit der Zeitschriftenliteratur, in der immerhin so bedeutende Zeitschriften wie Josef Görres’ „Rheinischer Merkur“ (1814 / 15), Heinrich Ludens „Nemesis“ (1814 – 1818) und Johann Baptist von Pfeilschifters „Zeitschwingen“ (1817 – 1819) hatten erscheinen können.
Kampf gegen die Zensur
Die Arbeit des Mainzer Informationsbüros und vor allem die geheimen Wiener Beschlüsse zur Überwachung und Steuerung des Pressewesens konnten der Verbreitung oppositioneller Zeitungen wie beispielsweise der „Zeitschwingen“ Ludwig Börnes (1819), der „Kieler Blätter“ Friedrich Christoph Dahlmanns oder des „Teutschen Beobachters“ Samuel Gottlieb Lieschings vorübergehend Einhalt gebieten. Sie konnte die Expansion des Zeitungsmarktes behindern. Langfristig verhindern allerdings konnten sie all dies nicht. Das Netz der Zensur blieb im übrigen auch als solches löchrig und bot immer wieder Möglichkeiten, durch seine Maschen zu schlüpfen, wovon die Autoren des Vormärz auch reichlich Gebrauch zu machen verstanden. Eine Möglichkeit der Zensur zu entgehen, war so die Verlegung des Druckortes einer Zeitschrift, eine andere, die Zeitschrift unter einem anderen Namen weiterzuführen. Druckorte konnten fingiert, Urheberschaften durch Pseudonyme oder Anonyme verschleiert werden. Mit Hilfe besonderer Druck- und Kompositionstechniken wurde des weiteren immer wieder die Grenze von zwanzig Bogen überschritten; zugleich wurde mit Hilfe versteckter Kritik, mit Anspielungen, mit Hilfe der Tarnung von Gesellschaftsanalysen als Reiseberichten und Ähnlichem die Zensur getäuscht: der dritte und der vierte Teil von Börnes „Briefen aus Paris“ beispielsweise erschienen 1833 als 11. und 12. Teil seiner „Gesammelten Schriften“ unter dem Titel „Mitteilungen aus dem Gebiet der Länder- und Völkerkunde“ mit dem fingierten Verlagssignet „Offenbach. Bei L. Brunet“. Zu den beliebten Mitteln im Kampf gegen die Zensur gehörte neben der Camouflage die Offenlegung der Zensureingriffe für den Leser durch die druckgraphische Markierung zensierter Stellen (Leerstellen, Gedankenstriche etc.). Heine hat dies in „Ideen. Das Buch Le Grand“ (Reisebilder. Zweyter Theil, 1826) in satirischer Weise zugespitzt, indem er im XII. Kapitel außer den Zensurstrichen nur die folgenden sprechenden Worte stehen ließ: „Die deutschen Censoren - - - - - Dummköpfe - - - -.“ (DHA VI, 201)
Publizistik und Zensur
Die Wiener Ministerialkonferenz vom Juni 1834 hat solche Methoden der Zensursatire zwar ausdrücklich verboten, ihre weitere Verwendung aber nicht abstellen können, wie das Beispiel der von Heinrich Laube (1833 / 34 und 1842 – 1844) und Gustav Kühne (von 1835 – 1842) herausgegebenen „Zeitung für die elegante Welt“ zeigt, obwohl gerade die Möglichkeiten der Zeitungen und Zeitschriften, die Zensur zu unterlaufen bei weitem eingeschränkter waren als dies bei Büchern der Fall war. Die meisten oppositionellen Zeitungen bestanden aus diesem Grund auch nur jeweils für kurze Zeit, beispielsweise die „Deutsche Tribüne“ 1831, „Das Westphälische Dampfboot“ von 1845 – 1848 oder „Der Gesellschaftsspiegel“ von 1845 / 46. Nicht viel besser erging es den literarischen Zeitungen, den eigentlichen Multiplikationsmedien der bürgerlich-progressiven Literatur. Zu der (geringeren) Zahl der etwas langlebigeren Zeitschriften dieser Art gehören: „Europa. Chronik der gebildeten Welt“ (1835 – 1885); „Telegraph für Deutschland“ (1838 – 1848). Zu der Mehrzahl der kurzlebigen Theodor Mundts „Literarischer Zodiacus für Zeit und Leben, Wissenschaft und Kunst“ (1835 – 1836), „Dioskuren. Für Wissenschaft und Kunst“ (1836 – 1837), „Der Freihafen. Galerie von Unterhaltungsbildern aus den Kreisen der Literatur, Gesellschaft und Wissenschaft“ (1838 – 1842).
Theaterverhältnisse im Vormärz
Erheblich eingeschränkt in seiner Präsenz und Wirkung wird durch die Zensur vor allem auch das Theater, das als öffentliches Kommunikationsereignis seit dem 18. Jahrhundert (Französische Revolution) ohnedies einem ständigen Misstrauensvorbehalt ausgesetzt war (Eke 1997, 23 ff.). Die Überwachungsmaßnahmen verschärfen auf diese Weise den ökonomischen Druck, dem insbesondere die im Vormärz in großer Zahl als (in der Regel) Aktiengesellschaften gegründeten städtischen Theater unterlagen, während den Hof- und Residenztheatern (Berlin, Kassel, Darmstadt, Dresden, Hannover, Karlsruhe, Schwerin, Stuttgart, Weimar, München, Wien, Braunschweig, Coburg/Gotha, Dessau, Detmold, Oldenburg, Neustrelitz, Meiningen, Wiesbaden) hinsichtlich ihrer künstlerischen Entfaltung von anderer Seite Grenzen gesetzt waren, insofern sie primär der Außendarstellung des Souveräns dienten (vgl. Daniel 1995, Zielske 2002). Beides führte dazu, dass von den Bühnen kaum innovative ästhetische Impulse ausgingen, die Dramatiker vielmehr zu großen Zugeständnissen an den Geschmack und an die politischen Gegebenheiten gezwungen waren (Porrmann/Vaßen 2002). Faktisch war das Theater unter den gegebenen gesellschaftlichen Bedingungen damit auf den Unterhaltungsaspekt beschränkt (vgl. Kortländer 2002, 199f.), konzentrierte sich dementsprechend auf Zerstreuendes (Oper, Singspiel, Ballett) und vor allem auf die verschiedenen Ausprägungen des bürgerlichen Lachtheaters (Volksstück, Komödie, Posse, Schwank, Vaudeville) sowie auf Melodramen und Schauerstücke. Einerseits stagnierten die realen Theaterverhältnisse im Vormärz so künstlerisch gleichermaßen unter der Last der Tradition wie den Fesseln der Zensur und hat das Theater als Institution im Unterschied zu seiner kulturellen Anerkennung so auch „kaum gesellschaftliche Relevanz“ (Porrmann/Vaßen 2002, 15) – ungeachtet im Übrigen des Umstands, dass auch das Unterhaltungstheater im Einzelfall zeitbezogen-kritisch agieren konnte (Bayerdörfer 2002). Andererseits allerdings entsteht jenseits der Bühnen, die sie nicht erreicht, mit Werken Grabbes und Büchners gerade im Vormärz auch eine innovative, auf die Moderne vorausweisende Dramatik, unterstützen dialogisch-dramatische Kurz-Formen wie etwa im Falle Adolf Glaßbrenners in publikumswirksamer Weise den kritischen Impetus satirischer Texte, stoßen eine florierende Theaterkritik und eine bald breit ausdifferenzierte Theater-Publizistik auf breite Resonanz („Allgemeine Theaterchronik“, 1832 – 1873; „Der (wohlunterrichtete) Theaterfreund“, 1830, 1848; „Allgemeines Theater-Lexicon“, 1839 – 1843; „Theater-Lexikon. Theoretisch-praktisches Handbuch für Vorstände, Mitglieder und Freunde des deutschen Theaters“, 1841).
Theater als Ersatzöffentlichkeit
In welchem Maße dabei gerade der Bühne und der Theaterpublizistik allen objektiven Behinderungen zum Trotz subjektiv die Funktion einer politischen Ersatzöffentlichkeit zuwächst, lässt sich an der Einführung des 1846 in neuer Auflage erscheinenden „Allgemeinen Theater-Lexikons“ ablesen, in der es heißt: „Die Bühne ist für uns Deutsche außer der Kirche fast die einzige Stätte der Öffentlichkeit. In ihrer Beachtung und Anerkennung vereinigen sich alle Stämme, Staaten und Provinzen des deutschen Volkes, sie ist der Mittelpunkt der intellectuellen und geselligen Einheit Deutschlands, ein die Zeitblätter und Conversation stets rege und lebendig erhaltender, nie sich erschöpfender oder alternder Stoff, und demnach ein unabweisbarer Aggregat des gesellschaftlichen Lebens.“ (Allgemeines Theater-Lexikon oder Encyklopädie alles Wissenswerthen für Bühnenkünstler, Dilettanten und Theaterfreunde. Hrsg. von Robert Blum, Karl Herloßsohn und Hermann Marggraff. Bd. 1. Neue Auflage. Altenburg, Leipzig 1846, S. III) Heinrich Heines Spott über den Surrogatcharakter des Theaterwesens aus dem Jahre 1835 relativiert dies dann allerdings wieder etwas: „Wir, die wir fast gar keine raisonnirende politische Journale besaßen, waren immer desto gesegneter mit einer Unzahl ästhetischer Blätter, die nichts als müßige Mährchen und Theaterkritiken enthielten: so daß, wer unsere Blätter sah, beinahe glauben musste, das ganze deutsche Volk bestände aus lauter schwatzenden Ammen und Theaterrezensenten. Aber man hätte uns doch Unrecht gethan. Wie wenig solches klägliche Geschreibsel uns genügte, zeigte sich nach der Juliusrevoluzion, als es den Anschein gewann, daß ein freyes Wort auch in unserem theuren Vaterland gesprochen werden dürfe. […] In der That, wenn in Deutschland die Revoluzion ausbrach, so hatte es ein Ende mit Theater und Theaterkritik, und die erschreckten Novellendichter, Comödianten und Theaterrezensenten fürchteten mit Recht: ‚daß die Kunst zu Grunde ginge.‘“ (DHA VIII, 178f.)
Festschreibung des „monarchischen Prinzips“
Zwar setzen die einzelnen Bundesstaaten die in Karlsbad verabschiedeten Repressionsgesetze in unterschiedlicher Weise um – Bayern, Württemberg und Sachsen-Weimar eher laxer, Baden, Nassau und Preußen beispielsweise in noch verschärfterer Form –, im Ergebnis aber markierten sie im ganzen Bund den Startschuß für die sogenannten Demagogenverfolgungen, mit denen das politische Leben zunächst eingefroren und die publizistische Öffentlichkeit einer scharfen Kontrolle unterworfen wurde. Das Denunziantentum blühte; missliebige Professoren wurden gleich reihenweise von den Hochschulen entfernt (Fries und Oken in Jena, de Wette in Berlin, Arndt in Bonn usw.), die Universitäten insgesamt wurden unter Kuratel gestellt, Burschenschaftler in Gefängnis- oder Festungshaft genommen; die Literatur selbst stand seitdem erst einmal unter dem Generalverdacht, den Aufruhr zu schüren.
Mit der Wiener Ministerialkonferenz, die vom 25. November 1819 bis zum 20. Mai 1820 dauerte, erreichte Metternich überdies vorübergehend auch sein Hauptziel: die verbindliche Festschreibung des „monarchischen Prinzips“. Es ist Bestandteil der am 15. Mai 1820 von der Ministerialkonferenz verabschiedeten „Bundes-Supplementar-Akte“, die am 8. Juli vom Frankfurter „Plenum“ zu einem „Grundvertrag“ des Deutschen Bundes erklärt wurde. Zwar gewährte Artikel 56 der neuen Wiener Schlussakte den bestehenden konstitutionellen Verfassungen eine Bestandsgarantie, mit dem Artikel 57 aber wurde das traditionelle Souveränitätsprinzip des Fürsten für sakrosankt erklärt. Dieser Artikel definiert das „monarchische Prinzip“ als Vereinigung der „gesamten Staatsgewalt in dem Oberhaupte des Staats“; „nur in der Ausübung bestimmter Rechte“ könne der „Souverän durch eine landständische Verfassung […] an die Mitwirkung der Stände gebunden werden“.
Auswirkungen der Julirevolution
So gelang es Metternich das öffentliche politische Leben bis 1830 weitgehend lahmzulegen und die liberalen und nationalen Bewegungskräfte unter Kontrolle zu halten. Der Ausbruch der gegen die bourbonische Restauration gerichteten Julirevolution in Paris (27. bis 29. Juli 1830), die Karl X. zum Thronverzicht zwang und zur Thronbesteigung des Herzogs von Orléans als ‚Bürgerkönig‘ Louis-Philippe I. führte, setzte der relativen Ruhe des staats- und sozialkonservativen Restaurationsjahrzehnts allerdings ein abruptes Ende. Die Ereignisse in Frankreich, ausgelöst durch den Versuch Karls X., mit den Ordonanzen vom 25. Juli die Pressefreiheit einzuschränken, die Abgeordnetenkammer aufzulösen und das Wahlrecht zu ändern, zogen eine Kettenreaktion in ganz Europa nach sich. Auch in einer ganzen Reihe deutscher Klein- und Mittelstaaten (Braunschweig, Kurhessen, Sachsen, Hannover) kam es – flankiert durch Forderungen nach Pressfreiheit, Verfassungen und Nationalstaatlichkeit in den nun in großer Zahl neu gegründeten Zeitungen und Zeitschriften – zu offenem Aufruhr und zu verschärften Verfassungskämpfen. Hinzu kamen eine Reihe städtischer Revolten, z. B. in Göttingen, Köln, Elberfeld, Jülich, Frankfurt, München, Wien und Prag. Was jetzt begann, nennt der Historiker Hans-Ulrich Wehler eine „klassische Inkubationsperiode“, eine „Zeit des Übergangs“ mit „stetig anwachsenden Spannungen zwischen alten Strukturen und neuen Kräften, ‚eine Schwelle zur Moderne‘ schließlich, die in das Vorfeld der politischen Revolution von 1848, aber auch der deutschen industriellen Revolution hineinführt.“ (Wehler 21989, 346)
Die meisten deutschen Intellektuellen feierten die Julirevolution, die den Konstitutionalismus stärkte und eine Erweiterung des Wahlrechts und der Befugnisse der Parlamentskammern erstritt, als Zeichen des Aufbruchs aus den erstarrten Verhältnissen. Heines Bemerkung aus der Börne-Denkschrift über die „Juliusrevoluzion, welche unsere Zeit gleichsam in zwey Hälften auseinander sprengte“ (DHA XI, 56), vermittelt ebenso einen Eindruck von dieser Aufbruchstimmung wie das liberale Freiheitspathos, das – ein zweites Beispiel – Anastasius Grüns „Spaziergänge eines Wiener Poeten“ trägt, die 1831 anonym erschienen.
Hambacher Fest
Im Zusammenhang mit diesem Erstarken des politischen Protests nach der Julirevolution steht das „Nationalfest der Deutschen“, zu dem sich zwischen dem 27. und dem 30. Mai 1832 ca. 20 000 bis 30 000 Anhänger der radikal-liberalen Opposition in der Ruine des Hambacher Schlosses in der bayerischen Pfalz bei Neustadt an der Haardt versammelten. Die Resonanz auf das Hambacher Fest, das im Unterschied zum Wartburgfest von 1817 nicht mehr als allein nationales Ereignis begangen, sondern vielmehr bereits „im Bewußtsein einer europäischen Solidarität aller antifeudalen Kräfte abgehalten“ wurde (Labuhn 1980, 91), war nicht nur in der liberalen Öffentlichkeit groß. Die dort in Reden und Grußworten erhobenen Forderungen zur Einrichtung eines freiheitlichen deutschen Einheitsstaates, nach Republik und Demokratie sowie eines konföderierten republikanischen Europa rief umgehend auch die Münchner Zentralregierung auf den Plan, die eilends über die Pfalz den Belagerungszustand verhängte und die Initiatoren des Festes (darunter Jacob Siebenpfeiffer und Johann Georg August Wirth) verhaften ließ.
Einschränkung der politischen Öffentlichkeit
Mit den am 28. Juni 1832 durch den Bundestag verabschiedeten „6 Artikeln“ zur „Aufrechterhaltung der gesetzlichen Ordnung“ und den in die gleiche Richtung zielenden „10 Artikeln“ vom 5. Juli 1832 wurden die Versammlungsfreiheit nahezu völlig eingeschränkt, das Petitionsrecht und das Budgetrecht, die Rede- und Berichtsfreiheit der landständischen Versammlungen beschränkt sowie eine Bundeskommission zur Überwachung der Landtage eingerichtet; das Zensurwesen wurde noch einmal verschärft. Als am 3. April 1833 eine Gruppe unter anderem ehemaliger Mitglieder des „Vaterlandsvereins zur Unterstützung der freien Presse“ die Frankfurter Hauptwache stürmte, bot diese missglückte Aktion den willkommenen Anlass zur Einrichtung einer mit umfangreichen Vollmachten ausgestatteten „Bundes-Zentralbehörde“, die bis zu ihrer Auflösung 1842 dann auch Ermittlungsverfahren gegen mehr als 2000 Personen führte. Den Höhepunkt der Repressionsmaßnahmen stellt das Schlussprotokoll der Wiener Geheimkonferenz dar, die zwischen Januar und Juli 1834 mit den Bevollmächtigten der im engeren Rat des Bundestags vertretenen Staaten stattfand. Die im Rahmen dieser Geheimkonferenz am 12. Juni 1834 verabschiedeten, aus Angst vor Protesten aber bis 1843 geheimgehaltenen 60 Artikel zielten ab auf die totale Kontrolle der politischen Öffentlichkeit, insbesondere der Universitäten.
Opposition und Exil
Zwar gelingt mit der Durchsetzung dieser Beschlüsse vorübergehend noch einmal die Stabilisierung des durch die Ereignisse in Frankreich bereits empfindlich getroffenen ‚Systems Metternich‘. Weder aber lässt sich mit den neuen Repressionsmaßnahmen wie noch in der „Syrupszeit“ (Grabbe, HKA V, 318; Brief an den Kritiker Wolfgang Menzel vom 15. 1. 1831) der zwanziger Jahre das politische Leben nachhaltig einfrieren noch die schnelle Reorganisation der Opposition, geschweige denn die Fortführung der politischen Arbeit durch die zahlreichen vor den Nachstellungen des Metternich’schen Unterdrückungsapparats ins Ausland geflüchteten Intellektuellen (u.a. Börne, Heine, Büchner, Wirth, Venedey, Herwegh, Ruge, Weitling) verhindern – schon gar nicht der Re-Import oppositionellen Gedankenguts nach Deutschland. Vor allem im französischen Exil, in Paris, sowie in der Schweiz, Belgien, später auch in London fand sich die Opposition in Vereinigungen zusammen, die auf teils legalem Weg, teils aber auch mit Hilfe illegal eingeschmuggelter Konterbande aus dem Exil heraus nach Deutschland hineinzuwirken suchten.
Hier im Ausland finden sich auch die Anfänge der deutschen Arbeiterbewegung; hier entstand mit dem um 1832 von Kaufmannsgehilfen, Handwerksgesellen und emigrierten Intellektuellen in Paris gegründeten „Deutschen Volksverein“ die Keimzelle der kommunistischen Bewegung („Bund der Geächteten“, gegründet 1834 – „Bund der Gerechten“, gegründet im Winter 1836 / 37 aus dem ersten heraus und 1847 aufgegangen im „Bund der Kommunisten“); hier entwickelte Marx in den vierziger Jahren aus der Philosophie Hegels heraus seine Geschichtsphilosophie, hier entsteht im Auftrag des „Bundes der Kommunisten“ im Winter 1847 / 48 in Zusammenarbeit von Marx und dem Elberfelder Fabrikantensohn Friedrich Engels das „Kommunistische Manifest“, das mit seinen Ideen vom Ende der Ausbeutung, des Privateigentums und der Aufhebung der politischen Gewalt des Staates in einer klassenlosen Gesellschaft im Verlauf des 19. Jahrhunderts seine Wirkung entfalten sollte. (Vgl. dazu im einzelnen Kap. V, 6.)
Gottschalls Drama „Die Marseillaise“
In welchem Maße von der Julirevolution identifikatorische und integrierende Momente für die bürgerlich-oppositionelle Literatur der dreißiger und vierziger Jahre ausgingen, lässt sich noch an Rudolf Gottschalls Drama „Die Marseillaise“ (Uraufführung 1849 in Hamburg) ablesen, das – getragen von der Aufbruchstimmung der späteren Märzrevolution – Geschichte im rückwärtigen Brückenschlag zwischen der Französischen Revolution von 1789, der Julirevolution von 1830 und (als gedachtem Fluchtpunkt) der Märzrevolution von 1848 als Stafette konstruiert. Auf der Vorgangsebene rückt „Die Marseillaise“ dabei mit der Huldigung des in Not und Elend kümmerlich vegetierenden Schöpfers der Revolutionshymne Rouget de Lisle durch das im Juli 1830 im Geist des Fortschritts wiedergeborene Frankreich einen Vorgang der Sinngenerierung in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit, der sich unmittelbar auf die frühe, gemäßigte Phase der Französischen Revolution bezieht. Das Frankreich des 1830 auf den Thron gelangten Bürgerkönigs Louis Philippe wird im Stück vertreten so durch den General Lafayette (auch das ein Stück historischer Kontinuitätsbildung), den legendären Veteranen des amerikanischen Unabhängigkeitskriegs und der Konstituante. Lafayette hatte sich von der Revolution abgewandt, nachdem sich seine Vorstellungen von der Interessenvermittlung zwischen reformwilligem Adel und Großbürgertum in einer der englischen Staatsform angepassten Monarchie nicht hatten verwirklichen lassen. Gegner des Konsulats auf Lebenszeit und im Zuge der Julirevolution als Kommandeur der Nationalgarde reaktiviert, betritt Lafayette in Gottschalls Stück die Bühne der Geschichte als Repräsentant der Partei des in den Barrikadenkämpfen siegreichen Großbürgertums. Aus der Hand Lafayettes lässt das Frankreich des ‚Bürgerkönigs‘ dem nicht nur von den Gespenstern seiner revolutionären Vergangenheit, sondern auch von den Organen der bourbonischen Restauration verfolgten Dichter die politische und historische Rechtfertigung seines von Entbehrungen geprägten Lebens zuteil werden. Ausgezeichnet und zum Offizier der Ehrenlegion ernannt, gekrönt mit einem Ehrenkranz, stirbt der „Sänger der Freiheit“ am Ende des Stückes im Angesicht der Vertreter der erneuerten französischen Nation (ein Kunstgriff, ist doch der historische Claude Joseph Rouget de Lisle erst 1836 gestorben). Die Julirevolution, mit der die ursprünglich in die ‚große Revolution‘ gesetzten Freiheitshoffnungen nun in vorbildlicher Weise zu sich kommen, versöhnt den alten Revolutionär mit der Geschichte und nimmt ihm die wie ein Alp auf ihm lastende Verantwortung für die von den emphatischen Versen seines Revolutionsliedes skandierten Schrecken der Revolutionszeit von der Brust: „Die neue Freiheit löst die alte Schuld.“ (Gottschall 1849, 40)
Ausdifferenzierung des Liberalismus
Eine bedeutende Rolle innerhalb des durch die Julirevolution erneut in Bewegung geratenen Politisierungsprozesses spielte der Liberalismus, der sich in den dreißiger Jahren zunehmend in radikalere Spielarten ausdifferenzierte. Dem auf Kompromiss und Versöhnung aufbauenden bürokratischen Liberalismus eines Heinrich von Gagern, Karl Friedrich Ibell oder Anselm von Feuerbach, der vor allem in den ersten beiden Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts für eine moderne Staatsbürgergesellschaft auf der Grundlage von Marktwirtschaft und Rechtstaatlichkeit kämpfte, und dem für eine konstitutionelle Monarchie mit juristischer Ministerverantwortlichkeit eintretenden konstitutionellen Liberalismus eines Carl von Rotteck, Carl Theodor Welcker oder Friedrich Christoph Dahlmann, der sich insbesondere in den dreißiger und vierziger Jahren zu einer breit verzweigten politischen Richtung ausweitete, traten nun zunehmend radikaldemokratische Strömungen an die Seite, welche die Emanzipation unterschiedslos aller Bürger, Volkssouveränität und demokratische Mehrheitsherrschaft auf ihre Fahnen geschrieben hatten. Zwar verstanden sich die Liberalen gleich welcher Strömung seit jeher als Avantgarde des Fortschritts und Gegenpart auch zum Konservativismus etwa eines Friedrich Julius Stahl, der sich bereits im 18.Jahrhundert aus einer Abwehrhaltung gegen Aufklärung (bzw. ihre politisch praktizierte Variante) und Rationalismus herausgebildet hatte und mit dem steten Anwachsen der demokratischen Bewegung in einer explizit konservativen Tendenzliteratur (Moritz Graf von Strachnitz, Victor von Strauß und Torney, Johann Christian Freiherr von Zedlitz) ein Ausdrucksmedium fand (Schieder 1983). Mit dem bürokratischen und konstitutionellen Liberalismus alter Prägung allerdings, der auf die Reformfähigkeit des absolutistischen Staates setzte, hatte diese radikaldemokratische Spielart des Liberalismus kaum mehr Gemeinsamkeiten. Arnold Ruge, einer der an Hegels Dialektik geschulten ‚Links‘-Intellektuellen unter diesen Radikaldemokraten, die sich selbst als Vortrupp einer weltumspannenden Kritik verstanden und alles einer radikalen und rigorosen Verstandeskritik unterwarfen (siehe auch u. a. Bruno und Edgar Bauer, Theodor Echtermeyer, Friedrich Koeppen, Karl Marx, Friedrich Engels; auf der eher populistischen Seite u. a. Gustav Struve, Friedrich Hecker, Lorenz Brentano, Robert Blum, Heinrich Simon), verspottet den Liberalismus gleich als solchen so als bloß „alternativ nachhinkenden Entwurf einer staatlichen Ordnung, der sich stets an den wahren Machtpositionen zu orientieren hatte“ (Labuhn 1980, 86), als „die gute Meinung“, als „guten Willen zur Freiheit, aber nicht den wirklichen Willen der Freiheit“ (Arnold Ruge: Eine Selbstkritik des Liberalismus. In: Deutsche Jahrbücher für Wissenschaft und Kunst, Nr. 1 – 3 vom 2. – 4. 1. 1843, S. 4): „Genau zu der Zeit, als die Realisirung der Demokratie in Deutschland durch den deutschen Bund unmöglich geworden war, entstand der Liberalismus, d. h. auf Deutsch die gute Meinung, die frommen Wünsche für die Freiheit, die ‚Freisinnigkeit‘ oder die Sympathien mit der Demokratie – ‚in der Gesinnung‘. […] Diese ‚gute Gesinnung‘ hat eine solche Unbestimmtheit und Weite, daß alles Mögliche hineingeht, jeder Gott und jeder Staat.“ (Ebd., S. 3) Und er kommt zu dem Schluss: „Die deutsche Welt, um ihre Gegenwart dem Tode zu entreißen und ihre Zukunft zu sichern, braucht nichts, als das neue Bewußtsein, welches in allen Sphären den freien Menschen zum Princip und das Volk zum Zweck erhebt, mit Einem Wort die Auflösung des Liberalismus in Demokratismus.“ (Ebd., Nr. 3, S. 12)
Aufschwung der politischen Lyrik
Die hier sich abzeichnende Radikalisierung innerhalb der Oppositionsbewegung findet ein Gegenstück in der Literatur, deren Erscheinungsbild in den vierziger Jahren dominiert wird von der Popularität einer politischen und agitatorischen Lyrik. Hoffmann von Fallerslebens „Unpolitische Liedern“, Franz Dingelstedts „Lieder eines kosmopolitischen Nachtwächters“, Georg Herweghs „Gedichte eines Lebendigen“, Wilhelm Weitlings „Kerkerpoesien“ oder Friedrich von Sallets „Gedichte“ (1843) demonstrieren, wie sich der Widerstand engagierter Literatur gegenüber zentralen Einrichtungen der Gesellschaft im Unterschied zu den dreißiger Jahren – im Falle Sallets beispielsweise die als Reformprogramm am Christentum formulierte Forderung zu einem grundlegenden sozialen Wandel (vgl. „Laien-Evangelium“, 1842; „Die Atheisten und die Gottlosen unserer Zeit“, 1844) – nun explizit politisch ausspricht und damit, nicht zuletzt aufgrund ihrer Annäherung an liedhafte und appellative Strukturen, eine Breitenwirkung erreicht, die der engagierten Literatur der dreißiger Jahre noch verwehrt geblieben war (vgl. dazu ausführlich Kap. IV).
Nationalismus als Massenphänomen
Noch weniger als die liberale Literatur, die durch die Karlsbader Beschlüsse an die Kette staatlicher Überwachung gelegt werden sollte, dennoch aber in einem beständigen Grabenkampf mit der Zensur ihren Spielraum und ihren Einfluss erweitern konnte, war der Nationalismus als „liberale Oppositions- und Emanzipationsideologie“ (Wehler 21989, 240, s. o.) durch Verfolgung und Einschüchterung aus der Welt zu schaffen. Was in den Jahren der Revolutionskriege und des antinapoleonischen Befreiungskampfes in einigen elitären Intellektuellenzirkeln begonnen hatte, entwickelte sich in den wenigen Jahren bis zur Revolution von 1848 so zu einem Massenphänomen auf breiter sozialer Basis, das sich einerseits in Gestalt eines deutschen Kulturnationalismus ein Ventil schuf (beispielsweise mit den großen Festen zum Gedenken an die Erfindung des Buchdrucks, 1840, des 300. Todestags Luthers, 1846, oder der Gründung des Gustav-Adolf-Vereins, 1842).
Ersatzrevolutionen
War es auf der anderen Seite in den zwanziger Jahren der Aufstand der Griechen gegen die türkische Besatzungsmacht gewesen, der zu einem vielfach, in Form von Aufrufen, Petitionen und Flugschriften sowie der Gründung zahlreicher Griechenvereine dokumentierten Philhellenismus in ganz Deutschland führte, so ist es in den dreißiger Jahren der von Wirtschaftskrisen und politisch-religiösen Verfolgungen angetriebene polnische Adelsaufstand vom November 1830 gegen die russische Fremdherrschaft, der diese Funktion einer ‚Ersatzrevolution‘ annahm. Die deutsche Polenbegeisterung, durchaus zwiespältig in ihrer politischen Ausrichtung im übrigen (vgl. Wehler 21989, 397 f.), reflektiert das Identifikationspotential eines ‚auswärts‘ geführten Freiheitskampfes für nationalstaatliche Unabhängigkeit, dessen Protagonisten wie Volkshelden gefeiert und nach dem Scheitern des Aufstands zutiefst bedauert wurden. Nikolaus Lenaus Gedicht „Am Jahrstag der unglücklichen Polenrevolution“ („An die Heidelberger Burschen“), geschrieben 1831, im Rückblick also auf die Niederlage der Aufständischen, das im Januar 1832 sofort in einem nicht autorisierten Druck in der politischen Zeitschrift „Der Hochwächter“ erscheint, dokumentiert in exemplarischer Weise diesen Projektionscharakter der Griechen- und Polenliteratur:
Am Jahrstag der unglücklichen Polenrevolution
Uns’re Gläser klingen hell,
Freudig singen uns’re Lieder;
Draußen schlägt der Nachtgesell
Sturm sein brausendes Gefieder,
Draußen hat die rauhe Zeit
Uns’rer Schenke Thür verschneit.
Haut die Gläser an den Tisch!
Brüder! mit den rauhen Sohlen
Tanzt nun auch der Winter frisch
Auf den Gräber edler Polen,
Wo, verscharrt in Eis und Frost,
Liegt der Menschheit letzter Trost!
Um die Heldenleichen dort
Rauft der Schnee sich mit den Raben,
Will vom Tageslichte fort
Tief die Schmach der Welt begraben.
Wohl die Leichen hüllt der Schnee,
Nicht das ungeheure Weh. –
Wenn die Lerche wieder singt
Im verwaisten Trauerthale,
Wenn der Rose Knospe springt,
Aufgeküßt vom Sonnenstrahle,
Reißt der Lenz das Leichentuch
Auch vom eingescharrten Fluch.
Rasch aus Schnee und Eis hervor
Werden dann die Gräber tauchen,
Aus den Gräbern wird empor
Himmelwärts die Schande rauchen,
Und dem schwarzen Rauch der Schmach
Sprüht der Rache Flamme nach.
Aber kommt die Rache nicht,
Mag der Vogel mit dem Halme,
Was da lebt im weiten Licht,
Sterben in des Fluches Qualme,
Und die Sonn’ ersticke d’rin,
Daß die Erde schmachte hin! –
(Lenau, HKA I, 39f.)
Rheinkrise
Die sogenannte Rheinkrise von 1840, begründet durch die von Frankreich mit einem Mal wieder geltend gemachten Ansprüche auf das linke Rheinufer als „natürlicher“ Ostgrenze, gibt dem deutschen Nationalismus noch einmal einen gewaltigen Auftrieb. Allgemein hatten die Friedensjahre auch in den breiteren Bevölkerungskreisen eine gewisse Abkühlung der lange Jahre verbreiteten Frankophobie, des Germanenkults und der Reichsmythologie mit sich gebracht, was sich beispielsweise ganz allgemein an dem allmählich differenzierteren Umgang der Geschichtsschreibung mit der Französischen Revolution und sehr konkret dann an dem gewandelten Napoleonbild ablesen lässt, das die Literatur in den zwanziger Jahren im Unterschied zu den Dämonisierungen des französischen Kaisers aus der Kriegszeit allmählich zu transportieren beginnt (Eke 1997, Kap. 7). Durch die Julirevolution hatte Frankreich in den liberalen Schichten in gewisser Weise gar eine Vorreiter- und Vorbildrolle für die Durchsetzung liberaler Ideen gewonnen, mit der die Idee einer deutsch-französischen Allianz Auftrieb erhält.
Die durch die Regierung Thiers in Paris mit Kriegsvorbereitungen noch unterstützte Forderung zur Aufhebung der Verträge von 1815, mit denen die Siegermächte dem unterlegenen Frankreich den Verzicht auf die linksrheinischen Gebiete abgezwungen hatten, rief in Deutschland die Erinnerung an den napoleonischen Expansionismus wach und bewirkte ein durch nahezu alle Schichten und Klassen sich ziehendes patriotisches Echo, das die einigende Kraft des Nationalismus einmal mehr unter Beweis stellte. Das Rheinlied des 1809 in Bonn geborenen und bereits 1845 in Hunshoven bei Geilenkirchen gestorbenen Gerichtsschreibers (Auskultators und Aktuars) Nikolaus Becker spiegelt in überaus markanter Weise diesen Nationalpatriotismus, der die deutschen Länder in den vierziger Jahren erfasste:
Der deutsche Rhein
Sie sollen ihn nicht haben,
Den freien deutschen Rhein,
Ob sie wie gier‘ge Raben
Sich heiser danach schrein,
Solang er ruhig wallend
Sein grünes Kleid noch trägt,
Solang ein Ruder schallend
In seine Woge schlägt.
Sie sollen ihn nicht haben,
Den freien deutschen Rhein,
Solang sich Herzen laben
An seinem Feuerwein;
Solang in seinem Strome
Noch fest die Felsen stehn,
Solang sich hohe Dome
In seinem Spiegel sehn.
Sie sollen ihn nicht haben,
Den freien deutschen Rhein,
Solang dort kühne Knaben
Um schlanke Dirnen frein;
Solang die Flosse hebet
Ein Fisch auf seinem Grund,
Solang ein Lied noch lebet
In seiner Sänger Mund.
Sie sollen ihn nicht haben,
Den freien deutschen Rhein,
Bis seine Flut begraben
Des letzten Manns Gebein!
(Hermand 1967, 128)
Das im September 1840 veröffentlichte Lied Beckers ist nur ein Beispiel für die Flut von patriotischen Gedichten, die im Zuge der Rheinkrise veröffentlicht wurden; es ist aber sicherlich das bei weitem populärste Rheinlied und wurde allein ca. 200 Mal vertont. Ernst Moritz Arndt hat ebenso ein Rheinlied gedichtet („Das Lied vom Rhein an Niklas Becker“) wie Max Schneckenburger („Die Wacht am Rhein“) und selbst der Linksliberale Robert Prutz („Der Rhein“). Auch August Heinrich Hoffmann von Fallerslebens „Lied der Deutschen“, das seit 1922 als deutsche Nationalhymne dient, entsteht in diesem Kontext (vgl. dazu im Einzelnen Kap. V, 2).
Verbindung von deutschem Idealismus und französischem Sozialismus
Erstaunlich genug nach den nur wenige Jahre zurückliegenden ideologischen und politischen Verwerfungen (Französische Revolution, napoleonische Hegemonie): Spätestens von der Juli-Revolution an bestimmte für rund zwei Jahrzehnte das Verhältnis zwischen deutschen und französischen Intellektuellen eine entente cordiale, die durch die Rheinkrise vorübergehend zwar irritiert, nicht aber im Grundsatz erschüttert werden konnte. Alles in allem gelten die Jahre zwischen Juli- und Märzrevolution als eine Blütezeit des deutsch-französischen Kulturaustausches und des deutsch-französischen Ideentransfers, die in diesem Maße zuvor bislang nicht erreicht worden war und danach sobald auch nicht wieder erreicht werden sollte (vgl. dazu Höhn/Füllner 2002). Die Idee einer Verschmelzung von deutschem Idealismus (Theorie/Philosophie) und französischem Sozialismus (Tat/politische Praxis), zu der Heine 1831 in der „Einleitung zu ‚Kahldorf über den Adel‘“ mit der Parallelisierung zwischen französischer politischer und deutscher Ideen-Geschichte wichtige Stichwörter geliefert hat, markiert die Fluchtlinie dieser deutsch-französischen Herzensallianz. „Seltsam ist es“, so Heine, „daß das praktische Treiben unserer Nachbaren [!] jenseits des Rheins, dennoch eine eigne Wahlverwandschaft hatte mit unserem philosophischen Träumen im geruhsamen Deutschland. Man vergleiche nur die Geschichte der französischen Revoluzion mit der Geschichte der deutschen Philosophie, und man sollte glauben: die Franzosen, denen so viel wirkliche Geschäfte oblagen, wobey sie durchaus wach bleiben mußten, hätten uns Deutsche ersucht unterdessen für sie zu schlafen und zu träumen, und unsre deutsche Philosophie sey nichts anders als der Traum der französischen Revoluzion.“ (DHA XI, 134)
Während Marx, dem es freilich weniger um ein Bündnis zwischen Frankreich und Deutschland als vielmehr um ein solches zwischen Philosophie und Proletariat ging, einige Jahre später von den Deutschen als bloß „philosophischen[n] Zeitgenossen der Gegenwart“ („Zur Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie. Einleitung“, Deutsch-Französische Jahrbücher, 1844) sprach, hat Heine diese Parallelisierung durchaus nicht so negativ gemeint, wie es der ironische Ton seiner ‚Einleitung‘ auf den ersten Blick vermuten lässt. Als Fortschrittsbewegung eindeutig gemacht hat er die geistige Revolution so beispielsweise dann in der 1834 erschienenen Schrift „Zur Geschichte der Religion und Philosophie in Deutschland“. „Auf beiden Seiten des Rheines“, heißt es hier, „sehen wir denselben Bruch mit der Vergangenheit, der Tradizion wird alle Ehrfurcht aufgekündigt, wie hier in Frankreich jedes Recht, so muß dort in Deutschland jeder Gedanke sich justifiziren, und wie hier das Königthum, der Schlußstein der alten socialen Ordnung, so stürzt dort der Deismus, der Schlußstein des geistigen alten Regimes.“ (DHA VIII/1, 77)
Vorreiterrolle Frankreichs
Daran dass Frankreich in der projektierten entente cordiale Ton und Tempo angibt, hat Heine, der dies bereits von Paris aus geschrieben hat, im Übrigen keinen Zweifel gelassen. Frankreich war für ihn – und auch für die anderen deutschen Intellektuellen, die sich in den dreißiger Jahren nach Paris wandten (oder zumindest die Blicke dorthin richteten) – Vorreiter auf dem Weg in die Moderne. Börne bezeichnete Frankreich von hier aus mit einem schlagenden Bild als „das Zifferblatt Europens; hier sieht man, welche Zeit es ist, in andern Ländern muß man die Uhr erst schlagen hören, um die Stunde zu erfahren“ (Börne 2, 666). Dennoch war der deutsch-französische Ideentransfer alles andere als eine einseitige Angelegenheit. In dem selbem Maße, in dem in Deutschland die ‚französischen Zustände‘ (Heine), also die politische Entwicklung und die fortgeschrittene soziale Ideologie, zur Kenntnis genommen wurden, wurden umgekehrt in Frankreich deutsche Literatur und Musik, Philosophie und Philologie rezipiert. Die Voraussetzungen dafür waren bereits vor der Julirevolution geschaffen worden (u. a. durch Victor Cousins Versuch einer Integration ausgewählter Teilstücke deutscher und französischer Philosophie in sein System des ‚Eklektizismus‘; mit der Rezeption der deutschen klassischen und romantischen Literatur im Gefolge von Madame de Staëls „De l’Allemagne“; dem Durchbruch der französischen Romantik im Zuge der sogenannten „bataille d’Hernani“); sie kamen aber erst in den dreißiger Jahren voll zum Tragen (Höhn 2002, 27). Der hohen Anzahl von Korrespondenten deutscher Zeitungen, die zwischen 1830 und 1848 aus Paris berichteten, entsprach so umgekehrt die große Offenheit der französischen Presse für Berichte aus Deutschland; der nahezu unüberschaubaren Zahl von deutschen Intellektuellen, Künstlern, Wissenschaftlern und Publizisten, die sich dauerhaft oder vorübergehend in der französischen Metropole niederließen, stand umgekehrt die (in ihrer Größenordnung allerdings unvergleichbare) Anzahl französischer (romantischer) Schriftsteller (Edgar Quinet, Gérard de Nerval, Alexandre Dumas, Honoré de Balzac, Victor Hugo), Philosophen und Wissenschaftler gegenüber, die Deutschland bereisten.
Scheitern von Allianzen
Auffallend ist, dass ungeachtet dieser günstigen Voraussetzungen für einen Austausch der Ideen und politischen Praktiken fast alle konkreten Projekte einer intellektuellen Allianz zwischen Deutschen und Franzosen, auf die vor allem die nach Paris emigrierten deutschen Schriftsteller und Intellektuellen ihre Hoffnungen gesetzt hatten, scheiterten. Das gilt für Börnes Zeitschriftenprojekt „La Balance. Revue allemande et française“ (1836) ebenso wie für die von Arnold Ruge und Karl Marx herausgegebenen „Deutsch-Französischen Jahrbücher“ (1844), die alle progressiven Kräfte hatten zusammenführen und durch eine Verbindung von junghegelianisch deutscher Philosophie und französischer revolutionärer Politik von Paris aus den politischen Umsturz in Deutschland auf publizistisch-pädagogischem Weg hatten vorbereiten sollen – womit die alte Bündnisidee nun die Gestalt einer revolutionären Strategie annahm (Höhn 2002 b, 271). Sprechend immerhin ist die Begründung, mit der Ruge Frankreich zum großen Vorbild für den politischen Kampf erklärte: Frankreich nämlich kämpfe „um die Realisierung der großen Prinzipien des Humanismus“, „welche die Revolution in die Welt gebracht“ hat, und verfolge aus diesem Grunde auch eine „kosmopolitische Sendung“: „was sie für sich erkämpft, das ist für alle gewonnen“ (Deutsch-Französische Jahrbücher, 1844, 86).
Auswirkungen der Pariser Februarrevolution
Im Grundsatz ändert sich an dieser Bedeutung des politischen Frankreich für die Deutschen auch in den folgenden Jahren nur wenig, obwohl sich bald immer deutlicher abzeichnete, dass die „alliance intellectuelle“ eine „Allianz von Intellektuellen [war], in der die Deutschen das Sagen haben wollten“ (Höhn 2002 b, 282). Und so ist es nicht verwunderlich, dass der im Februar 1848 von Paris ausgehende Funke der Revolution sehr schnell gerade auf Deutschland übergriff – womit die europäische Dimension der Pariser Februarrevolution keineswegs in Abrede gestellt werden soll (vgl. Lill 1998). Immerhin erschütterte sie wie kein anderes Ereignis der jüngeren politischen Geschichte, mit Ausnahme Großbritanniens und der nordischen Staaten sowie des zaristischen Russland, ganz Europa in kurzer Zeit in seinen Grundfesten. Binnen weniger Tage hatte die in der Nacht vom 22. auf den 23. Februar 1848 mit Massendemonstrationen gegen die großbürgerliche Regierung Guizot/Thiers begonnene Revolution in Paris die Ära des Bürgerkönigtums beendet. Louis Philippe hatte am 24. Februar abgedankt und damit den Weg freigemacht für ein republikanisches Frankreich.
Die von Frankreich ausgehende revolutionäre Euphorie verbreitete sich geradezu wie ein Flächenbrand über die Staaten des Deutschen Bundes. Für einen kurzen geschichtlichen Augenblick schien mit den Ereignissen in Paris die politische Herrschaftsordnung in den Staaten des Deutschen Bundes hinweggefegt zu werden – bis nach nur wenigen Monaten die alten Herrschaftsträger wieder die Oberhand gewannen und das politische System restabilisierten.
Die deutsche Märzrevolution
Im Rückblick betrachtet, erscheint der deutsche März als „Schnitt- und Kulminationspunkt verschiedener, seit langem angestauter Modernisierungskrisen politischer, wirtschaftlicher und gesellschaftlicher Provenienz“ (Kreutz 1999, 72; vgl. auch Wehler 21989, 660 ff.). Konjunkturelle Einbrüche und Versorgungskrisen hatten in der zweiten Hälfte der vierziger Jahre in Deutschland zu einer explosiven Lage geführt, in der die seit dem 23. Februar in Paris siegreiche Revolution wie eine Initialzündung für eine Aufstandsbewegung wirkte, in der soziale und politische Antriebsmomente, Protestaktionen der deklassierten Unterschichten, bürgerliche Verfassungs- und nationale Emanzipationsbewegungen vorübergehend eine unmittelbare, in ihren Zielen und Vorstellungen nichtsdestoweniger inkohärente und diffuse Verbindung eingingen. Der deutsche März ist keine einheitliche Bewegung; er stellt sich vielmehr dar als eine Folge revolutionärer Erschütterungen auf verschiedenen Feldern und Aktionsebenen, deren anfängliche Erfolge sich weniger einer zielbewussten revolutionären Strategie verdankten, als vielmehr der Implosion der überkommenen Staatsordnungen (Mommsen 1998, 16f.)
Bereits im Februar setzen auf dem Land, anfangs noch unkoordinierte, Erhebungen gegen zunächst vermögende Gläubiger, jüdische Händler und reiche Pfarrer, dann gegen die adlige Grundherrschaft ein, in deren Verlauf vielerorts die adligen Grundbesitzer zum Verzicht auf Abgaben, Jagd- und Gemeinderechte gezwungen wurden. In den Städten führten Unruhen zur Bildung konzessionsbereiter ‚Märzregierungen‘, mit der bekannte Liberale wie Heinrich von Gagern in Hessen-Darmstadt, Friedrich Römer in Württemberg und Karl Georg Hoffmann in Baden an die Spitze der Landesregierungen gelangten, bald jedoch schon bei der Durchsetzung der sogenannten ‚März‘-Forderungen an die Grenzen ihrer Möglichkeiten stießen. Die Einführung des allgemeinen (Männer-)Wahlrechts, von Versammlungs-, Vereins- und Pressefreiheit, die Erweiterung der Entscheidungskompetenzen der Landtage und Ministerverantwortlichkeit, eine umfassende Justizreform, die Lösung der „sozialen Frage“ und die Verbriefung eines Rechts auf Arbeit, insbesondere die Schaffung konstitutioneller Verfassungen und die Einberufung einer Nationalversammlung standen ganz oben auf der Liste dieser Forderungen.
Das Frankfurter Paulskirchenparlament
Schon am 3. März hob der alte Bundestag unter dem Druck der Ereignisse die Zensur auf; am 9. März, noch bevor in Wien ein Volksaufstand den verhassten Kanzler Metternich aus dem Amt jagen (13. März) sollte und in Berlin Friedrich Wilhelm IV. sich nach blutigen Straßenkämpfen zu einschneidenden Konzessionen bereit erklären musste (18. / 19. März), wurde die zuvor strafwürdige Trikolore Schwarz-Rot-Gold als Bundesfahne eingeführt. Mit diesen Anfangssiegen, zu denen die Abdankung Ludwigs I. von Bayern zugunsten Maximilians II. zu rechnen ist, der wie die Mehrzahl der Regenten in den deutschen Klein- und Mittelstaaten die Märzforderungen anerkannte, erachteten die Liberalen und auch die Mehrheit der Demokraten die Phase der Revolution für abgeschlossen; alles Weitere sollte jetzt auf parlamentarischem Wege, d.h. durch die künftige deutsche Nationalversammlung in die Wege geleitet werden. Damit aber verlor die Revolution, kaum dass sie begonnen hatte, ihre politische Schwungkraft. „Die ‚Bewegungspartei‘ setzte im Augenblick ihres unerwarteten politischen Triumphs, der potentiell mehrere Verhaltenschancen in sich barg, ganz überwiegend nicht auf die ‚revolutionäre Zerschlagung‘ der alten Ordnung, sondern auf ihre reformorientierte, ‚behutsame Umformung‘.“ (Wehler 21989, 717) Die entscheidenden Weichenstellungen dafür sollte das Frankfurter Parlament vornehmen, dem die Aufgabe zukommen sollte, die Gründung eines gesamtdeutschen Verfassungsstaates vorzubereiten und für die bislang noch verfassungslosen Einzelstaaten konstitutionelle Strukturen zu erarbeiten.
Vorparlament
Die Geschichte des Frankfurter Paulskirchenparlaments beginnt am 5. März in Heidelberg mit der Zusammenkunft von 51 führenden süd- und westdeutschen Liberalen (unter ihnen Friedrich Bassermann, Karl Theodor Welcker, Heinrich von Gagern, Georg Gottfried Gervinus, David Hansemann) und einigen Führern der radikalen Demokraten (Gustav von Struve, Friedrich Hecker, Johann Adam von Itzstein), die im Ergebnis die Einberufung einer nationalen Volksversammlung „zur Beseitigung der nächsten inneren und äußeren Gefahren wie zur Entwicklung der Kraft und Blüte deutschen Nationallebens“ forderten (Hansen 2 / 1, 1942, 531). Bereits in dieser ersten Versammlung unterlagen die radikalen Bewegungskräfte, die auf die Fortsetzung der Revolution durch das Institut eines revolutionären Vollzugsausschusses setzten, einer liberalen Mehrheit. Die plädierte dafür, den revolutionären Anlauf abzubrechen und alle weiteren Ziele auf parlamentarischem Wege durchzusetzen, d. h. auch die Initiative für alle zukünftigen politischen Veränderungen an die Nationalversammlung abzutreten. Aufgrund dieser Vorentscheidung traten vom 31. März bis zum 3. April 574 amtierende Abgeordnete aus neu- und altständischen Landtagen in Frankfurt zum sogenannten Vorparlament zusammen, das mehrheitlich für den in Heidelberg vorgezeichneten Reformweg optierte. Nur ein Teil der unterlegenen Republikaner riskierte unter der Führung der badischen Kammermitglieder Friedrich Hecker und Gustav von Struve am 12. April im Badischen einen Aufstand mit dem Ziel, die Revolution bis zur Etablierung einer föderativ strukturierten deutschen Republik nach amerikanischem Vorbild weiterzutreiben. Die Hoffnung dieser Gruppe, durch ein Bündnis mit Handwerkern, kleinen Gewerbetreibenden und Bauern eine politische Basis für eine radikale Demokratie zu schaffen, die Schluss machen sollte mit den Halbheiten des Liberalismus, blieb Illusion. Bundestruppen schlugen die Revolte noch im Ansatz nieder.
Arbeit des Frankfurter Parlaments
Nach Wahlvorbereitungen und Wahlen trat die Nationalversammlung am 18. Mai zu ihrer konstituierenden Sitzung zusammen und wählte am 29. Juni den österreichischen Erzherzog Johann zum Reichsverweser. Am 27. Dezember 1848 verabschiedete sie einen Grundrechtekatalog, in dem die individuellen Freiheits- und Eigentumsrechte verankert, die ständischen Relikte verabschiedet, zugleich die Gleichheit vor dem Gesetz, Presse-, Meinungs-, Versammlungs, Lehr- und Forschungsfreiheit sowie Religionsfreiheit festgeschrieben, Rechtssicherheit gewährt, nicht zuletzt auch die Todesstrafe abgeschafft und – vor allem – die Trennung von Legislative, Exekutive und Judikative festgelegt wurden.
Restabilisierung des politischen Systems
In der Frage der nationalen Einheit allerdings kam das Parlament nicht entscheidend weiter. Zudem schränkten die bald einsetzenden Erfolge der Gegenrevolution in den beiden entscheidenden Metropolen Wien und Berlin den politischen Handlungs- und Entscheidungsspielraum der Frankfurter Nationalversammlung schrittweise wieder ein. Nach erfolgreichen Versuchen der Restabilisierung an der Peripherie der Donaumonarchie (Norditalien, auf dem Balkan) schlagen zunächst kaiserliche Truppen unter dem Befehl des Fürsten zu Windischgrätz und des kroatischen Banus Jellačić von Bužim am 31. Oktober nach erbitterten Kämpfen in Wien einen Volksaufstand nieder und ermöglichen damit die Einsetzung eines gegen den deutschen Einheitsstaat gerichteten monarchistischen Regimes unter dem Fürsten von Schwarzenberg, der ausdrücklich die standrechtliche Hinrichtung des nach Wien entsandten Parlamentariers Robert Blum billigt und damit die Frankfurter Nationalversammlung desavouiert. Schwarzenberg verlegt den Wiener Reichstag nach Kremsier und degradiert ihn zunächst zur nicht mehr weiter nennenswerten Größe, um ihn schließlich am 4. März 1849 aufzulösen und eine pseudoliberale Verfassung zu oktroyieren. In Berlin übernimmt am 2. November eine konservative Regierung unter dem Grafen Friedrich Wilhelm von Brandenburg die Amtsgeschäfte, verhängt den Ausnahmezustand, lagert die Nationalversammlung in die Quarantäne nach Brandenburg aus und löst sie am 5. Dezember schließlich auf. Auch in Preußen wird von ‚oben‘ eine Verfassung oktroyiert, was nur bei oberflächlicher Betrachtung wie ein Zugeständnis erscheint. In Wirklichkeit signalisiert es den Umschlag der revolutionären Entwicklung.
Nicht allein in den Staaten des Deutschen Bundes, überall ist Ende 1848 in Europa die Restauration wieder auf dem Vormarsch. Frankreich hatte auch in dieser Hinsicht den Anfang gemacht. Ein dilettantisch ausgeführter Putschversuch der extremen Linken hatte bereits im Mai 1848 in Paris zu einem massiven Rechtsruck geführt. In seiner Konsequenz stehen die blutige Niederschlagung der Aufstände im Juni 1848, die sich gegen die Schließung der unrentablen Nationalwerkstätten gerichtet hatten, durch den mit diktatorischen Vollmachten ausgestatteten Kriegsminister Louis Eugène Cavaignac – und letztlich auch die überraschende Wahl ausgerechnet des Republik-Gegners Louis Napoléon Bonaparte in das Amt des Präsidenten der Zweiten Französischen Republik im Dezember 1848.
Scheitern der Verfassungspolitik
In Frankfurt einigte man sich nach langen und kontroversen Diskussionen zwar auf eine Mischung aus monarchischen und demokratischen, föderativen und unitaristischen Elementen als Staatsform (monarchischer Verfassungsstaat mit einem Erbkaisertum an der Spitze, Einrichtung eines Zweikammersystems als Legislative). Da seit dem Sieg der österreichischen Gegenrevolution im November 1848 und dem von Schwarzenberg offensiv vertretenen Führungsanspruch der Donaumonarchie in dem alten oder neuen Deutschen Bund eine gesamtdeutsche Lösung aber illusorisch geworden ist, entscheidet sich die Nationalversammlung im März 1849 mit denkbar knapper Mehrheit für eine kleindeutsche Lösung unter Ausschluss Österreichs mit Preußen an der Spitze. Am 28. März 1849 wird die neue Reichsverfassung verkündet und Friedrich Wilhelm IV. mehrheitlich zum „Kaiser der Deutschen“ gewählt. Der freilich lehnt am 3. April das neue Amt ab.
Auflösung des Parlaments
Da es für den preußischen König keinen Ersatz gab, war damit die Verfassungspolitik des Paulskirchenparlaments gescheitert. Der Versuch, die Reichsverfassung dennoch in den deutschen Staaten durchzusetzen, scheitert am Widerstand der Großmächte Preußen und Österreich sowie einer Reihe größerer Mittelstaaten. Versuchen zu einem neuen revolutionären Anlauf von ‚unten‘ war gleichfalls kein Erfolg beschieden; Aufstände in Dresden, Elberfeld, der Pfalz und Baden, wo sich die Verfassungskrise am gefährlichsten zuspitzte, wurden blutig niedergeschlagen. Das im Zuge dieser erneuten Auseinandersetzungen in die Enge gedrängte Frankfurter Parlament löste sich am 30. Mai 1849 selbst auf; ein Teil der nicht zur Aufgabe bereiten Abgeordneten wich nach Stuttgart aus, wo es als sogenanntes Rumpfparlament am 6. Juni ein erstes Mal zusammenkam, am 18. Juni aber von württembergischen Truppen aufgelöst und außer Landes verwiesen wurde. Fünf Tage später kapitulierte die Festung Rastatt, auf die sich im Zuge der badischen Revolution die letzten Verteidiger der Demokratie zurückgezogen hatten. Damit endete die deutsche Revolution.
Das Ende der „rosigen Morgenträume“
Der Rest ist Nachspiel: Am 1. 9. 1850 wird der Deutsche Bundestag wiedereröffnet, der Deutsche Bund unter österreichischer Führung wieder hergestellt. Die europäische Staatenwelt war damit erst einmal wieder auf die gesellschaftlichen Zustände zurückgeworfen, gegen die sich im Vormärz der Liberalismus und die radikale Demokratie als Opposition zu formieren begonnen hatten: In der großen Mehrzahl der europäischen Staaten regieren wieder halbabsolutistische Fürsten und in Paris, von wo aus alles seinen Anfang genommen hatte, reißt Louis Napoléon im Dezember 1851 mit einem Staatstreich die Macht an sich und lässt sich im Jahr darauf zum Kaiser krönen. „Die schönen Ideale von politischer Sittlichkeit, Gesetzlichkeit, Bürgertugend, Freyheit und Gleichheit, die rosigen Morgenträume des achtzehnten Jahrhunderts, für die unsere Väter so heldenmüthig in den Tod gegangen, und die wir ihnen nicht minder martyrthumssüchtig nachträumten“, schreibt Heine dazu Gustav Kolb, dem Redakteur der Augsburger „Allgemeinen Zeitung“, am 13. Februar 1852, „– da liegen sie nun zu unseren Füßen, zertrümmert, zerschlagen, wie die Scherben von Porzellankannen, wie erschossene Schneider“ (Säkularausgabe 23, 181).