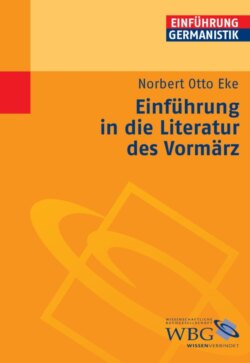Читать книгу Einführung in die Literatur des Vormärz - Norbert Otto Eke - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
II. Forschungsbericht
ОглавлениеRezeptionsgeschichte des deutschen Vormärz
Die literaturwissenschaftliche „Vormärz“-Forschung, die sich im Zuge der Aufbrüche von 1968 / 69 und beflügelt von dem Modell einer Sozialgeschichte der Literatur an den Universitäten der Bundesrepublik etablierte (in der DDR verlaufen die Prozesse in etwa zeitgleich und in der Frontstellung vergleichbar, wenn auch unter anderen Vorzeichen und mit langer Zeit starker Betonung des Epocheneinschnitts von 1830 – vgl. Rosenberg 1975, Böttcher u.a. 1975, Bock 1979), setzte an dieser Grenzziehung zwischen einem in sich ruhenden Kunstschönen und einer parteiergreifenden, eingreifenden Literatur an (vgl. Hermand 1967, Jäger 1971, Behrens u. a. 1973, Stein 1974, Vaßen 1975). Auch diese neue Stoßrichtung der Literaturgeschichtsschreibung, der eine im ersten Drittel des 20. Jahrhunderts erfolgte Neubestimmung des ursprünglich negativ besetzten ‚Vormärz‘-Begriffs als Strahlwort nun der auf die Revolution von 1848 zulaufenden Tendenzen und Prozesse vorausging, begann auf ihre Weise mit einer ‚Insurrekzion‘: einer ‚Insurrekzion‘ gegen die etablierte Germanistik. Mit der Rehabilitierung der engagierten, politisierenden und politischen Dichtung der ersten Jahrhunderthälfte – und das hieß in erster Linie zunächst einmal der oppositionellen und radikaldemokratischen Literatur der 1830er und 1840er Jahre – positionierte sich die junge „Vormärz“-Forschung im Widerspruch zur Forschung der amtierenden Lehrstuhlinhaber, die dem „Vormärz“ – einschließlich übrigens damals noch der Werke Heines und Büchners – nur wenig Interesse entgegenbrachten, insofern sie ihn nicht gleich ganz als epigonale Phase der Literaturgeschichte und damit als quantité négligeable abtaten. Jost Hermands Nachtrag zu der 1974 wiederveröffentlichten Einleitung seiner Dissertation „Die literarische Formenwelt des Biedermeier“ von 1958 dokumentiert in dieser Hinsicht sehr anschaulich die normative Blickverengung der deutschen Nachkriegsgermanistik. „Man lese“, so Hermand 1974, „vorstehendes Einleitungskapitel meiner Dissertation als ein Dokument der frühen Adenauerschen Restaurationsepoche, in der man in der BRD als Germanistikstudent bewußt von allen ‚liberalen‘ Strömungen ferngehalten wurde.“ (Hermand 1974, 312)
Biedermeier
Im Titel von Hermands Dissertation begegnet mit dem Begriff „Biedermeier“ ein literarhistorischer Terminus, an dessen Gegenläufigkeit zum politisch ausgerichteten ‚Vormärz‘-Begriff sich en miniature ein Stück Wissenschaftsgeschichte spiegelt. Immerhin hat diese doch je nach methodischer Ausrichtung ganz unterschiedliche Bilder der Literatur zwischen den Freiheitskriegen und der Märzrevolution von 1848 bzw. zwischen Romantik und poetischem Realismus produziert – je nachdem welcher Aspekt der Zeit unter welchen (primär) ideologisch-weltanschaulichen und (erst sekundär) literaturhistorischen Prämissen durch die Darstellung in den Vordergrund gerückt wurde. Ursprünglich wie der ‚Vormärz‘-Begriff negativ besetzt, hier nun als Ausdruck einer beschränkten biedersinnigen Form der Bürgerlichkeit, nach seiner Rehabilitierung um 1900 zunächst im Bereich des Kunstgewerbes, einige Jahre später dann auch in der Germanistik (Kluckhohn 1928), zeitweilig auch als Kampfbegriff völkisch-nationaler Kulturbegründung aktualisiert, diente der Begriff ‚Biedermeier‘ unter dem Einfluss nicht zuletzt von Friedrich Sengles monumentaler Untersuchung „Biedermeierzeit. Deutsche Literatur im Spannungsfeld zwischen Restauration und Revolution“ (3 Bde., München 1971 – 1980) zur Orientierung in der Diskussion um den Epochencharakter der nur schwer auf den Begriff zu bringenden Zeit vor der Märzrevolution (was dann die ursprünglich parodistische Bedeutung des Begriffs zur Gänze in den Hintergrund treten lässt, die sich als solche herleitet aus Adolf Kußmauls und Ludwig Eichrodts Parodie auf den deutschen Spießbürger „Die Gedichte des schwäbischen Schullehrers Gottlieb Biedermeier und seines Freundes Horatius Treuherz“, die 1850 und 1865 in den Münchner „Fliegenden Blättern“ zunächst unter dem Titel „Biedermeiers Liederlust“ erschienen war).
Helmut Koopmann hat die Grundzüge der Biedermeierzeit 1997 noch einmal in der folgenden Weise zusammengefasst:
Die Welt des Biedermeier ist eine bewußt beschränkte Welt; geordnete Sozialverhältnisse, das Leben in der kleinen Gemeinschaft der Großfamilie, das Sich-Begnügen mit den Verhältnissen, so wie sie sind, auch die Hinnahme einer bürgerlichen oder kleinbürgerlichen Enge kennzeichnen die Welt des Biedermeier ebenso wie die stark protestantisch gefärbte Tugendlehre, die auf Erfüllung der Pflicht, auf Sparsamkeit, Fleiß, Arbeitswilligkeit, Verzicht auf eigene Wünsche zugunsten einer Gemeinschaft abzielt. Das Wirken im Alltag, die Beschränkung des eigenen Tuns und Handelns auf das Gegebene, die Freude auch am Unbedeutenden, eine ausgesprochene Abneigung gegenüber Konflikten und das Fehlen jeglicher Streitkultur bestimmen das Leben und gleichermaßen die Literatur, die dieses Leben beschrieb. Die Liebe zum Kleinen und Kleinsten führte dabei zu einem Realismus gerade in der Darstellung der kleinen Dinge, die allerdings häufig überzeichnet wurden und oft auch überzeitliche Bedeutung bekamen, im Gegensatz zu den Gegenständen und Themen der Zeitschriftsteller und der Beschäftigung mit der Tagespolitik bei den Jungdeutschen oder den Vertretern des Vormärz. […] Die „Andacht zum Kleinen“ (Stifter), die Beschränkung auf überschaubare Lebensbereiche, eine im Kern konservative Ethik und der Realitätssinn des Bürgers, der politische Utopien ebenso fürchtete wie das offene Austragen untergründiger Spannungen, hatten eine Kehrseite: in der Biedermeierzeit vermehrten sich Langeweile und Zweifel am Sinn des Lebens; Schwermut und Hypochondrie, das Interesse an Krankheiten und Selbstmorden nahm zu, die Beschreibung pathologischer Seelenzustände und das Aufdecken bürgerlicher Tragödien unter dem Deckmantel sozialer Wohlanständigkeit und Zufriedenheit griff um sich, unter der Vordergründigkeit einer zufriedenen Weltbetrachtung wurden häufig irrationale und verhängnisvolle Züge der menschlichen Seele sichtbar. Das Auftauchen von Sonderlingen, Malkontenten [= Unzufriedenen], Querulanten, Psychopathen und problematischen Einzelgängern jeglicher Art verlieh den realistischen Darstellungen oft einen doppelten Boden. Ennui, Schwermut, Monotonie des Lebens, Gleichgültigkeit waren nicht nur Schlagworte der Zeit, sondern wurden auch dargestellt und literarisch ausgelebt. (Koopmann 1997, 49)
Sengle selbst wiederum hatte nicht allein im sogenannten „Weltschmerz“, einem Grundzug der Zerrissenheit und Schwermut, die Signatur der Epoche bestimmt, sondern in seine Biedermeier-Konzeption im Interesse einer ganzheitlichen Betrachtung der Epoche neben der apolitischen, durch Werte wie Harmonie, Häuslichkeit, Familie und Heimat bestimmten biedermeierlichen Literatur der Stifter und Mörike im landläufigen Sinn ausdrücklich auch die oppositionellen und revolutionären Tendenzen einbezogen.
Vormärzforschung versus Biedermeierforschung
Mit einer emphatischen, d.h. von unübersehbaren Identifikationsprozessen begleiteten Besetzung der politischen Ereignisstruktur, der finalistischen Einbettung der Vormärzzeit in einen durch die Französische Revolution und die Pariser Commune ‚epochal‘ charakterisierten historischen Großraum (Mattenklott/Scherpe 1974, 1) sowie der Konzentration auf den fortschrittlich-liberalen Teil der Literatur und damit der Favorisierung der politisch-literarischen Prozesse gegenüber den ästhetischen Erscheinungen stellte sich die junge Vormärz-Forschung der ausgehenden sechziger und der siebziger Jahre mit mehr oder minder programmatischem Anspruch gegen die Biedermeier-Konzepte der älteren Germanistik, aber auch gegen Sengles integratives Biedermeier-Konzept. Sie trat damit im übrigen auch dem Konzept ‚Restaurationszeit‘ (Sengle 1956; 1971 dann durch das Konzept ‚Biedermeierzeit‘ ersetzt) bzw. ‚Restaurationsperiode‘ (Hermand 1970) entgegen, womit der zweite konkurrierende Epochen- oder Zeitalterbegriff benannt ist.
‚Vormärz‘ als Restaurationszeit?
Als ‚Restauration‘ verstanden die Herrschenden selbst ihre Politik nach dem Wiener Kongress, der 1815 die Ära der Napoleonischen Vorherrschaft in Europa auf allen Ebenen abschloss, nachdem Napoleon bereits zuvor bei Belle Alliance (Waterloo) endgültig militärisch besiegt und für immer nach St. Helena verbannt worden war. ‚Restaurationszeit‘ oder ‚Restaurationsperiode‘ sollte dem folgend die Epoche auf ihren Begriff bringen, die Einheit der Epoche also in ihrer konservativen (und eben nicht revolutionär-demokratischen) Wertigkeit bestimmen. Die Literaturgeschichtsschreibung hat sich streckenweise auch dieses Begriffs bemächtigt und ihn aus seiner konservativen Wertigkeit befreit. Jost Hermand hat in einem frühen Versuch, das Problem der Epochenbezeichnung zu lösen, so für den Begriff „Restaurationsperiode“ als Oberbegriff für die konservativen und liberalen Strömungen der Zeit zwischen 1815 und 1848 plädiert (Hermand 1970, 3 – 61), während er den Begriff „Vormärzliteratur“ allein für die progressiven Autoren der 1840er Jahre hatte reservieren wollen.
Ausdifferenzierung der Vormärz-Forschung
Hermands Versuch selbst ist Teil damit der von zahlreichen Kontroversen um den Zeitraum, um die Zugehörigkeit von Autorengruppen, um Ideologie und Politik begleiteten Geschichte der Vormärz-Forschung, die sich mittlerweile breit ausdifferenziert hat, wenn auch das alte dualistische Epochenbild (unpolitisches Biedermeier vs. politischer Vormärz), das noch Hermands Versuch einer Epochendefinition unübersehbar geprägt hat, nach wie vor nicht völlig überwunden ist. Zahlreiche Namensgesellschaften, die sich für einzelne Autoren engagieren (Heine, Büchner, Grabbe etc.), längst aber den Blick auf die Gesamtheit des Literatursystems richten, belegen das anhaltende Interesse für den lange vernachlässigten „leidigen Zeitraum“ (Hermand 1970, 16) ebenso wie die Arbeit des 1994 als Zusammenschluss von Wissenschaftlern aus verschiedenen Wissenschaftsdisziplinen (Literaturwissenschaft, Komparatistik, Geschichtswissenschaft, Theologie, Soziologie, Philosophie) und Nationen (u. a. Deutschland, Frankreich, den USA und Japan) gegründeten „Forum Vormärz Forschung“, das mit Tagungsveranstaltungen, einem Jahrbuch sowie einer eigenen Schriftenreihe die Vormärz-Forschung zu bündeln sucht. Als interdisziplinäre Forschung ist die Vormärz-Forschung heute aus der Wissenschaft nicht mehr wegzudenken. Dass die Periodisierungsgrenzen dabei, wie erwähnt, heute relativ offengehalten werden, ist das eine. Auch die traditionelle Zweiteilung in eine progressiv-emanzipatorische und eine autonomie-ästhetische, konservativ-restaurative Literatur und damit die Konzentration auf die progressiv-politische Literatur, die am Anfang der Vormärz-Forschung stand und ihrerseits zu beschränkenden Kanonisierungen geführt hat, aber ist mittlerweile weitgehend ad acta gelegt, auch wenn die Forschung deshalb nicht zwangsläufig damit schon eine befriedigende Antwort auf die um sich greifende Einsicht in die unterhalb der dichotomischen Ebene ‚vormärzliche vs. biedermeierliche Literatur‘ verlaufenden Differenzierungsprozesse gefunden hat. Noch immer begleitet eine gewisse Hilflosigkeit angesichts der Ambiguität der Zeit die verschiedenen Versuche, die Epoche als Ganzes auf einen Nenner zu bringen. Mit der Anerkennung der Komplementarität der in der Literaturgeschichtsschreibung so lange getrennten Begriffe ‚Biedermeier‘ und ‚Vormärz‘ nun unter Voranstellung des ‚Vormärzbegriffs‘ immerhin steht selbst die Einheit der Epoche neuerdings zur Diskussion (womit sich allerdings die Frage nach der Sinnhaftigkeit eines Festhaltens an den alten Periodisierungskonzepten stellt). Komplementarität meint dabei: jede Konzentration der Epochensignatur auf das eine oder das andere, auf die sich selbst bescheidende apolitische Innerlichkeit auf der einen und auf die politische Zuspitzung der Kunst auf der anderen Seite, stellt eine Verkürzung dar; die Epoche ist eine der Gleichzeitigkeit des Ungleichen; die Epochenbegriffe „Biedermeier“ und „Vormärz“ erfassen mit anderen Worten „sich zwar widersprechende, aber auch ergänzende Lebensweisen, Ideenwelten und Aktivitäten in der tatsächlichen Geschichte zwischen 1815 und 1848“ (Bock 1999, 21).
Erneute Öffnung der Epochendiskussion
Vor nicht allzu langer Zeit hat Sigrid Weigel die Epochendiskussion in gleich zweifacher Hinsicht wieder geöffnet: Zum einen mit dem Einwand, der ohnedies von wechselnden ideologisch-politischen Wertungskonzepten abhängige Epochenbegriff „Vormärz“ lasse die Nachgeschichtlichkeit seiner Entstehung und damit seine spezifische Wertigkeitsperspektive vergessen; im Vorzeitigen des Vormärz verschwinde geradezu das „Moment der Nachträglichkeit, da in ihm jede Artikulation und kulturelle Manifestation gleichsam teleologisch auf die Märzrevolution hin und damit als ursächlicher Teil von deren Vorgeschichte begriffen wird.“ (Weigel 1996, 10) Zum anderen hat sie die Diskussion mit der Bestimmung des Begriffskompositums „Nachmärz“ im Sinne einer überhistorischen Kategorie postrevolutionärer Erfahrung der Enttäuschung und Ernüchterung wieder belebt.
Nicht nur Peter Stein, der bereits Mitte der siebziger Jahre konsequent für die Anwendung des Epochenbegriffs „Vormärz“ auf den gesamten Zeitraum zwischen 1815 und 1848 und für die Aufhebung der Gegensatzstruktur „Vormärz“ versus „Biedermeier“ in einem übergeordneten Vormärzbegriff plädiert (und sich letztlich á la longue damit auch durchgesetzt) hat (Stein 1974), hat Weigels Vorbehalte mit einem Plädoyer für die Beibehaltung des Epochenbegriffs „Vormärz“ unter der Voraussetzung zu kontern versucht, dass dieser nicht als Bezeichnung für eine literarisch begleitete Zeitbewegung verstanden wird, die in der Revolution von 1848 ihre Erfüllung fand (vgl. u.a. Stein 2000).
Politisch-ideologische und poetologisch-ästhetische Aspekte im Vormärzbegriff
Die wieder aufgeflammte Diskussion zeigt, dass der Vormärzbegriff nach wie vor grundsätzlich daran krankt, dass in ihm politisch-ideologische und poetologisch-ästhetische Aspekte nicht klar voneinander geschieden sind. Letztlich bleibt damit semantisch unsicher, was denn genau nun das Vorzeitige im „Vormärz“ besagen will und was damit den ‚Prä‘-Charakter der beschriebenen ‚Epoche‘ ausmacht: Ein Ensemble von Methoden, Techniken und Ideen, von politischen, ideengeschichtlichen und ästhetischen Diskursen? Eine sozialpolitische oder wirtschaftsgeschichtliche Konstellation? Eine Mentalität? Zum anderen bestehen nach wie vor nicht gelöste Abgrenzungsprobleme gegenüber zeitgleichen bzw. vorangehenden und nachfolgenden Epochen, wovon die in den vergangenen Jahren vom „Forum Vormärz Forschung“ veranstalteten internationalen Symposien zu den Themen „Vormärz und Klassik“ (1996), „Vormärz/Nachmärz. Bruch oder Kontinuität?“ (1998) und „Vormärz und Romantik“ (2001) beredt Zeugnis ablegen.
‚Vormärz‘ als Übergangszeit
Entscheidende Impulse hatte die Vormärz-Forschung in den neunziger Jahren zudem von poststrukturalistischen und systemtheoretischen Ansätzen her erfahren, die ausgehend insbesondere von der Erzählliteratur die relativ festen Epochengrenzen wieder in Frage stellten. Zur Diskussion steht mit ihnen ein Konzept von Literaturgeschichtsschreibung, die das Ganze eines um 1830 einsetzenden und bis in die 1890er Jahre reichenden Wandlungsprozesses auf den verschiedensten Ebenen (sozial, geistesgeschichtlich, literarisch, wirtschaftlich-industriell) in den Blick zu nehmen verlangt. Dieses Modell, in dem Schwellenereignissen wie den Revolutionen von 1830 und 1848 / 49 kaum mehr Bedeutung zukommt als Beschleunigungsfaktoren darzustellen innerhalb bestehender Entwicklungen, setzt an die Stelle des alten Konstrukts einer (Literatur-)Geschichte in Ab-Brüchen und Diskontinuitäten eine Literaturgeschichtsschreibung in der Perspektive längerfristiger Umsetzungen, Beschleunigungen und Stillstellungen. Was man sich von einer solchen Blickweise erhofft, ist die genauere Erfassung längerfristiger Wandlungsprozesse auf der einen und die Erklärung der Gleichzeitigkeit konkurrierender Tendenzen auf der anderen Seite (z. B. das Nebeneinander von technologischem und ökonomischem Wandel bei gleichzeitiger Kontinuität traditioneller Ordnungsstrukturen in Staat, Recht und Familie). „Vormärz“ in diesem Konzept freilich wäre damit keine Epoche eigenen Rechts mehr, sondern ein Übergangszeitraum zwischen zwei ideologisch und sozio-politisch relativ stabilen Phasen längerer Dauer. „Vormärz“ wäre mit anderen Worten eine Phase relativer Offenheit innerhalb eines Gesamtentwicklungsprozesses, der irgendwo in den endzwanziger Jahren beginnt und in den endvierziger bzw. den beginnenden fünfziger Jahren endet (womit sich dann auch die alte Diskussion über den Zeitraum dessen, was ‚Vormärz‘ genannt werden soll, endgültig erledigt hätte): „Vormärz“ also als eine „Suchbewegung des Experimentierens“ (Frank 1996, 32), als ein durch einen Verzicht auf Autonomie zugunsten von Alltagstauglichkeit und Wirkung sowie die Integration primär nichtliterarischer Aussageweisen wie Wissenschaft und Journalistik in die Literatur (‚Diskursintegration‘) gekennzeichnetes ‚Moratorium‘ – oder anders: als ein Laborzeitraum zwischen den relativ stabilen Literatursystemen der Goethezeit (das um 1830 relativ abrupt zusammenbricht) und des Realismus (in dem sich das System um 1850 restabilisiert) (vgl. Frank 1996, 1997, 1998). Ohne Frage bietet dieses Modell zumindest den Vorteil der Unabhängigkeit von aus der politischen Geschichtsschreibung abgeleiteten Epochengrenzen – wenn auch um den kaum reflektierten Preis der Revitalisierung alter Forschungspositionen (der „Vormärz“ als Übergangszeit) in neuer theoretischer Bemäntelung. Dass es als solches auf Widerspruch insbesondere von Seiten der traditionellen Vormärz-Forschung stoßen würde, die denn auch prompt einen „Ausschluß des Politisch-Sozialgeschichtlichen“ beklagte – und dies ausgerechnet bei „eine[r] dezidiert politische[n] Epoche“ (Stein/Vaßen 1998, 16f.) –, war zu erwarten.
Angesichts dieser Diskussionen dienen die im Titel des hier vorgelegten Überblicks genannten Jahreszahlen lediglich der Orientierung, haben also nicht mehr als heuristische Bedeutung. Walter Weiss‘ Anregung, die „Mehrdimensionalität“ der Epoche in einer Formulierung wie „Deutsche Literatur im Spannungsfeld von Restauration und Revolution, Rhetorik und Realismus, Biedermeier und Vormärz“ zum Ausdruck zu bringen (Weiss 1987, 511), mag als Vorschlag zur Güte taugen, handhabbar aber ist auch dieser Vorschlag nicht (davon dass die verwendeten Begriffe damit für sich noch nicht hinreichend geklärt sind, einmal ganz abgesehen); Weiss seinerseits hat denn selbst auch am ‚Vormärz‘-Begriff als ‚kleinstem Übel‘ (Weiss 1987, 514) festgehalten. Auffallend an den jüngsten Veröffentlichungen zum Thema ‚Vormärz‘ ist so auch eine gewisse Zurückhaltung gegenüber einer allzu starren Epochenkonstruktion. Das mag daran liegen, dass die Bedingungen jenes tiefgreifenden Wandlungsprozesses, in dessen Verlauf das relativ geschlossene System der Goethezeitlichen Ästhetik in dasjenige des Realismus überging, nach wie vor nicht hinreichend geklärt sind.